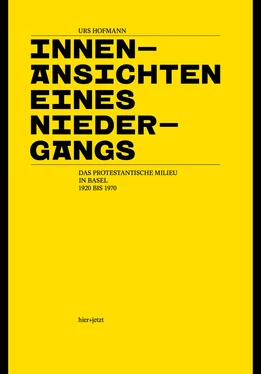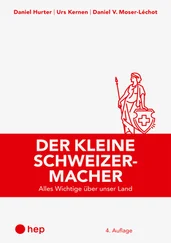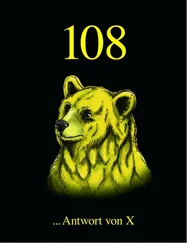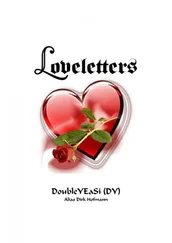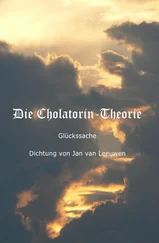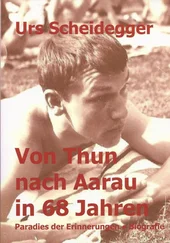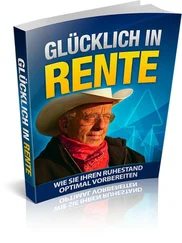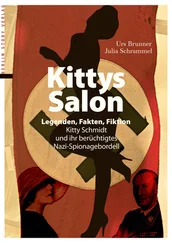1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 DER KIRCHENFREUND
Den traditionellen Gegenpol zu den «Reformern» vertraten die «Positiven», sie pflegten einen kirchlichen Konservativismus und hielten das Erbe der Reformation und des Pietismus hoch: «Wenn es für die Liberalen wesentlichstes Anliegen war und blieb, dass die Volkskirche allen theologischen Lehrmeinungen, allen religiösen Überzeugungen freien Raum zu geben habe, so betonten die Positiven die unaufgebbare Bindung an die Autorität der Bibel und der alten Bekenntnisse.» 96 Organ der Positiven war der Kirchenfreund . 1867 in Basel als Basler Kirchenfreund gegründet, erschien er jeweils am 1. und 15. des Monats. Auch diese Zeitschrift trug ihre Selbstbeschreibung im Untertitel: «Blätter für die evangelische Wahrheit und das kirchliche Leben». Weil die Verleger des Blattes, Helbing & Lichtenhahn in Basel, Ende 1918 angesichts der «Steigerung der Herstellungskosten» keine Möglichkeit mehr sahen, das Erscheinen des Kirchenfreundes fortzuführen, beschloss das Zentralkomitee des Evangelisch-kirchlichen Vereins, sein Zentralorgan zu übernehmen. Der Seitenumfang wurde dabei von 16 auf 8 Seiten reduziert. Glaubt man den Angaben der Redaktion, genügte die Zahl der Abonnenten «schon lange nicht mehr, um das Blatt sicherzustellen, obschon seit zirka zehn Jahren [...] die Zahl der Abonnenten beständig im Steigen begriffen war». 97 Verlag und Redaktion waren nur mehr kurze Zeit in Basel ansässig, 1920 erfolgte die Verlegung nach Zürich. Mit Basel weiterhin verbunden blieb der Kirchenfreund durch Basler Redaktionsbeteiligung. Am 15. Dezember 1951 erschien die letzte Ausgabe der Zeitschrift, das Blatt hatte «einen zu kleinen Leserkreis», zudem machte ihm die doppelte Aufgabe, theologisches und erbauliches Blatt zu sein, offenbar zu schaffen: «Den einen war der Kirchenfreund zu theologisch, den andern zu wenig theologisch.» 98 Statt aber klein beizugeben, plante der Schweizerische evangelisch-kirchliche Verein eine noch viel grössere Zeitschrift – unter dem Namen Reformatio sollte die umfangreiche Monatsschrift weiterhin der positiv-evangelischen Kirchenpolitik dienen, allerdings sprachlich «fasslicher, anschaulicher, zügiger» und inhaltlich breiter. 99 Reformatio hatte hingegen keinen Bezug mehr zu Basel, weshalb diese Zeitschrift für die vorliegende Forschungsarbeit nicht systematisch, sondern nur punktuell, also themenbezogen untersucht wurde.
CHRISTLICHER VOLKSBOTE/CHRISTLICHER VOLKSFREUND
Ebenfalls der positiven Richtung zugerechnet werden können der Christliche Volksbote und der Christliche Volksfreund, die wöchentlich in der Basler Druckerei Friedrich Reinhard erschienen sind. Der Herausgeber des seit 1833 publizierten Christlichen Volksboten, entschloss sich 1941 vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen dazu, die Zeitschrift einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt zählte der Volksbote noch 1500 Abonnenten. 100
Auch sein Pendant, der Christliche Volksfreund, sah sich in den 1940er-Jahren gezwungen, das Erscheinen aus Rentabilitätsgründen einzustellen. Während im ersten Jahr 2240 Abonnenten gezählt werden konnten, waren es zur Blütezeit der Zeitschrift über 10 000, zum 50-jährigen Bestehen 4365 und zum Zeitpunkt der Einstellung 1948 noch 2133. 101 Als Hauptgrund für die Einstellung werden die «um ein Vielfaches» gestiegenen Kosten angegeben; «die Einnahmen decken in keiner Weise mehr die Ausgaben.» Dazu kam, dass wohl auch die Dringlichkeit, dem «mächtigen Vordringen der Reformbewegung, die damals [z. Z. der Gründung der Zeitschrift, U. H.] in die Gemeinden eindrang und weite Kreise bewegte und beunruhigte», entgegenzutreten, nicht mehr im selben Masse gegeben war. 102
KIRCHENBLATT FÜR DIE REFORMIERTE SCHWEIZ
Die Vertreter der dialektischen Theologie hatten im Kirchenblatt für die reformierte Schweiz ihr eigenes Organ, dasjenige mit dem längsten Atem. Die wesentlich von Basel aus geprägte Richtung (Karl Barth, Eduard Thurneysen) hatte mit Gottlob Wieser, Pfarrer in Riehen-Bettingen, fast über den ganzen Untersuchungszeitraum hinweg denselben Redaktor (1936–1969). Die 1844 gegründete Zeitschrift erschien im Zweiwochenrhythmus bis 1986, in wechselnden Verlagen und Verlagsorten; bis mindestens 1975 war das Kirchenblatt auch wesentlich unter Basler Einfluss.
BASLER KIRCHENBOTE
Der Basler Kirchenbote, 1934 erstmals erschienen, verband die Nachrichten aus den einzelnen Kirchgemeinden mit einem allen Ausgaben gemeinsamen, zwei- bis achtseitigen Redaktionsteil. Ab 1950 wurden die verschiedenen Ausgaben der Kirchengemeinden zu einem einzigen Dachblatt der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt zusammengefasst. Der Kirchenbote verstand sich weiterhin in erster Linie als Informationsorgan der Kirchgemeinden, daneben fanden sich aber auch mehr oder weniger richtungsneutrale redaktionelle Texte. Um seine Abonnentenzahlen musste sich der Kirchenbote im Gegensatz zu den anderen Zeitschriften keine Sorgen machen – das Blatt wurde und wird auch heute noch, begleitet von Spendenaufrufen, kostenlos sämtlichen Haushalten mit Mitgliedern der evangelisch-reformierten Kirche zugestellt.
EVANGELISCHE VOLKSZEITUNG
Die Evangelische Volkszeitung, das Organ der Evangelischen Volkspartei der Schweiz, wurde 1920 gegründet. Die Evangelische Volkspartei wollte mit ihrer zuerst monatlich, ab 1922 wöchentlich erscheinenden Zeitschrift «in die praktische politische Tätigkeit der christlichen Kreise Grundsätzlichkeit, Geschlossenheit und Zusammenhang bringen», 103 selbstredend auch in die eigene Politik der Evangelischen Volkspartei. Dieses Blatt diente beispielhaft der Selbstvergewisserung einer politischen Partei, wenn die Redaktion zur Einführung schreibt, «schwerer als andere Parteien werden wir in vielen Dingen zu einhelligen Entschlüssen kommen [...]. Dringend notwendig ist also Abklärung und Austausch unserer Ansichten [...].» 104 Das Blatt erschien bis 1953.
Auflagenzahlen publizierten die protestantischen Zeitschriften in der Regel keine. Einen Hinweis zur Verbreitung geben die oben erwähnten Abonnentenzahlen des Kirchenfreunds und des Christlichen Volksfreunds zum Zeitpunkt der Aufgabe der Zeitschrift. Zieht man weitere indirekte Informationen in Betracht, wie zum Beispiel die Kosten der Zeitschrift, 105 Spendenaufrufe an die Leserinnen und Leser oder andere mehr oder weniger verborgene Hinweise zur (meist) schwindenden Leserschaft, dürfte die Zahl der Abonnements je zwischen 1500 und höchstens 5000 betragen haben. 106 Eine Ausnahme davon bildet der Kirchenbote, der dank der Besonderheit seiner Zustellungsweise in sämtliche Haushaltungen in einer Auflage von rund 44 000 (1935) bis 50 000 (1942) verbreitet wurde. 107 Eine Hochrechnung eher spielerischen Charakters zeigt, dass nur ein kleiner Teil der evangelisch-reformierten Haushaltungen zusätzlich zum Kirchenboten eine zweite kirchliche Zeitschrift abonniert hatte: Nimmt man für die fünf kirchlichen Zeitschriften (ohne Kirchenbote ) eine durchschnittliche Auflagenzahl von 3000 an, ergibt sich eine Gesamtauflage von 15 000. Verschiedene Haushaltungen bezogen wohl mehr als eine Zeitschrift im Abonnement, viele dagegen wohl keine, deshalb verteilen sich die 15 000 Zeitschriften nicht auf dieselbe Anzahl Haushaltungen, sondern eher auf zwei Drittel davon. Somit erreichten die kirchlichen Zeitschriften höchstens rund ein Viertel bis ein Fünftel der evangelisch-reformierten Gemeinde Basels. Alle erwähnten Zeitschriften sind im Übrigen an der Universitätsbibliothek Basel archiviert und einsehbar.
Читать дальше