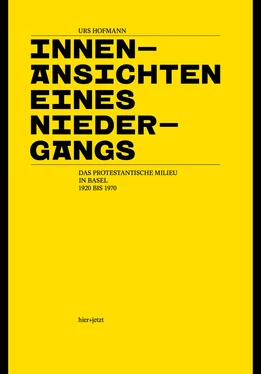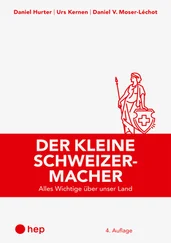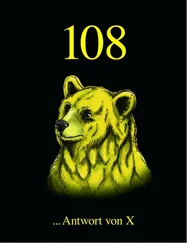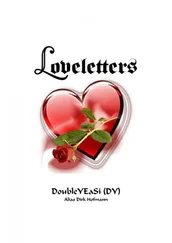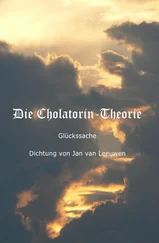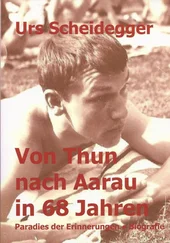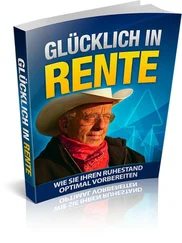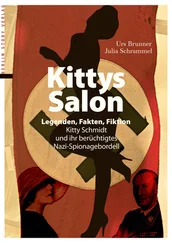Der Nachweis eines protestantischen Milieus im Raum Basel würde vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen nicht überraschen, ist aber nicht das primäre Ziel dieser Forschungsarbeit. Natürlich kann auch die Untersuchung eines Milieus im Niedergang ertragreich sein. Die im Verhältnis zur Erforschung des Vereins- und Milieukatholizismus grossen Defizite in der sozial- und kulturhistorischen Erschliessung der zahlreichen protestantischen Vereine sowie des breiten religiösen Zeitschriften- und Literaturmarktes haben dazu geführt, dass die Debatte über Dechristianisierung und Entkirchlichung einem allzu engen, Institutionen-zentrierten Konzept der Kirche verpflichtet geblieben ist. Hier bietet der Milieuansatz weiterhin eine wichtige und wünschenswerte Alternative.
RELIGION
Wenn Prozesse religiösen Wandels in der Gesellschaft erfasst werden wollen, zum Beispiel mit dem Säkularisierungstheorem, so kann einer Definition von Religion nicht ausgewichen werden. Was man unter Religion versteht, bestimmt, ob und wie stark man die Gesellschaftsverhältnisse als religiös oder säkularisiert wahrnimmt. Das Problem der Bestimmung eines Religionsbegriffs in der religionssoziologischen und religionshistorischen Forschung ist denn auch so alt wie umstritten. Verwendet wird der Begriff ohnehin, auch wenn sich die Stimmen mehren, «die den Versuch, Religion zu definieren, als zum Scheitern verurteilt ansehen und daher von vornherein aufgeben». 54 Karl Gabriel zum Beispiel verzichtet darauf, Religion zu definieren, was es schwierig macht, festzustellen, ob sich Religion oder das religiöse Feld vermindert hat oder nicht. 55 Dabei muss Religion enger gefasst sein, als die funktionalistische Definition von Thomas Luckmann, für den sich das Religiöse bereits «in der Vergesellschaftung des Einzelnen, in der Objektivierung subjektiver Erfahrungen» zeigt. 56 Dieses breite Verständnis von Religion verunmöglicht theoretisch ein Verschwinden von Religion und schliesst deshalb den Vorgang der Säkularisierung per se aus. 57 Eine substanzialistische Auffassung von Religion demgegenüber fragt nicht danach, zu was Religion dient, sondern aus was sie besteht; zum Beispiel aus einem Konglomerat von Einstellungen, Glaubenssätzen und Handlungen, basierend auf der Annahme einer übernatürlichen Kraft. 58 Vertreter des «orthodoxen Säkularisierungsmodells» präzisieren diese Definition, indem sie diesen Glaubenssätzen das Leben und den Alltag der Menschen determinierende Eigenschaften zuschreiben. 59 Der Vorteil liegt hier aber darin, dass die Menge an Religion steigen oder sinken kann. Diese Definition ist stark von einem westlichen Verständnis von Religion geprägt und macht es schwierig, andere, unserem Verständnis nach nichtreligiöse Formen des Übernatürlichen auszuschliessen (ebenso wie der Begriff des «Heiligen» vom Selbstverständnis der verschiedenen Religionsangehörigen abhängig ist). Hier setzt Lucian Hölscher an, der festhält: «Religion ist alles, was man dafür hält.» 60 Seine Definition rückt die Selbstbeschreibung sozialer Gruppen in den Mittelpunkt. Mit seinem Verständnis geht Hölscher zwar einer wissenschaftlich-systematischen Bestimmung über das «Wesen des Religiösen» aus dem Weg, ermöglicht es aber, Wandlungen des «Religiösen» als religionsimmanent zu betrachten, ohne gleich bestimmte Glaubensformen oder Glaubenspraxen von vornherein auszuschliessen. Detlef Pollack schliesslich geht einen elaborierten Mittelweg, indem er funktionalistische und substanzialistische Argumente kombiniert. So gelingt es ihm, den Religionsbegriff weit genug zu spannen, um auch ausserkirchlichen Phänomenen wie Astrologie oder Okkultismus Platz zu geben, andererseits fasst er ihn eng genug, um nichtreligiöse Antworten auf die Sinnfrage auszuschliessen. Seine Argumentationslinie ist die folgende: Religion gibt Antworten auf Sinnprobleme, sie bietet Kontingenzbewältigung an. Kontingenz «provoziert die Frage, warum etwas so ist, wie es ist, und warum es nicht anders ist». 61 Besonders Situationen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit durch Konfrontation mit Armut, Krankheit, Tod oder dem Zerbrechen sozialer Beziehungen rufen in den Menschen Erfahrungen von Kontingenz hervor. 62 Das Kontingenzproblem an sich ist nicht religiös, Kontingenzfragen können zum Beispiel auch durch Psychotherapie gelöst werden. Erst Religion aber bewältigt Kontingenz, indem sie Immanenz und Transparenz unterscheidet. Vereinfacht gesagt, vermittelt Religion zwischen dem Erreichbaren und dem Unerreichbaren, dem Bestimmten und dem Unbestimmten, zwischen Mensch und Gott. «Die typischen religiösen Formen wie Rituale, Gebete, Meditationen, Ikonen, Prozessionen, Predigten oder Heilige Schriften haben die Aufgabe, Zugang zum Transzendenten zu gewähren. Gleichzeitig sind sie jedoch aus der Immanenz genommen.» 63
KIRCHE UND RELIGION
Für Thomas Luckmann steht die Gleichsetzung von Kirche und Religion am Anfang eines positivistischen Verständnisses von Religionssoziologie. Eine institutionelle Deutung der Religion komme dem Verständnis nahe, das die Kirchen im Allgemeinen, ungeachtet aller theologischen Argumente über die sichtbare und unsichtbare Kirche, von sich selbst hätten. 64 Die Unterscheidung von Kirche und Religion ermöglicht erst Luckmanns These, dass die Religion in der modernen Gesellschaft gar nicht an Bedeutung verlieren, sondern nur ihre Form wandeln könne. 65 Diese Unterscheidung zwischen allgemeiner und institutionell spezialisierter Sozialform der Religion ist seither in der Religionssoziologie breit akzeptiert. 66 Es gibt demnach einerseits die kirchengebundene Religiosität, die mit den «Techniken der Institutionenanalyse» 67 erforscht werden kann, daneben existieren aber auch ausserkirchliche Formen von Religion. Wenn im Folgenden von «Religion» die Rede ist, wird darunter die an die reformierte Kirche gebundene Religion verstanden, im Bewusstsein, dass ausserkirchliche Formen von Religion bestehen (und in der vorliegenden Untersuchung auch als solche bezeichnet werden), ob sie nun als «Christentum ausserhalb der Kirche», «unsichtbare Religion», «individuelle Spiritualität» bezeichnet werden oder auch «alternative Religiosität» heissen. 68
SÄKULARISIERUNG, DECHRISTIANISIERUNG, ENTKIRCHLICHUNG
Noch immer ist das Säkularisierungstheorem dasjenige, an dem sämtliche anderen Theorien über Wandlungsprozesse der Religion in der Moderne gemessen werden. So schillernd wie die Geschichte des Begriffs, so umstritten ist heute seine Gültigkeit. Die Debatte darüber vermag Bibliotheken zu füllen, weshalb im Folgenden nicht umfassend auf die Geschichte und Konjunktur dieser Theorie eingegangen wird. 69
In ihrer klassischen Definition geht die Säkularisierungsthese davon aus, «dass Religion und Moderne in einem Spannungsverhältnis stehen und dass in dem Masse, wie sich die Gesellschaft modernisiert, der gesellschaftliche Stellenwert der Religion sinkt». 70 Diesen Kausalzusammenhang von Religion und Moderne bestreiten unter anderem Thomas Luckmann und José Casanova. Letzterer postuliert die Vereinbarkeit von Religion und Moderne, indem er «das Begründungsverhältnis von Religion und Moderne umkehrt», 71 das heisst es geht ihm um die Umkehrung des Säkularisierungsdiskurses: Nicht Säkularität sei eine Bedingung der Modernisierung. Vielmehr habe «die Religion selbst einen [...] Beitrag zur Moderne geleistet». 72 Thomas Luckmann ersetzt die Säkularisierungsthese durch das in der modernen Gesellschaft sich wandelnde Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft. 73 Jedoch ist, wie Knoblauch die These von Luckmann interpretiert, die «individuelle Religion nicht als Gegenbegriff zur Kirchenreligion zu verstehen; sie bezeichnet lediglich die subjektive Ausprägung jeder Form von Weltansicht.» Kirchlichkeit meint dagegen kirchlich gebundene Religiosität, die durch «sozial vorgeformte, institutionalisierte Sprach-, Symbol-, Einstellungs- und Handlungsweisen bedingt, begrenzt und gestaltet sind». 74 Individualisierungsprozesse wirken sich in unterschiedlicher Weise auf die Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit aus: durch Auflösung des Zusammenhangs zwischen religiösen Einstellungen und Praktiken einerseits und Sozialstrukturen andererseits, durch Deinstitutionalisierung des religiösen Lebensverlaufs oder gar durch den Zusammenbruch konfessioneller Milieus. 75 Eine grundlegende Spannung zwischen Religion und Moderne verneint auch die französische Religionssoziologin Danièle Hervieu-Léger; ihrer Ansicht nach kann die Moderne sogar religionsproduktiv wirken. 76 Auch die Autoren und Promotoren des ökonomischen Marktmodells der Religionen, Rodney Stark, William S. Bainbridge, Roger Finke und Laurence R. Iannaccone gehen davon aus, dass Moderne, genauer das moderne Prinzip der Konkurrenz, die religiöse Produktivität stimuliert. 77
Читать дальше