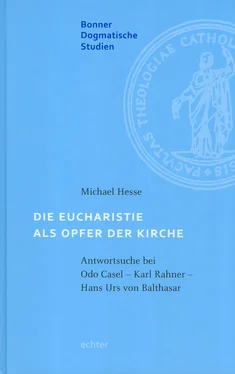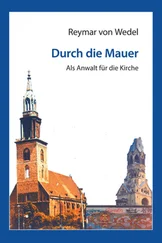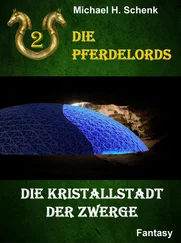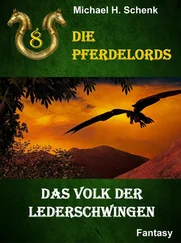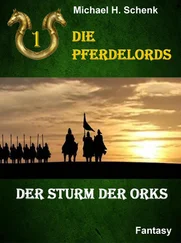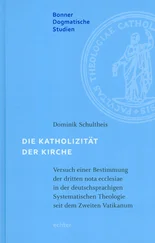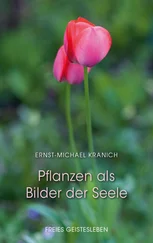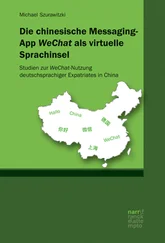Caselsche Theologie versteht sich also als durch Pneuma bewirkte Gnosis. Damit das altkirchliche Theologieverständnis zur Entfaltung kommen kann, muss demnach zwangsläufig ein rational definiertes Erkenntnisstreben zurückgedrängt werden, und damit zugleich der Subjektivismus. Deutlich trägt Schilson vor, dass die Konsequenz dieses Ansatzes die Zurückdrängung des philosophischen Denkens ist, d.h., dass das christliche Mysterium nicht in Worten ausgesagt werden kann, sondern der Theologe erlangt durch die Pneumagabe und die damit verbundene Gnosis ungemein weite Freiheiten. Kritisch ist anzumerken, dass Casel selbst davor warnt, seine Mysterientheologie philosophisch reflektieren zu wollen. Sein Ansatz und damit die Begründung für seine Theologie zentriert sich in der göttlichen Offenbarung, da sie der Grund des Glaubens und damit der Erkenntnis ist. Sie ist keine menschliche Philosophie. Das bedeutet, dass die Gnosis der menschlichen Verfügung entzogen ist, solange der Mensch nicht mit dem göttlichen Pneumas ausgestattet ist. 268
Es fällt auf, dass in Casels Konzeption das jüdische Erbe für das Christentum gar nicht gewertet wird. 269Die Schriften des AT haben in seiner Denkform eine geringe Gewichtung und wenig Bedeutung. Teilweise finden sich negative Aussagen zum alttestamentlichen Kult, da Casel dort nicht die Grundlage für sein Verständnis vom Mysterium findet. Dagegen schätzt er Texte des AT sehr hoch ein, die ihm die Möglichkeit eröffnen, durch allegorische Auslegungsweise Hinweise auf das Christusereignis zu gewinnen. 270
Das jüdische Verständnis zum Begriff „Gedächtnis“ kommt Casels Denken entgegen. „Gedächtnis“ im Judentum meint mehr als eine bloße Erinnerung, und er sieht hier schon eine objektive Gedächtnisfeier gegeben, versteht diese Feier aber aus inhaltlichen und formalen Gründen nicht als Kultgedächtnis im engeren Sinne, wie etwa im Christentum. Kultmysterium im engeren Sinne versteht Casel nämlich als die kultische Vergegenwärtigung des Heilswerkes eines auf Erden erschienenen Gottes. Da er dieses Ereignis jedoch im AT nicht gegeben sieht, gesteht er dem AT nur ein Kultgedächtnis im Sinne einer rituellen Begehung und Gegenwärtigsetzung zu. Letztlich muss man Casels Einschätzung des Judentums als zweigespalten bewerten. 271Die jüdische Religion spielt bei ihm eine untergeordnete Rolle, weil er sie als Episode in der „Heilsveranstaltung“ Gottes sieht. Man kann mit Schilson durchaus von einer Geringschätzung sprechen. Die Antike als solche besitzt laut Casel göttliche Bestätigung, Normativität als einer von Gott bestätigten Kultur, deren kulturelles und geistiges Formelement von der Offenbarung Gottes ins Christentum weitergegeben ist. Somit hat aus geschichtstheologischer bzw. offenbarungstheologischer Erwägung heraus die Antike hier einen Geltungsanspruch errungen, die dem Judentum nicht zugestanden wird. Zur Fundamentierung dieses Anspruchs zitiert Casel quantitativ Kirchenvätertexte, um deren antikes Denken dem heutigen Menschen vorzustellen. 272
Man kann Casel nicht als Exeget der Kirchenvätertexte bezeichnen, wohl aber als guten Kenner dieser Schriften. Zusätzlich zur Patristik zieht er neutestamentliche Schriften, vornehmlich Paulus, besonders den Epheser- und Kolosserbrief, heran. Dabei können wir den Römerbrief (Röm 6,2-11) als einen Drehpunkt der Kontroverse um die Mysterienlehre benennen. Das Problem basiert wiederum auf seiner Methode, zunächst auf philologischen Untersuchungen aufzubauen und erst später folgen theologische Überlegungen. In dieser Vorgehensweise verbirgt sich die Gefahr, dass in die Texte das hineininterpretiert wird, was Casel für seine These brauchbar und nützlich erscheint. 273
Wenn nun Casel der Antike statt den Schriften des Alten Testamentes einen so hohen Stellenwert zuweist, stellt sich für uns hier die Frage nach seinem Geschichtsverständnis im Allgemeinen und seinem Verständnis von Heilsgeschichte im Besonderen.
4.5 Casels Zeitverständnis und Geschichtsdeutung
Geschichte ist in der Caselschen Denkform nur ein Aufscheinen göttlicher Gedanken. Sie wird zum Abbild des ewigen Urbildes, so dass man sagen kann, dass die biblische Heilsgeschichte zugunsten eines platonisch geprägten Geschichts- und Wirklichkeitsverständnis beiseitegelegt wird. Eine positive heilsgeschichtliche Christologie ist so kaum möglich. Dass bedeutet, dass sein Ansatz nicht bei der konkreten Geschichte ansetzt, sondern in der Ewigkeit Gottes. Also versteht er die Geschichte als Verwirklichungsraum der ewigen Ideen Gottes. 274
Dies hat Konsequenzen für die Zeitauffassung Casels, die man in drei Kategorien einteilen kann. Einmal verwendet er einen antiken Zeitbegriff eines Kreislaufs der Zeit, ein Rad des Werdens, das in sich zurückläuft, ein ewig sich drehendes Rad, gleichsam eine „Zeitschlange, die sich in den Schwanz beißt“. Eine weitere Zeitauffassung, die Casel dem Spätmittelalter entlehnt, ist eine sich stets fortsetzende Zeit, ohne Umkehr oder Rückkehr. Schließlich kennt Casel eine dritte Zeitauffassung, die er den Ausführungen von Friedrich Nietzsche entlehnt. Sie definiert er als eine Art ewiger Wiederkehr des Gleichen. Letztlich favorisiert Casel jedoch keine dieser Konzeptionen, sondern er zieht es vor, eine eigene Auffassung von Zeit zu entwickeln, die er auf dem christlichen Glauben gründet. Die Basis bildet das Kirchenjahr, in dem Casel sowohl das Kreisförmige bzw. Wiederkehrende, als auch das sich Entwickelnde vereint sieht. Beide Spielarten bestehen hier in- und miteinander. Es erfolgt gleichzeitig, die Vorbereitung auf die Ewigkeit, ewigkeitsträchtige Zeit durch das Christusmysterium, wodurch wiederum die Geschichte transzendiert wird und sich göttliche Gegenwart ereignet. 275Casels Geschichtsverständnis ist christozentrisch auf das Christusereignis als prägende Mitte ausgerichtet. Geschichte bekommt hier eine soteriologische Dimension verliehen. Diese kommt dem Menschen mysteriologisch nahe, weil das Christusmysterium unter den kultischen Zeichen anwesend ist. Dass bedeutet, dass das historische Christusereignis zusammen mit dem bleibenden Christusmysterium im Kult der Kirche die Mitte und das Ziel der Caselschen Geschichtsauffassung bildet. In Christus begründet und eröffnet sich die Heilsgeschichte. Mit dieser Geschichtsbegründung überschreitet Casel zugleich die Grenze zum Übergeschichtlichen, denn für ihn ist die eschatologische Wirklichkeit nicht nach der Zeit, sondern in der Zeit und Geschichte bereits verborgene Tatsache der Endgültigkeit von Geschichte, die durch die pneumatische Anwesenheit des Christus verbürgt wird. Es gibt also keine Heilsgeschichte ohne das Material von Weltgeschichte. Sehen wir zur Verdeutlichung dieser Caselschen Geschichtsauffassung auf das konkrete Verständnis der Auferstehung Christi. Die Auferstehung Jesu Christi sprengt als pure Heilsgeschichte den Rahmen von Zeit und Geschichte und wird zum Wendepunkt von Weltgeschichte. Das Erscheinen Christi ist das entscheidende Faktum in Zeit und Geschichte. Die Anwesenheit Christi ist für Casel das Ineinanderfallen von Geschichte und Eschatologie. Durch den Ursprung aller geschichtlichen Ereignisse im ewigen Heilsplan Gottes in Christus wird zugleich die Möglichkeit eröffnet, dass jede Zeit dem Eschaton gleich nahe bzw. fern ist. 276Auf dieser Grundlage wird verständlich, dass Casel zwei Formen von Feiern der Heilstat Jesu unterscheidet: Die historische und die metaphysisch-pneumatische Form. Erstere betrachtet die Heilsereignisse in ihrem geschichtlichen Ablauf von der menschlichen Perspektive her, die zweite Form fokussiert die Gesamtheit der Heilsgeschichte in einen Blickpunkt wie in einer Synopse. Diese Betrachtungsweise findet er im biblischen Bereich bei Paulus und Johannes. So baut er seine pneumatologische Grundlegung der zusammenfassenden Schau der Heilsgeschichte in der Mysterientheologie auch auf Paulus auf. 277Wie lässt sich nun Casels Theologieentwurf ansatzweise definieren. Versuchen wir dies im nächsten Schritt zu beantworten, um es uns für unser Thema klar zu machen, mit welcher Intention Casel seine Mysterientheologie entwickelt.
Читать дальше