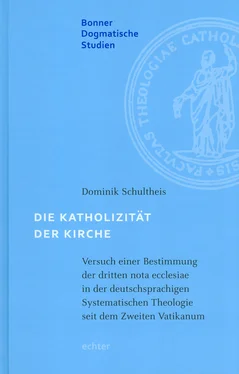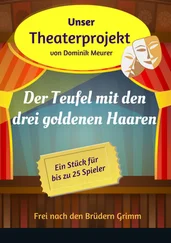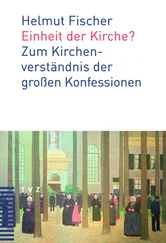3.2Bedeutungserweiterung im dritten und vierten Jahrhundert
Ein zum Erweis der Orthodoxie unterscheidendes Kriterium mischt sich ab der Mitte des dritten Jahrhunderts in die Bedeutungsvielfalt des Terminus „katholisch“, wenn etwa Cyprian mit Nachdruck die aktuelle Präsenz des Ursprungs in jeder Kirche mit diesem Begriff zum Ausdruck bringt. 40Auch bei Hippolyt, Tertullian, Clemens von Alexandrien und Enkratios von Thenis 41meint „katholisch“ fortan immer auch die „wahre“, „echte“, „einzigartige“, „authentische“ Kirche des Ursprungs in Absetzung von häretischen und schismatischen Kreisen, die sich von der immer größer werdenden Großkirche absondern. Das Adjektiv „katholisch“ gereicht somit zum Synonym für „rechtgläubig“, „exklusiv“ und „einzig“. 42Diese offenbarungstheologische – mehr polemische – Bedeutung ergänzt die geographische, anthropologische, soteriologische und christologische und wird fortan zum festen Bestandteil der Katholizität.
In den Katechesen des Cyrill von Jerusalem (gest. 386 o. 387 n.Chr.) findet man einen beeindruckenden Beleg dafür, wie vielschichtig der Begriff „katholisch“ verstanden und wie diese Vielschichtigkeit vornehmlich qualitativ begründet wurde: 43
„Die Kirche heißt katholisch, weil sie auf dem ganzen Erdkreis, von dem einen Ende bis zum anderen, ausgebreitet ist, weil sie allgemein und ohne Unterlass all das lehrt, was der Mensch von dem Sichtbaren und Unsichtbaren, von dem Himmlischen und Irdischen wissen muss, weil sie das ganze Menschengeschlecht, Herrscher und Untertanen, Gebildete und Ungebildete, zur Gottesverehrung führt, weil sie allgemein jede Art von Sünden, die mit der Seele und dem Leibe begangen werden, behandelt und heilt, endlich weil sie in sich jede Art von Tugend, die es gibt, besitzt, mag sich dieselbe in Werken oder Worten oder in irgendwelchen Gnadengaben offenbaren“ 44.
Cyrill lässt die offenbarungstheologische Dimension der Katholizität deutlich erkennen, wenn er in seinen Katechesen weiter schreibt: „Mit Grund könnte also jemand behaupten: die Versammlung der ruchlosen Häretiker, der Marcioniten und Manichäer usw. sind tatsächlich auch eine Kirche. Deshalb versichert dir nun das Glaubensbekenntnis: ‚und an eine heilige, katholische Kirche‘. Die hässlichen Versammlungen der Häretiker sollst du nämlich meiden, der heiligen, katholischen Kirche aber, in der du wiedergeboren wurdest, stets treu anhangen!“ 45
In der Folgezeit findet der Begriff „katholisch“ Niederschlag in den Symbola (erstmals im Papyrus von Dêr-Balyzeh) und erhält durch die Aufnahme ins Nicänum (325 n. Chr.) und Apostolicum (381 n. Chr.) dogmatische Dignität. 46Fortan werden von der Kirche vier Grundeigenschaften (notae ecclesiae) als Erkennungszeichen der wahren Kirche Jesu Christi verbindlich ausgesagt: „Wir glauben die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ (DH 150 47). 48
3.3Weiterentwicklung bei Augustinus
Eine Weiterentwicklung erfährt der Begriff in der Auseinandersetzung mit den Donatisten. Diese sprechen der Katholizität das Kriterium einer weltweiten Verbreitung ab und blenden zugunsten einer betont qualitativen (sakramentalen) Sicht deren geographische Dimension aus. Ihrer Ansicht nach ist nur diejenige Kirche „katholisch“, die die Fülle der Sakramente und die Reinheit des apostolischen Ursprungs bewahrt habe. Auch da – besser: nur da – sei Kirche „katholisch“, wo sie, selbst wenn nur lokal ansässig, ihre Reinheit und Heiligkeit betone sowie daraus ableitend die persönliche Heiligkeit des Sakramentenspenders rigoristisch vertrete. Dies sei aber – so die Meinung der Donatisten – lediglich in der Kirche Afrikas gewährleistet, folglich dessen nur sie „wahre“ Kirche Jesu Christi genannt werden könne. 49
Augustinus (354–430 n. Chr.) akzentuiert in Abwehr dieser separatistischen Gruppe und ihres betont qualitativen (sakramentalen) Katholizitäts-Verständnisses das quantitative (geographische) Moment der Katholizität. 50Das Pfingstereignis habe bereits der nachösterlichen Kirche eine Sendung für die ganze Welt erwiesen; 51daher bedeute Katholischsein zuallererst „communicare orbi terrarum“ 52, „Mit-allen-auf-dem-ganzen-Erdkreis-in-Einheit-verbunden-sein“. 53 Rechtgläubige Kirche ist in den Augen Augustins nur die universale Gemeinschaft der „Catholica“. Nur diese ist – im Unterschied zu den Donatisten und anderen häretischen Gruppen, welche nur an vereinzelten Orten vertreten sind –, mit ihrer Heils- und Lehrfülle überall und an allen Orten , über den ganzen Erdkreis verbreitet und darüber hinaus geeint . 54Katholizität kommt dabei sowohl der Universalkirche als auch den Ortskirchen zu. 55
Will man Augustinus an dieser Stelle ein rein quantitatives Verständnis der Katholizität unterstellen, greift eine solche Interpretation sicher zu kurz. 56Wenn er in der Auseinandersetzung mit den Donatisten zweifelsohne die geographische Dimension der Katholizität besonders hervorhebt – was in der Folge, vor allem in der Abwehr weiterer häretischer Gruppen, nicht ohne Wirkung bleibt – so ist ihm an einer qualitativen Bestimmung der Katholizität durchaus gelegen. So betont Augustinus etwa die Einheit der Kirche, die er als Bedingung der Möglichkeit ihrer Heilsvollkommenheit versteht. 57Diese Einheit werde durch das Band der Liebe gewährleistet, die in der Trinität, näherhin im Verhältnis zwischen Gott Vater und Jesus Christus, ihren Ursprung habe und in der Feier der Eucharistie je neu verwirklicht werde. 58Gegen diese Liebe aber – und hierin zielt seine qualitative Argumentation gegen die afrikanische Kirche – sieht Augustinus die Donatisten sich versündigen, beabsichtigten diese doch, die Liebe allein auf die Grenzen Afrikas zu beschränken. Gottes Liebe aber, so der Bischof von Hippo, sei ohne Schranken, folglich dessen die Donatisten aus der Liebe herausfielen und nicht katholisch seien. 59
3.4Akzentuierung bei Vinzenz von Lérins
In der Folge betont Vinzenz von Lérins (gest. um 435 n. Chr.) stärker die auch schon bei Augustinus anklingende zeitlich ausgeweitete anthropologische Dimension der Katholizität und unterstreicht damit zugleich den offenbarungstheologischen Aspekt der Katholizität. Ihm geht es um eine – noch nicht institutionell gedachte – normative Instanz, welche Synkretismen sowie Häresien vermeiden hilft. 60Bei ihm werden „universitas“, „antiquitas“ und „consensio“ wesentliche Hauptbestandteile der Katholizität. Er sieht die universal verbreitete Catholica deshalb als rechtgläubig an, weil sie in Kontinuität (traditio) zu dem steht, was immer schon zu allen Zeiten überall allgemein gelehrt und von allen geglaubt wird. 61Damit hebt er die Katholizität als ein kontinuierliches, unveränderliches und notwendiges Wesensmerkmal (nota ecclesiae) der Kirche heraus; 62die Katholizität wird durch den Kontinuitätsgedanken als Identität interpretierbar. 63
3.5Verwendung in der mittelalterlichen Theologie
Die von Augustinus und Vinzenz von Lérins betonte geographische und offenbarungstheologische Dimension der Katholizität wird für das Mittelalter bestimmend. 64Damit geht ein neues Kirchenverständnis einher, dem von Papst Leo dem Großen (440–461 n.Chr.) der Weg geebnet wird und die römische Kirche neben den anderen sich herausbildenden Patriarchaten zunehmend zu einer ordnenden Leitungsgewalt werden lässt. Leo baut nicht nur die Idee der Petrus-Nachfolge des römischen Bischofs weiter aus, dem fortan der Titel „Papst“ zukommt, sondern er verbindet die Idee der Petrusnachfolge mit der Leitungsvollmacht über die ganze Kirche: Der Bischof von Rom erhält neben Synode und Konzil Anteil an der Legislative der universalen (katholischen) Kirche. 65
Читать дальше