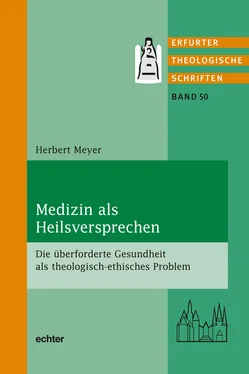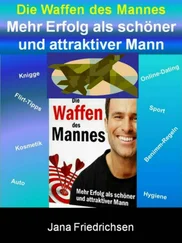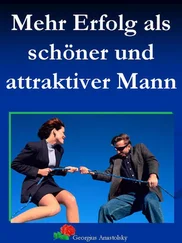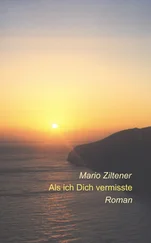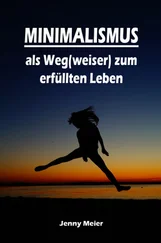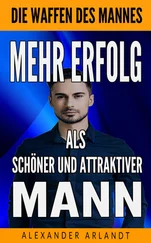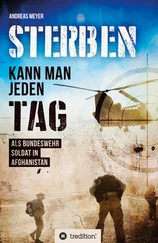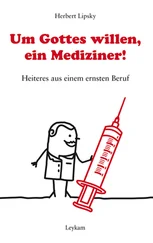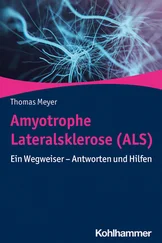In einem dritten Teil werden die erfragten Erwartungen in ihrer theologischen Qualität mithilfe einer Analyse neutestamentlicher Heilungserzählungen abgesichert. Die biblischen Heilungsgeschichten zeigen eine Dynamik, welche von konkreten Erwartungen der Hilfesuchenden an Jesus und seine Jünger zur „tieferen“ Ebene gläubiger Hoffnung führt. Diese Dynamik lässt sich – im Sprachgewand heutiger Religionssoziologie – als Erfahrung großer Transzendenz durch die Vermittlung kleiner Transzendenz verstehen: Neben der Hoffnung auf ganz konkrete physische Gesundung steht damit – ja auch noch einmal neben der Frage nach zunächst psychischer Integrität (Unterstützung, Führung, Rat, Orientierung) – eine Ebene ganzheitlicher Erfüllung, Befriedigung, Geborgenheit und Integrität infrage (Trost, Hoffnung, innerer Friede), die über die konkrete diesseitige Erfahrung irgendwie hinausführt und deshalb in die Dimensionen „großer Transzendenz“ verweist.
Lässt sich in der empirischen Untersuchung der Erwartungen von Menschen an Medizin und religiösem Glauben zeigen, dass diese theologische Zuordnung zwischen dem Verlangen nach Heilung körperlicher und psychischer Gebrochenheit und der Sehnsucht nach einer letzten Geborgenheit und Vollkommenheit bei Gott (dem Heil) als innerem Verweiszusammenhang verloren gegangen ist? Anders gefragt: Ist die große Transzendenz der Hoffnung auf Gott durch das bloße Heilungsbegehren ohne tieferen Blick auf eine letzte Geborgenheit des Lebens verdrängt worden?
Es wird sich im vierten und fünften Teil dieser Untersuchung zeigen, dass jede vereinfachende und undifferenzierte Behauptung von Ersatzmechanismen der Komplexität des Verhältnisses zwischen Glaube und Medizin heute nicht gerecht werden kann. Die konkreten Ergebnisse der empirischen Untersuchung gegenwärtiger Erwartungsstruktur werden demgegenüber vielmehr ausführlich im Blick auf verschiedene Bedeutungsfelder hin ausgewertet. So soll am Ende die kritische theologisch-ethische Analyse der Erwartungsstruktur an Medizin und Glaube stehen, wie sie für die Gegenwart von Relevanz ist.
Die vorliegende Untersuchung lässt sich dabei in ihrer theologischen Perspektive von dem beschriebenen Vorverständnis im Sinne der angedeuteten Konturen leiten und versucht sie kritisch zu bewerten. Vereinfacht ausgedrückt: Die unübersehbare Sehnsucht und Suche der Menschen sowohl nach „Heilung und Gesundheit“ als auch nach „Glückseligkeit und Heil“ zeichnen den Menschen als transzendentes Wesen aus, das immer über sich selbst hinaus verweist. Der Mensch will gesund sein und ein heilvolles Leben er-leben. Er sehnt sich zeit seines Lebens immer nach einer umfassenden Absicherung der „Integrität“ seines Lebens. In Zeiten der Krankheit sehnt sich der Mensch nach Heilung und Gesundheit. In Zeiten der Gesundheit sehnt er sich danach, diese zu erhalten und ist auf der Suche, diese Sehnsucht zu stillen. In den noch so glückseligen Momenten seines körperlichen und seelischen Wohlbefindens möchte er diese festhalten und weiß doch, dass dies unmöglich ist, da sein Leben ständigem Wandel unterworfen ist. Und so ist sein Leben selbst in diesen Momenten von einer Sehnsucht gezeichnet, die er immer wieder neu zu erfüllen sucht.
Um die Dynamik, die Umschichtungen und „Bewegungen“ in den Erwartungen von heute an Gesundheit und Glaube im Sinne der Beziehung zwischen „kleiner“ (körperliche Gesundheit) und „großer“ (Sehnsucht nach innerem Frieden und Heil) Transzendenz angemessen in den Blick zu bekommen sowie differenziert beschreiben zu können, muss die dahinterstehende Struktur der Erwartung an Medizin und Glaube im Blick auf die Formen und Orte verstanden werden, in denen Gesundheit und Heil zum Gegenstand der Hoffnung wird. Aber darüber hinaus muss verstanden werden, wer der Adressat dieser Erwartungen und ihrer Intentionen eigentlich ist. Ja, in einem letzten Schritt stellt sich auch die Frage danach, auf welche Weise und in welchen Lebensbezügen die Erfüllung der Suche nach Heilung und Heil im Sinne der ganzheitlichen Dimensionen (somatisch und emotional) erfahren wird. Darüber hinaus ist der „Umgang“ mit der Verweigerung dieser Erfüllung zu erheben. Das heißt, es geht um die Erforschung, inwieweit Menschen selbst diese Erfüllung als Möglichkeit oder Unmöglichkeit erleben, welche Instanzen ihnen diese Erfüllung nach ihrer Erfahrung zu erschließen vermögen und welche nicht, worin dieses Erleben eigentlich besteht und ob es in einer unreduzierbaren Pluralität (sinnlich, emotional, spirituell, je nach Präferenz des Einzelnen) oder signifikanten Einzigartigkeit bestimmter ausgezeichneter „universaler“ Konstanz (anthropologischer „Wesensbestimmung“?) erfahren wird.
Die Richtungen der Analyse lassen sich in diesem Sinne in folgenden Fragen zum Ausdruck bringen:
Wie und wo sucht der heutige Mensch diese Erfüllung (Heilung und Heil) für Leib und Seele? – Wie und wo nicht?
Von wem erhofft er diese Erfüllung (Heilung und Heil) für Leib und Seele? – Von wem nicht?
Wie und wo findet er diese Erfüllung (Heilung und Heil) für Leib und Seele? – Wie und wo nicht?
Worin besteht für den Menschen diese Erfüllung (Heilung und Heil) eigentlich? – Worin nicht?
Gibt es nur eine Erfüllung für Leib und Seele oder kann diese in den Vorstellungen der Befragten durchaus unterschiedlich aussehen?
So kann das Ziel der Untersuchung mit der Frage zusammengefasst werden: Mit welchen unterschiedlichen Erwartungen und an wen wenden sich Menschen in ihrer Sehnsucht nach Heilung und Heil, um Erfüllung für ihr Leben an Leib und Seele zu finden?
Diese Frage ist aus dem Blick theologischer Ethik entscheidend, um sowohl für die suchenden und erwartungsvollen Menschen als auch für die, die bei der Erfüllung von Erwartungen helfen sollen, das Zueinander zwischen Medizin und Glaube heute angemessen reflektieren zu können. Hier liegt das eigentliche Ziel der Untersuchung, auch wenn sie im Sinne einer Grundlagenforschung nur die Analyse der Differenz und Konvergenz von Medizin und Glaube leisten kann, ohne konkrete Konsequenzen für die Gestaltung von medizinischer oder auch kirchlicher Praxis im Einzelnen beleuchten zu können. Aber es ist die Arbeit an der konkreten Erfahrung der Spannung zwischen medizinischer und religiöser Kultur heute, welche aus dem Blickwinkel der Moraltheologie die Voraussetzung für ethisch verantwortbare Praxis in beiden Feldern darstellt.
1.3. Das Verhältnis von Medizin und Glaube – Forschungsbericht
Sowohl die medizinische als auch die theologische Wissenschaft sind sich heute darin einig, dass der Mensch nur als Leib-Seele-Einheit zu begreifen ist, das heißt, es gibt ihn nur als leibhaftige Seele bzw. als beseelten Leib. Aus diesem Wissen, besser aber noch aus dieser Erfahrung leitet sich der Zusammenhang vom körperlichen und seelischen Wohl bzw. Leiden des Menschen ab. Aus diesem Zusammenhang wiederum ergeben sich Erwartungen der Menschen an Medizin und Glaube. Diese Erwartungen bestimmen das Verhältnis von Medizin und Theologie. Mit welchen konkreten Erwartungen sich Menschen heute aber speziell an die Medizin bzw. die kirchliche Seelsorge wenden, ist im deutschsprachigen Raum, so haben Recherchen im Rahmen dieser Arbeit ergeben, derzeit noch nicht hinreichend erforscht. Ansätze, dem körperlichen und seelischen Wohl des Menschen zu dienen, werden einerseits auf medizinischem und andererseits auf theologischem Feld reflektiert. Für das Miteinander von medizinischer Praxis und dem Vollzug religiöser Wirklichkeitsbewältigung im Umgang mit Gesundheit und Krankheit werden in der Literatur Konzepte beschrieben, welche das komplementäre Verhältnis von Medizin und Theologie einzufangen versuchen.
Der Theologe Eugen Biser spricht von einer „therapeutischen Theologie“, die keine theologische Spezialform neben anderen ist, „sondern die Form, in welcher die theologische Sache heute allein verhandelt werden kann“ 16. Für Biser entwickelte sich eine Entzweiung von Theologie und Medizin bereits in den Evangelien, in denen die Heilungsgeschichten anfänglich noch durchweg Glaubensgeschichten sind, mehr und mehr aber zum Argument für Jesu göttliche Vollmacht werden. Darin sieht Biser den Beginn der argumentativen und spekulativen Verarbeitung der Botschaft Jesu, aus der die wissenschaftliche Theologie hervorging, in deren weiterem Verlauf sich der therapeutische Bereich abspaltete: für Biser der Preis für die Ausgestaltung des Wissenschaftscharakters der Theologie. 17Je abstrakter die so entstandene Systemtheologie wurde, umso mehr verlor sie nach Biser die Sprachfähigkeit, die sie zur Heilszusage befähigte. 18
Читать дальше