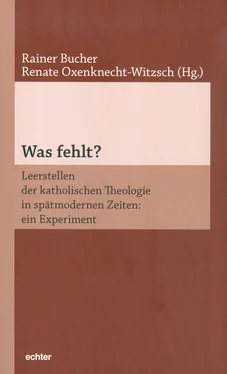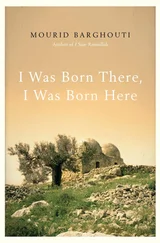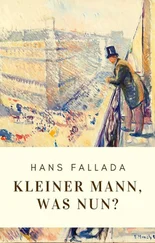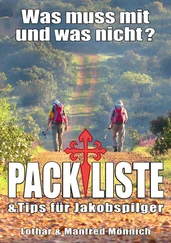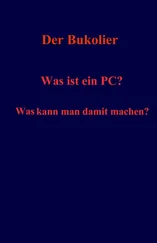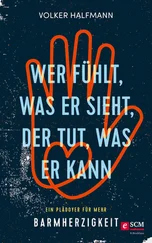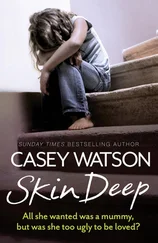Nun ist offenkundig, dass die Frage nach Leerstellen einen Horizont voraussetzt, innerhalb dessen sie erkennbar werden. Es geht darum, wie man sich Theologie auch vorstellen könnte, darum, über das gegebene Design der Theologie hinaus zu denken und jenen „Möglichkeitsraum“ zu öffnen, der sich nicht an dem orientiert, was ist und nahe liegt, sondern an dem, was sein könnte und begründet sein sollte. Solche Erwartungshorizonte können entweder zu eng sein, dann wiederholen sie wohlfeile Wünschbarkeiten, oder zu weit, dann zeichnen sie Kreise, die von niemandem zu durchschreiten sind.
Dazwischen sollte das Symposium angesiedelt sein. Es ging um Beiträge und Statements, in denen essayistisch, experimentell, gewagt ausgelotet wird, was der katholischen Theologie in unseren Breiten gegenwärtig bezogen auf ihren Gegenstand und bezogen auf ihre grundlegende Aufgabe im Volk Gottes fehlt. Die vorliegenden Beiträge spiegeln in Thematik und Genus diese Bandbreite wider.
Es war eine der guten Erfahrungen des Symposiums, dass es gelang, die inhaltlich wie stilistisch bisweilen provokativen Antworten bei ihren Stärken zu nehmen: deren grundlegende war, tatsächlich etwas aufzubrechen und hervorzurufen. Dafür sei nicht nur den Referentinnen und Referenten, sondern auch allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Symposiums herzlich gedankt.
Ein wissenschaftliches Symposium zum Thema „Was fehlt? – Leerstellen der Theologie in spätmodernen Zeiten“ zu Ehren von Prof. Dr. em. Alexius J. Bucher in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie der Universität Graz, dem Institut zur interdisziplinären und interkulturellen Erforschung von Phänomenen sozialer Exklusion (ISIS) und der Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt bildete einen guten Rahmen, Leerstellen der Theologie nicht nur aus der Sicht der Theologie, sondern im interdisziplinären Diskurs zu suchen und zu erfragen.
Die Kooperation gilt vor allem dem geehrten Alexius J. Bucher. Das Seminar „Armut-Ethik-Befreiung“, das im Rahmen des von Raúl Fornet-Betancourt begründeten Philosophischen Dialogprogramms im April 1995 stattfand, war der Startpunkt einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Fakultät für Soziale Arbeit und dem Geehrten. In seinem damaligen Beitrag „Kirche fordert Armut – Armut fordert Kirche“ thematisierte er die weltweite Armut als Herausforderung für die Kirche, eine heute noch aktuellere Herausforderung.
Diese Zusammenarbeit setzte sich im Rahmen des 1998 gegründeten Instituts ISIS, zunächst unter der Vorstandschaft von Prof. Dr. Horst Sing (Fakultät für Soziale Arbeit) und Alexius J. Bucher und inzwischen unter der Vorstandschaft von Prof. Dr. Dr. Raúl Fornet-Betancourt und Dr. Monika Pfaller-Rott (Fakultät für Soziale Arbeit) in weiteren Tagungen fort.
Für die Zusammenarbeit mit ISIS und die Unterstützung des Symposiums danken wir Raúl Fornet-Betancourt sehr, der nicht nur dem Geehrten, sondern auch der Fakultät für Soziale Arbeit seit über dreißig Jahren in Lehre und Forschung durch zahlreiche Tagungen und Veröffentlichungen verbunden ist.
Die Herausgeber danken sehr herzlich zudem Herrn Dipl. Theol. Patrick Kummer MA, Eichstätt, der mit großer Sorgfalt die redaktionelle Arbeit besorgte und eine verlagsgerechte Druckvorlage erstellte. Frau Ingrid Hable MA, Graz, las Korrektur, auch hierfür unseren besten Dank.
Eichstätt/Graz, im Juni 2015
| Renate Oxenknecht-Witzsch |
Rainer Bucher |
Anfragen von außen
Zum Nachdenken über die Frage: „Was fehlt?“
Raúl Fornet-Betancourt, Aachen/Bremen
„Was fehlt?“ Leerstellen der Theologie in spätmodernen Zeiten, so lautet der Titel des Symposiums, das zu Ehren von Alexius J. Bucher abgehalten wird.
Zur Frage und Aufgabe dieses wissenschaftlichen Austausches aus festlichem Anlass geben die Organisatoren in der „Einführung“ zum Programm folgende erklärende Hinweise: „Es fällt nicht leicht, in den Rücken der eigenen Arbeit zu gelangen und blinde Flecken des eigenen Tuns zu identifizieren. Aber mehr und mehr drängen sich Fragen und Problemkreise auf, die ahnen lassen, dass und wo Theologie hinter dem zurückbleibt, was sie angesichts ihrer Verpflichtung gegenüber Tradition und Gegenwart leisten könnte und sollte. So verwirrend plural Tradition und Gegenwart erscheinen mögen: Das Symposion will diese Zonen eines theologischen Defizits erkunden und sich ebenso vorsichtig wie mutig den momentanen Leerstellen der wissenschaftlichen Theologie annähern. Die Philosophie ist hierfür der Theologie seit langem eine bewährte Gesprächspartnerin. Dieses Symposion geht davon aus, dass auch in spätmodernen Zeiten Theologie mehr denn je auf eine Philosophie verwiesen bleibt, die ‚an der Zeit ist‘“ 1.
Dieser Text, so meine ich, bringt die Aufgabe des Symposiums deutlich und genau auf den Punkt. Zu meiner eigenen Vergewisserung darf ich sie kurz zusammenfassen: Vor dem Hintergrund neuer Fragen und Probleme handelt es sich um den Versuch der Identifizierung von blinden Flecken, um die Erkundung möglicher „Leerstellen“ der heutigen wissenschaftlichen Theologie. Diese Aufgabe soll zugleich, wie der zitierte Titel des Symposiums nahezulegen scheint, als der Versuch verstanden werden, Antworten auf eben die Frage, „was heutiger Theologie fehlt“ zu wagen oder zumindest Perspektiven für die Suche nach Auswegen vorzubereiten.
Aber der Text benennt nicht nur die Aufgabe und die Bedeutung, die ihre Erörterung für die Zukunft der Theologie hat. Eine aufmerksame Lektüre zeigt zudem, dass der Einführungstext noch einen methodischen Hinweis für die Behandlung der gestellten Aufgabe gibt, indem er auf die Philosophie als „bewährte Gesprächspartnerin“ der Theologie setzt. Mit der kulturgeschichtlichen Bemerkung über die „spätmodernen Zeiten“ gibt der Text darüber hinaus noch einen kontextuellen Hinweis zum Verständnis der geistigen und geschichtlichen Situation, in deren Rahmen die Aufgabe zu sehen ist.
Die Formulierung der Aufgabe, die Hinweise zu deren Behandlung sowie die damit verbundenen Erwartungsperspektiven lassen zudem aber ebenfalls erkennen, dass der Einführungstext philosophische und theologische Voraussetzungen impliziert, die sich meines Erachtens sowohl für eine tiefere Einsicht in den Sinn der Frage als auch für eine breitere Suche nach Potenzialen noch möglicher Orientierung als nachteilig erweisen können, und zwar deshalb, weil sie, wie es mir erscheinen will, eurozentrisch sind.
Mir ist allerdings bewusst, dass auf den ersten Blick dieser Vorwurf unvermittelt, ja völlig deplaziert erscheinen mag. Mit dieser Veranstaltung halten wir doch ein „deutschsprachiges“ Symposium ab, das sich zur Aufgabe gemacht hat, über die Situation der Theologie im gegenwärtigen Kontext einer (europäischen) „spätmodernen“ Gesellschaft nachzudenken. Und dennoch soll hier der Eurozentrismusvorwurf für keine billige Polemik stehen. Mein Motiv dafür ist vielmehr die begründete Überzeugung, dass das Fragen christlicher Theologie, zumal wenn sie sich als katholisch bekennt, kontextuell sein soll, nicht aber regional bzw. provinziell sein darf.
Fragen katholischer Theologie sollten ja den weltgeschichtlichen, offenen Horizont der Katholizität , zu der die „ Ecclesia “ christlichen Glaubens berufen ist und beruft, niemals aus den Augen verlieren. Mehr noch: Katholizität , hier verstanden als qualitative kommunikative Bewegung auf Universalität hin, muss Element und Medium ihres Fragens sein. Zwar: Schon aufgrund des „Sitz im Leben“-Prinzips, das für die Lebendigkeit und Authentizität der katholischen Theologie allgemein als notwendig anerkannt wird, sollte diese bei der Auseinandersetzung mit Fragen vom kontextuellen Zusammenhang ausgehen, dabei aber die kontextuelle Auseinandersetzung gleichzeitig im Bewusstsein davon führen, dass sie aus Tradition in der Denken und Handeln normierenden Verpflichtung der Katholizität steht. Und das bedeutet eben: Katholische Theologie hat kontextuelle Theologie zu sein, wohl aber im Bewusstsein davon, dass sie immer schon Theologie einer zur Katholizität berufenen und berufenden Gemeinschaft ist.
Читать дальше