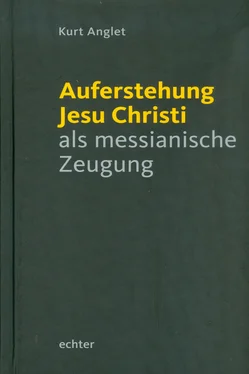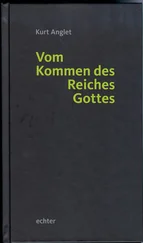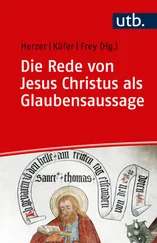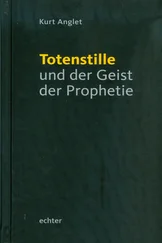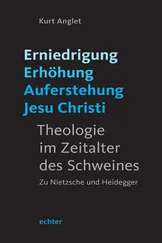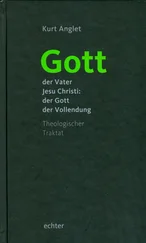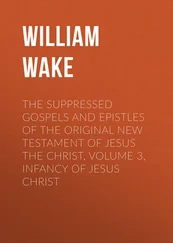Der Mensch der Vermessenheit aber deckt sich mit dem Menschentypus der anomía , der Gesetzwidrigkeit, dessen Erscheinung nach dem Apostel Paulus dem Tag des Herrn vorausgeht. Daher seine Mahnung an die Thessalonicher: »Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt« (2 Thess 2,3 f.). Nun hat sich Heidegger nicht gleich in den Tempel Gottes gesetzt, obschon er in den Beiträge(n) zur Philosophie sich seinen »letzten Gott« geschaffen hat. Gleichwohl scheute er auch in der Stunde des Abfalls nicht den Gedanken an eine Ehrung im »Heiligtum«: »Der Antichrist aus der Verzweiflung des Denkens, das, wahrhaft denkend, gegen das Denken zu denken vermag, ist ›christlicher‹, wenn Christlichkeit schon sein konnte, als die Meute der klerikalen Theologen, die nicht einmal wissen, daß sogar noch das Gerüst ihrer abgestandenen Theologie auf einer erborgten und fremden, nämlich der platonisch-aristotelischen Philosophie beruht, die zum Überfluß durch Thomas bereits in ihrer römischen Umdeutung angeeignet wurde. Was wird dann wohl ›eine Akademie des heiligen Thomas‹ in Rom über ein Denken ausmachen können, das einmal wagte, das Seyn selber erst als Denkwürdigkeit zu zeigen?« (GA 97, 193). Kaum ein Satz, der nicht die Sprache der Anmaßung spricht, als wäre nicht längst in der Dogmengeschichte über jenes »Gerüst« der platonisch-aristotelischen Philosophie geforscht worden. Denn Heidegger denkt wahrhaft »gegen das Denken«, nämlich gegen das Vernunftdenken der griechischen Philosophie, von dem her die meisten Kirchenväter her das Wort der biblischen Offenbarung zu deuten suchten. Denn bei der biblischen Überlieferung handelt es sich in erster Linie um eine Bildersprache, reich an Symbolen, Allegorien und Typologien – allein Gott erscheint ohne Bild, da alle menschliche Vorstellung transzendierend. Dagegen basiert das Denken der griechischen Philosophie auf dem Begriff, auf dem Versuch einer umfassenden Weltdeutung. Und hier ergeben sich bei der Rezeption der Schriften des Alten wie des Neuen Testaments grundlegende Probleme: angefangen bei der Schöpfungstheologie, der creatio ex nihilo , der Schöpfung aus dem Nichts, da das griechische Denken von einem ewigen Kreislauf ausgeht; über die Christologie, da das griechische Denken keinen Begriff für die Gleichzeitigkeit der menschlichen und der göttlichen Natur in Christus kennt, so dass selbst bei Leo dem Großen, dem Schirmherr über das Konzil von Chalcedon (451), die Verbindung der beiden Naturen in Christus ihrer Struktur nach wie die Doppelhelix der menschlichen Erbanlagen wirkt, obwohl nach Joh 1,14 das Wort, der göttliche Logos Fleisch geworden ist; schließlich die Eschatologie, die Rede vom Ende der Zeit, die aufgrund des neuplatonischen Dualismus von Zeit und Ewigkeit selbst für einen genau differenzierenden Denker wie Augustinus nur schwer begrifflich zu fassen ist, insofern kairos , der Begriff der messianischen bzw. eschatologischen Zeit, nicht von chronos , dem innergeschichtlichen Zeitgeschehen, unterschieden werden kann. Von all diesen Problemen nimmt Heidegger keinerlei Notiz, zumal sein Zeitbegriff über die bloße »Geschichtlichkeit« des chronos nicht hinausführt, im Grunde auch keine Eschatologie kennt, da seine »Eschatologie des Seyns« dem Zustand der sog. Seinsverlassenheit entspricht. Daher der Mangel an Symbolkraft seiner Sprache, den Heidegger dadurch zu kompensieren trachtet, dass er die einzelnen Worte wie eine Zitrone auspresst, um ihnen eine Bedeutung abzugewinnen. Während noch die Beiträge zur Philosophie auf den Begriffscharakter der philosophischen Sprache verweisen – und in der Tat wirkt die Argumentation in seinen früheren Arbeiten trotz eines spezifischen Jargons und einiger Wortungetüme durchaus luzide –, tritt mit dem vierten Band der Schwarzen Hefte eine Art babylonische Sprachverwirrung ein: Wortbildungen, deren Sinn kaum noch nachvollziehbar ist; eher Beschwörungen von Worten, die dem offenkundig Sinnlosen Sinn verleihen sollen; kein philosophisches Denken als vielmehr eine sich philosophisch gerierende Esoterik, die Heideggers Seinsdenken als das enthüllt, was es von Anbeginn war: als Kult einer Pseudoreligion.
Mag Heidegger auch, wie abschließend zu zeigen sein wird, den Antichristen mit der »Judenschaft« identifizieren, so manifestiert sich in keinem anderen Denken – selbst in Nietzsches Konzeption des Übermenschen nicht – so treffend das antichristliche Unwesen der Selbstzerstörung. »Der Anti-christ muß wie jedes Anti- aus dem selben Wesensgrund stammen wie das, wogegen es anti-ist – also wie ›der Christ‹. Dieser stammt aus der Judenschaft. Diese ist im Zeitraum des christlichen Abendlandes, d. h. der Metaphysik, das Prinzip der Zerstörung« (GA 97,20). Doch Heidegger täuscht sich, nicht allein hier, in den Anmerkungen I seiner Schwarzen Hefte 1942–1948 , also zu einer Zeit, als die Vernichtungsaktionen gegen das jüdische Volk auf Hochtouren anliefen. Denn nicht nur für die Zeit des heiligen Johannes gilt, dass die Antichristen aus unserer Mitte gekommen sind (vgl. 1 Joh 2,19), mehr noch für unser Zeitalter, das den Massenmord auf seine Fahnen geschrieben hat; für das – mit Heideggers Worten – »der Tod das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns« bedeutet (vgl. GA 65, 284).
Allein aus diesem Grunde hat die Theologie zu Beginn des dritten Jahrtausends keinerlei Kompromiss mit dem Unwesen ihrer Zeit einzugehen, sondern es mit aller Entschiedenheit beim Namen zu nennen. Nur so gilt für sie die Verheißung, die im Buch der Offenbarung im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet ist: »Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben; daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen« (Offb 3,10). Mag sein, dass diese Stunde schon heute – seit gut einem Jahrhundert – angebrochen ist. Doch nicht weniger aktuell ist ein anderes Heute , das mit der Auferstehung Jesu Christi als Akt messianischer Zeugung seinen Anfang nimmt: »So verkünden wir euch das Evangelium: Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, wie es schon im zweiten Psalm heißt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt « (Apg 13,32 f.).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.