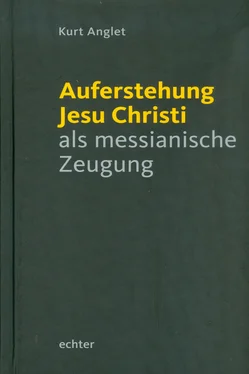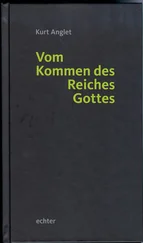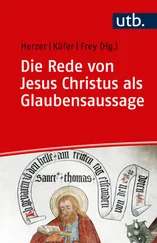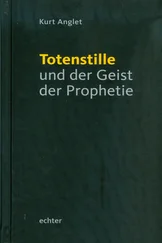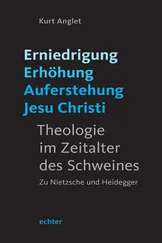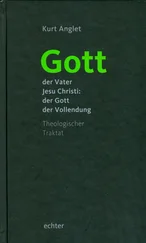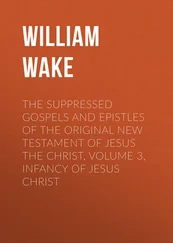Obgleich Heidegger unter dem Eindruck des verlorengegangenen Zweiten Weltkriegs gar » die Eschatologie des Seyns« verfasste (vgl. GA 97, 335, 391) und aus seiner zum »Ereignis« aufgeblähten geschichtlichen Selbstmanifestation eingetreten ist »in den Brauch«: »nur das gehörende Hören in die Stille des Brauchs vermag horchsam zu gehorchen« (vgl. ebd. 398) – so hat es nichts von seinem pseudogöttlichen Wesen bzw. Unwesen eingebüßt. »Das befehlende Wesen des Denkens, das nur aus dem Seyn erfahrbar wird, insofern dieses sich als das Ereignis des Brauchs gelichtet hat, setzt uns erst in den Stand, das zu bedenken, was dem vorstellenden Denken zugänglich wurde als das vorherige Vernehmen der Seiendheit des Seienden« (ebd. 399). Über das Seiende hinaus öffnet es das Auge bzw. das Ohr für das schlechthin Unvorstellbare – für die Ewigkeit des Todes, für die absolute Todesverfallenheit menschlichen Daseins. Das ist die frohe Botschaft des Todesäons, die Heidegger für alle bereithält, die bereitwillig dem Kultus des Todes huldigen, der doch so befreiend für alle wirken muss, die die Fesseln des Gottesgehorsams von sich werfen, um »horchsam zu gehorchen« – den Einflüsterungen des Todes.
Denn bei allen Metamorphosen, die Heideggers Philosophie kennt, ist er sich in einem treu geblieben: im Kultus des Todes – »der Tod als das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns«. Obschon selbst das »Seyn« seit dem vierten Band der Schwarzen Hefte kontaminiert erscheint durch die Seinsverlassenheit – kaum zufällig erscheint das Wort »Seyn« meist durchstrichen bzw. durchkreuzt –, so verschafft dem Verzweifelten Trost, dass die verhasste Welt der Technik, des Machens, der Machenschaften nicht das letzte Worte behält, sondern die Stille des Todes. Gleich einem philosophischen Brechkübel umfasst jene Welt alles, was dem Seinsdenken zuwider ist, letzthin dem Seienden Verhaftete: vom biblischen Schöpfergott über die »Judenschaft«, die kirchlichen Dogmen bis hin zum Amerikanismus, der mit dem Sieg der Alliierten nun auch in Europa Einzug hält.
Dabei ist es Heideggers Denken selbst, sein Kultus des Todes, der jener Welt näher steht, als er selbst zuzugestehen geneigt ist. Einer, dem jener Kultus nicht unvertraut war, hat das ausgesprochen: der Philosoph Walter Benjamin, der noch im zweiten Abschnitt seines Theologischpolitischen Fragments aus der Zeit 1920/21 schrieb, messianisch sei »die Natur aus ihrer ewigen und totalen Vergängnis« (vgl. GS II.1, 204), um später – im Ursprung des deutschen Trauerspiels – über »das Wesen melancholischer Versenkung« zu vermerken, »daß ihre letzten Gegenstände, in denen des Verworfnen sie am völligsten sich zu versichern glaubt, in Allegorien umschlagen, daß sie das Nichts, in dem sie sich darstellen, erfüllen und verleugnen, so wie die Intention zuletzt im Anblick der Gebeine nicht treu verharrt, sondern zur Auferstehung treulos überspringt« (vgl. GS I.1, 406). Gleichsam als theologischer Grenzgänger hat Benjamin in seinem Fragment Kapitalismus als Religion aus dem Jahre 1921 in der Welt des Kapitalismus einen Kult des Todes gewahrt, bevor Heidegger diesen Kult in eine Ontologie ummünzen sollte. Es entbehrt nicht der Ironie, dass sich Benjamin noch kurz zuvor gegenüber Gershom Scholem höchst abschätzig über Heideggers Habilitationsschrift Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus äußerte, da er seinerseits eine Habilitationsarbeit zum Problemkreis Wort und Begriff bzw. Sprache und Logos im Hinblick auf die Scholastik zu verfassen beabsichtigte (vgl. hierzu GS I.3, 868 ff.). Dazu sollte es nicht kommen, wie auch jenes Fragment unveröffentlicht blieb: ein knapper, jedoch wahrhaft visionärer Text, der seine volle Bestätigung Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später erfahren sollte. »Der Typus des kapitalistischen religiösen Denkens«, heißt es da, »findet sich großartig in der Philosophie Nietzsches ausgesprochen. Der Gedanke des Übermenschen verlegt den apokalyptischen ›Sprung‹ nicht in die Umkehr, Sühne, Reinigung, Buße, sondern in die scheinbar stetige, in letzter Spanne aber sprengende, diskontinuierliche Steigerung. Daher sind Steigerung und Entwicklung im Sinne des ›non facit saltum‹ unvereinbar. Der Übermensch ist der ohne Umkehr angelangte, der durch den Himmel durchgewachsne, historische Mensch. Diese Spannung des Himmels durch gesteigerte Menschhaftigkeit, die religiös (auch für Nietzsche) Verschuldung ist und bleibt〈,〉 hat Nietzsche pr〈ä〉judiziert. Und ähnlich Marx: der nicht umkehrende Kapitalismus wird mit Zins und Zinseszins, als welche Funktion der Schuld (siehe die dämonische Zweideutigkeit dieses Begriffs) sind, Sozialismus« (GS VI, 101). Im Abschnitt zuvor bringt Benjamin auch Freud mit jenem Kult in Verbindung: »Die Freudsche Theorie gehört auch zur Priesterherrschaft von diesem Kult. Sie ist ganz kapitalistisch gedacht. Das Verdrängte, die sündige Vorstellung, ist aus tiefster, noch zu durchleuchtender Analogie das Kapital, welches die Hölle des Unbewußten verzinst.«
Es versteht sich, dass Benjamin, am Anfang einer hoffnungsvollen akademischen Karriere stehend, vor einer Veröffentlichung seiner Gedanken zurückschreckte; hatte er sich doch buchstäblich zwischen alle Stühle gesetzt, wobei der vierte Stuhl, den Heidegger einige Jahre später, mit seinem großen Wurf von Sein und Zeit , einnehmen sollte, damals noch unbesetzt war. Denn nicht um eine soziologische Bestandsaufnahme handelt es sich bei seiner Deutung des Kapitalismus als Religion; ebenso wenig um eine sozialphilosophische Diagnose im Sinne der späteren Frankfurter Schule bzw. Kritischen Theorie als vielmehr um eine theologische Deutung. »Der Nachweis dieser religiösen Struktur des Kapitalismus, nicht nur, wie Weber meint, als eines religiös bedingten Gebildes, sondern als einer essentiell religiösen Erscheinung, würde heute noch auf den Abweg einer maßlosen Universalpolemik führen. Wir können das Netz in dem wir stehen nicht zuziehn. Später wird das jedoch überblickt werden« (ebd. 100). Heute – nahezu einhundert Jahre später – können wir es überblicken, wenngleich Benjamin keine maßlose Universalpolemik zu fürchten hätte; er dürfte eher damit rechnen, totgeschwiegen zu werden, weil er den wunden Punkt einer Gesellschaft berührt, die sich als so frei und offen empfindet, dass sie keiner übergreifenden metaphysischen, gar göttlichen Ordnung bedarf, da sie mit der Akkumulation menschlicher Schuld so gut leben zu können glaubt wie mit der Anhäufung der Schuldenberge in den heutigen Staats- und Privathaushalten. »Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus. Hierin steht dieses Religionssystem im Sturz einer ungeheuren Bewegung. Ein ungeheures Schuldbewußtsein das sich nicht zu entsühnen weiß, greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen« (ebd. 100), vermerkt Benjamin. »Darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, daß Religion nicht mehr Reform des Seins sondern dessen Zertrümmerung ist« (ebd. 101).
Nichts anderes aber vollzieht Heideggers Seinsdenken, mochten ihm ökonomische Überlegungen, gar die Welt des Kapitalismus noch so fern liegen. Doch die Welt zuvor, bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein, keineswegs allein eine christlich geprägte, war ohne eine bestimmte kosmische Ordnung gar nicht denkbar, da es ohne sie kein zivilisiertes, geregeltes Zusammenleben von Menschen geben konnte; zu bedrohlich war der Rückfall in Tyrannei oder in ein barbarisches Hordenwesen. Genau diese Ordnung aber wird von Heidegger in Abrede gestellt, und zwar nicht aus irgendwelchen anarchistischen Instinkten heraus als vielmehr unter Berufung auf einen Ursprung vor aller metaphysischen Ordnung unter dem Namen des »Seyns«, der geradezu auf eine Gegenwelt, wenn nicht Vorwelt gegenüber jener Welt der Technik zu weisen scheint, deren Verachtung allein deshalb absurd wirkt, als ob der Mensch zuvor, in einem vortechnologischen Zeitalter, in paradiesischen Zuständen gelebt hätte! Doch um ein paradiesisches Leben war es Heidegger niemals zu tun, wie vor ihm der Nietzsche von Jenseits von Gut und Böse an alles andere als ein Leben in Unschuld dachte. Mochte es Heidegger auch in die Welt der Vorsokratiker ziehen, wie Nietzsche in das tragische Zeitalter der Griechen – die Attitüde des Unzeitgemäßen vermag hier wie dort nicht darüber hinwegzutäuschen, dass zumal Heidegger in seiner Lossage vom Gott der Offenbarung jenen Typus der kapitalistischen Religion, den Typus universaler Verschuldung, geradezu in Reinkultur verkörpert: Es handelt sich nicht etwa um einen Typus der Vorzeit, sondern der Endzeit – der Apokalypse: um den Menschen der Gesetzwidrigkeit, der anomía (vgl. 2 Thess 2,3; 1 Tim 4,1; 1 Joh 2,18; 4,3). »Laßt Welt nur welten, sie bedarf der ›Ordnung‹ nicht. Aber ›Welt- Ordnen‹ – d. h. das Wirken verwirkt alles – verwirkt das Denken des Seyns und verwirkt sogar die Vergessenheit . Sie ordnet die ›Welt‹, bevor sie vermögen, Welt welten zu lassen« (GA 97, 89 f.). Was hier anscheinend harmlos daherkommt, bildet den Gipfel der Heuchelei. War schon Nietzsche heuchlerisch, insofern er den Übermenschen propagierte und den amor fati , die Liebe zum Schicksal, predigte, selbst aber den »Heutigen« die Augen auszustechen trachtete, weil seine Zeitgenossen dem großen Philosophen die gebotene Ehrerbietung versagten [man denke an sein Lamento über seine »Hundestall-Existenz« (vgl. KGW VIII.1, 202)], so reicht nichts an die Heuchelei Heideggers heran, wenn man bedenkt, dass jene Zeilen in einer Zeit geschrieben wurden, als Millionen unsägliches Leid erlitten: »Laßt Welt nur welten, sie bedarf der ›Ordnung‹ nicht.« Sie bedarf fürwahr der Ordnung nicht, wenn kein anderes Recht gilt als das des Gewalttäters; Gottes Gesetz wie die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, von Gerechtigkeit gar nicht zu reden. Und nicht nur dass der bloße Gedanke an Recht und Gerechtigkeit dem »Denken des Seyns« abträglich ist, das sich mal am Unwesen der Geschichte ergötzt, mal in der Stille des Brauchs zu sich findet – es »verwirkt sogar die Vergessenheit« , die den Toten winkt und alles Leid begräbt. »Seyn« bedeutet letzthin nicht mehr als eine Umschreibung seiner selbst: seines Selbstmitleids und seiner Selbstgerechtigkeit, wie sie Heidegger im Zuge seiner Amtsenthebung ungeniert zur Schau stellt – als »Verrat am Denken« (vgl. ebd. 61 f.; 82 ff.); ja, er entblödet sich nicht, sich angesichts seines vormaligen NS-Engagements mit Churchill zu vergleichen, der über Jahre hinweg mit Stalin paktiert habe – als hätte der britische Premier nach dem Scheitern der britischen Appeasement-Politik und der Niederlage Frankreichs überhaupt eine Wahl gehabt, sich die Kriegspartner auszusuchen … Weltfremdheit und Weltverschriebenheit bilden offensichtlich keinen Gegensatz, wie Lächerlichkeit und Vermessenheit zusammengehören.
Читать дальше