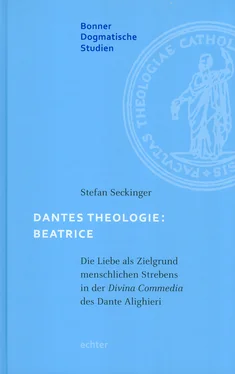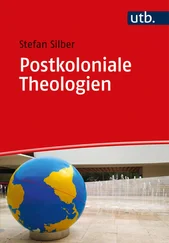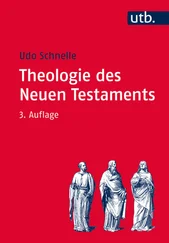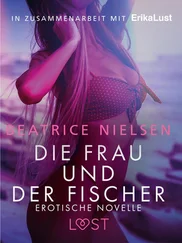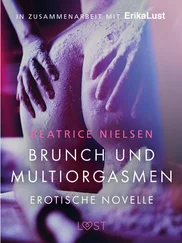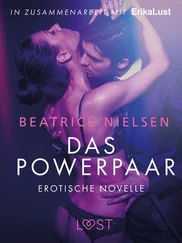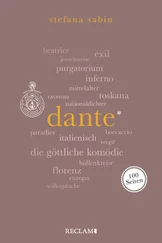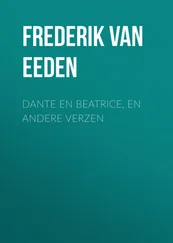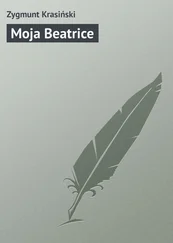»Wer bist denn du, der drüber zu Gerichte
Auf tausend Meilen Ferne sitzen möchte
Mit einem Blick so kurz wie eine Spanne ?
Gewiß, wer mit mir diskutieren möchte,
Der fände Wunder wieviel zu bezweifeln,
Wenn euch die Bibel ( la Scittura ) nicht gegeben wäre.
O irdische Wesen ( terreni animali ), o ihr rohen Geister !
Der erste Wille, der für sich schon gut ist,
Verläßt sich selber nie, das höchste Gute.
Das ist gerecht, was mit ihm steht im Einklang.« 328
Das Wort der himmlischen Gerechtigkeit bleibt in seiner Unergründlichkeit und Schicksalsschwere stehen :
A questo regno
Non salì mai chi non credette in Cristo
Nè pria nè poi ch’el si chiavasse al legno . 329
3.3.2 Das Übermaß an irdischem Streben oder der Merkurhimmel
Die Zunahme der Leuchtkraft von Beatricens Augen (die sie von Gott bzw. dessen Schau empfängt) steigert die Lichtempfänglichkeit und das Sehvermögen Dantes, der in dieser Bewegung, in der Licht, Schauen, Freude ( letizia in Par. V, 107) oder auch Lächeln ( riso in Par. VII, 17), Erkennen und Lieben eine Einheit bilden 330, emporgehoben wird zum zweiten Stern, dem Merkurhimmel. Innerer Antrieb des Aufstieges 331ist das unauslöschbare Sehnen Dantes nach Gott, das in Beatricens Blick Aufnahme und (zunächst noch vermittelte) Erfüllung erfährt. Dante wird von den Seligen des Merkurhimmels begrüßt mit den Worten : Ecco chi crescerà li nostri amori . Die von Gott auf sie ausstrahlende Liebe gewinnt in der Gemeinschaft durch jede neue ihnen hinzugewonnene Seele Zuwachs. 332Die Liebe der communio sanctorum ist demnach auch als eine gemeinschaftliche zu sehen, als eine von Gott selbst herkommende Dynamik, die den anderen mit hineinnimmt und niemals individualistisch sich nur zwischen dem Einzelnen und seinem Schöpfer abspielt (dies im Unterschied zum Wesen der Verdammten – von jedweder Geborgenheit vermittelnden Gemeinschaft Isolierten – als der sich gegenseitig Schädigenden und Verleumdenden).
Im Merkurhimmel trifft Dante Kaiser Justinian 333(Selbstnennung in Par. VI, 10), der in Par. VI, 1 ff. die Geschichte des römischen Imperiums als gottgewollt und das Kaisertum als Gewähr allgemeiner Wohlfahrt ansieht. Die Seelen dieser Sphäre zeichnen sich durch ihre Aktivität ( che son stati attivi ; Par. VI, 113) in irdischen Belangen aus (in Relation zum Saturnhimmel, der für die vita contemplativa steht). Der zweitunterste Himmel steht ebenso wie Mond- und Venushimmel noch im Bannkreis des sublunaren weltlichen Strebens (hier nach onore e fama ; Par. VI, 114).
Justinian bezeichnet sich selbst als ein vom Monophysitismus 334Bekehrter (Par. VI, 13–18), der sich für die Kirche auf Erden einsetzte mit Hilfe der ihm von Gott verliehenen Gnade (Par. VI, 22–24). Er macht sich Dantes Idee des gottgewollten römischen Kaiserreichs zu eigen, indem er den Parteienzank seiner Zeit und v. a. das französische Königshaus anklagt, che son cagion di tutti vostri mali (Par. VI, 99). 335Die Einheit des Reiches ist nach ihm Gewähr für Frieden, allgemeine Wohlfahrt und das Seelenheil des Einzelnen, da die Kirche selbst hineingezogen in die unterschiedlichen Parteiungen letztlich wider sich selbst steht, anstatt sich ihrem seelsorglichen Auftrag zu stellen.
Exkurs : Sündenfall und Erlösung
Der siebte Gesang des Paradiso beginnt mit einem hymnischen Lobpreis der Erlösungstat Gottes in lateinischer Sprache. 336Hierauf greift Beatrice eine (ungeäußerte, aber dennoch gemäß der captatio benevolentiae der Heiligen wahrgenommene) Frage Dantes bzgl. der Aussage Justinians in Par. VI. 88–93 auf, wonach unter der Regierung des Kaisers Tiberius das gottgeleitete Kaisertum den Kreuzestod Christi als Verbindung von Rache ( vendetta ) und Zorn ( ira ) ermöglichte und damit auch die Erlösung, schließlich durch den Jerusalemfeldzug unter Titus diese Rache wiederum mit Rache zu vergelten suchte (Par. VII, 92 f. : far vendetta corse della vendetta del peccato antico ), also »warum gerechte Rache auch selber rechter Rache noch bedürfe.« 337Sie gibt ihm Antwort in einem prägnanten Durchgang durch die Heilsgeschichte in der Zusammenschau von Schöpfungslehre und Soteriologie, von Sündenfall (Erlösungsbedürftigkeit) und Kreuzestod (Erlösung). Adam 338( che non nacque ; Par. VII, 25) sündigte (und mit ihm die gesamte, korporative Schicksalsgemeinschaft der Menschen), indem er »verschmähte, die Willenskraft zu seinem Heil zu zügeln« 339. Christus hat del suo eterno Amore (Par. VII, 33) durch Inkarnation (ebd., 30–33) und Kreuzestod (ebd., 40) Erlösung gebracht. Der selbstverschuldeten ( per sè stessa ; Par. VII, 37) Gottentfremdung der im ersten Menschen eingeschlossenen Schicksalsgemeinschaft aller, die nicht im (guten) Schöpfungswerk selbst verankert werden kann ( questa natura […] qual fu creata, fu sincera e buona ; Par. VII, 35 f.), der erbsündlichen Abwendung von Wahrheit und Leben ( da via di verità e da sua vita ; Par. VII, 39), wird das Erlösungswerk des Sohnes gegenübergestellt, wobei Anselms Satisfaktionstheorie 340aufleuchtet :
»Die Strafe also, die am Kreuz erduldet,
Entsprechend der Natur, die angenommen,
War so gerecht wie niemals eine Strafe.
Und dennoch war auch keine je so schändlich,
Wenn man auf die Person des Dulders achtet,
Der die Natur auf sich genommen hatte.
So kommt aus einer Tat verschiedne Wirkung :
Gott und den Juden ( Dio ed ai Giudei ) hat ein Tod gefallen,
Die Erde bebte, auf tat sich der Himmel.« 341
Nach Dante ist dementsprechend der Feldzug des Titus und die Eroberung Jerusalems (70 n. Chr.) als Strafe der gerechten Rache ( giusta vendetta ; Par. VII, 50) verstehbar, da er streng zwischen dem Werkzeugcharakter des römischen Weltreiches beim Kreuzestod Jesu und der den damaligen Juden angelasteten Ungeheuerlichkeit der Tötung des erwarteten Messias unterscheidet (legitimer Richter und Vollstrecker des göttlichen Ratschlusses ist allein das gottgewollte Kaisertum). 342Dass hierbei eine im Mittelalter weit verbreitete Ansicht der Universalschuld der Juden am Tod Jesu mit ihrer (gottgewollten) Vertreibung und Verfolgung durch das Reich in Verbindung gebracht wird, ist aus eben diesem Interpretationshorizont heraus zu sehen.
In der DC stellt Dante der gelehrten Gottesweisheit in der Gestalt Beatricens die Frage nach der Angemessenheit einer solchen Vorstellung. Er stellt sich also zunächst auf die Seite der Skeptiker, nimmt dann allerdings ihre Erklärung an. 343Zunächst jedoch fragt er weiter nach der Notwendigkeit gerade einer solchen Art der Erlösung (wiederum erkennt Beatrice Dantes Zweifel, ohne dass dieser ihn zu äußern brauchte ; Par. VII, 55–57), da er das Wesen der Liebe noch nicht erfasst hat ( Questa decreto […] sta sepulto agli occhi di ciascuno il cui ingegno nella fiamma d’amor non è adulto ; Par. VII, 58–60). Die Liebe ( buontà del cuore ; ebd., 109) ist somit Motiv von Menschwerdung und Kreuzestod, die beide auch nur in Liebe gnadenhaft annehmbar und verstehbar (im Sinne des mysterialen Glaubenssinnes) sind. Gottebenbildlichkeit 344, Unsterblichkeit 345(Par. VII, 67–69) und Freiheit 346(ebd., 70–72) sind nach dem Schöpfungsbericht Auszeichnungen des Menschen, die durch den Sündenfall Schaden erlitten (ebd., 79–81). Da es dem Menschen in seiner Schuld (erbsündlichen Verfangenheit) nicht möglich ist, sich selbst zu erlösen (ebd., 97–102), blieben Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 347, um sein Erlösungswerk am Menschen in Freiheit zu vollziehen (ebd., 103 ff.). In der Person Jesu Christi wird ungeschuldet allen das Heil angeboten, womit das Wesen der Rechtfertigung zum Ausdruck gebracht ist :
Читать дальше