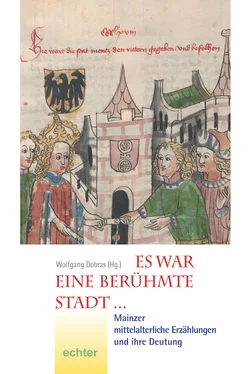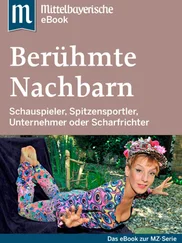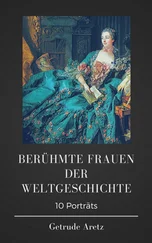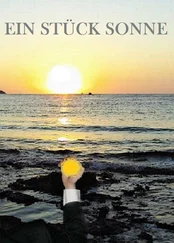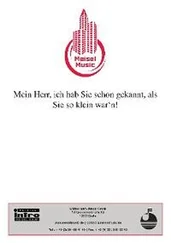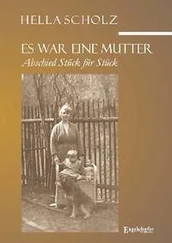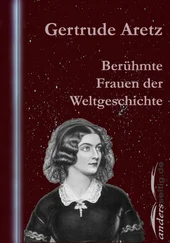Stärker als in der „Historia“ ist der Akzent, der auf der Bedürftigkeit der Mutter liegt: Tief im Wald bewohnen Pila und ihr Vater Atus eine moosige Hütte, ein arm heimûte (v. 271). Von armûte in die wûstene getriben (v. 272f), bilden sie ein krank gesinde (v. 275). Der neugeborene Knabe selbst aber ist von ausnehmend edler Gestalt. Seine Schönheit verheißt ihm gar ein crône unde ein cunicrîche (v. 316f). Schon bald werden seine hohen Anlagen deutlich, die ihn zum Erwerb von zuht, […] prîs unde […] êre (v. 354f) befähigen. Die Darstellung der „Historia“ wird dabei nachdrücklich umakzentuiert: Pilatus ist es, der seinen Halbbruder an ritterlichen Tugenden und Erfolgen, an „Geschick und Gewandheit, an Schönheit und Anstand“ (v. 364f) überflügelt: mit grôzer unmâze ubirginc in sîn craft (v. 366f).
Damit ist zugleich das geistliche Deutungsmuster des Brudermordes aufgegeben, das Verhältnis der Brüder völlig anders konzipiert. Neid, der in der lateinischen „Historia“ den Gottesfeind anstachelt, herrscht in der mittelhochdeutschen Dichtung auf beiden Seiten. Der eheliche Sohn neidet Pilatus seine ritterliche Überlegenheit, dieser jenem den gesellschaftlichen Status, denn der edlere erreicht viel mehr durh frûnt unde mâge (Freunde und Verwandte, v. 376f). Der legitime Königssohn stützt sein Ansehen auf das weit verzweigte Beziehungsnetz, das die vornehme Welt ihren Angehörigen zur Verfügung stellt, Pilatus dagegen kann nur auf seine persönliche Leistungskraft bauen. Im Streit der Brüder geht es also um nichts Geringeres als um die Legitimation der Ständeordnung: des quam (kam) an dî wâge disses tugint, ienisgebort (v. 378f). Tugendadel steht gegen den Vorrang der Geburt. Die Art und Weise, wie die Brüder schließlich ihren Konflikt austragen, spiegelt diesen Gegensatz: Bei einem gemeinsamen Ausritt greift der edele (v. 390) im Vertrauen auf sein großes Gefolge Pilatus an: der widerstand alleine den andren algemeine (v. 395f). Seine sterke (v. 394) trägt Pilatus den Sieg ein; unmut (v. 392) lässt ihn jede Rücksichtnahme vergessen: dem brudere er den lîb nam (v. 399).
Seine Sympathie für den Helden behält der Erzähler im gesamten überlieferten Text bei, der mit der Unterwerfung der Pontier allerdings abbricht, bevor es zum Eingreifen des Pilatus in die biblische Geschichte kommt. Zentrale Bedeutung erhält dabei die mit geradezu programmatischem Nachdruck verkündete Idee des Tugendadels. Sie ist kennzeichnend für das in der volkssprachigen Epik des 12. Jahrhunderts allenthalben verbreitete Leitbild des Rittertums, das einem neuen Literaturpublikum aus Laien und Kriegern als kulturelles Orientierungsangebot dienen sollte. Im Falle des Pilatuslebens nimmt es eine besondere Färbung an: tugint stellt im Sprachgebrauch der Dichtung keine moralische Qualität, etwa im kirchlichen Sinne, dar, sondern bedeutet physische Überlegenheit, manheit (v. 391) und sterke . Indem Pilatus allein gegen die Übermacht der Anhänger seines Bruders siegreich bleibt, erweist er sich als der überlegene Kämpfer. Hinzu tritt allerdings auch höfische Vornehmheit, vôge (Geschick) und gwande (Gewandheit, v. 364). Damit deutet sich an, dass es nicht allein um das Ausspielen von Körperkraft geht, sondern außerdem um ästhetische Verfeinerung und Stilisierung des Auftretens, um Selbstdarstellung vor einem öffentlichen Forum. Dieses repräsentative Element verweist auf den Hof als Betätigungs- und Bewährungsfeld eines Rittertums, das persönliche Vervollkommnung gegen den Vorrang eines auf der Geburt basierenden Adels setzt. Dass im Zusammenstoß mit dem geburtsständischen Prinzip selbst vor dem Tabu des Brudermordes nicht halt gemacht wird, ist kennzeichnend für das aggressive Potential einer nur oberflächlich kultivierten Kriegermentalität. Der Erzähler motiviert die Tat mit dem unmut des Angegriffenen, als eine in der Hitze des Gefechts begangene Affekthandlung, die ihrem Vollbringer nicht als persönliche Schuld anzurechnen ist. Hier herrscht tatsächlich die ungezügelte Gewalt des Weltstaates, die die lateinische Legende so vehement angeprangert hatte.
In der Folgezeit fand diese höfisch-ritterliche Bearbeitung des Pilatusstoffes freilich keine Nachfolger mehr. In den Vordergrund traten nun Darstellungsformen, die an ein stadtbürgerliches Publikum gerichtet und mehr an sachorientierter Informationsvermittlung interessiert waren als an dichterischer Ausgestaltung. So haben etwa die im Spätmittelalter weit verbreiteten Welt- und Regionalchroniken das Pilatusleben immer wieder behandelt. Mainz wird dabei nicht immer genannt, da es schon Jacobus de Voragine aus seiner gerafften Wiedergabe der Legende getilgt hatte. Auch die ausführliche Version in der älteren, noch gereimten Weltchronik des Wiener Patriziers Jansen Enikel erwähnt Mainz nicht. Anders eine niederdeutsche Fassung der Pilatuslegende 19, die ein Kaplan Johannes Vick – ausweislich des Kolophons – in eine 1434 im Schleswigschen Ruhekloster angefertigte Handschrift der Sächsischen Weltchronik einfügte. In ihrem Kernbestand hatte dieses in Prosa verfasste sehr umfangreiche Chronikwerk in sächsischer, d.h. niederdeutscher Sprache das Pilatusleben noch nicht enthalten. Die eingefügte Version stützt sich stärker auf die Tradition der französischen Pilatusstätten, indem sie den Vater als Herrn über Lyon und to Viannen (Vienne; S. 147, 2) einführt. Nur die Geburt selbst wird nach Mainz, in dat biscodum to Mense (ebd., 3) verlegt. Offenbar versucht der Redaktor, unterschiedliche Angaben seiner Quellen 20zu harmonisieren, indem er Abstammung und Geburt auf getrennte Orte verteilt. Er hält die Geschichte für wahr und will sie zuverlässig wiedergeben.
In dieses Umfeld gehört auch Johannes Rothe, dessen thüringische Weltchronik allerdings schon wesentlich deutlicher die sich wandelnden Rezeptionsinteressen erkennen lässt. Noch immer gelten die alten universalen Deutungsmuster, aber sie allein vermögen ein solches historiographisches Großunternehmen nicht mehr zu rechtfertigen. Die Aufmerksamkeit richtet sich immer stärker auf das eigene regionale Umfeld, über dessen Vergangenheit und Ursprung der Geschichtsschreiber Auskunft geben will. Rothe verarbeitet die Pilatuslegende zweimal, neben der Weltchronik, die überwiegend in Prosa verfasst ist, auch in einer gereimten Passionsdichtung. Natürlich nutzt er für seine eingangs zitierte Version keine neuen Quellen: Seine Quelle ist die Sprache, genauer: die Eigennamen und ihre Deutungen. Dabei fußt er ganz auf der voraus liegenden lateinischen Tradition: Er schließt sich bei der Abstammung des Pilatus der Version an, die den Großvater ausscheidet und bereits Pilatus’ Vater den Namen Atus tragen lässt. Der zweite Name, der gedeutet wird, ist der von Mainz, ebenfalls wie im lateinischen Epos als eine Kombination zweier Gewässernamen. Rothe braucht eigentlich nur diese beiden etymologischen Motive zu verbinden, um daraus die Stadtgründungssage zu entfalten. Durch eine kleine graphische Varianz lässt er den König Atus der Pilatusvita zur Sagengestalt Artus werden: Eyn konigk was an dem Reyne gesessen der hiess Athus, den das gemeyne volk noch nennet konigk Arthus . Solche bedeutenden Stifterpersönlichkeiten zu finden – oder auch zu erfinden –, gehörte zur „wohlverstandenen Handwerkskunst in Chroniken und Legenden“ (Uwe Ruberg). 21Rothe befriedigt damit ein Bildungsinteresse seines städtischen Publikums, für das Mainz eine wichtige Bezugsgröße darstellte. Denn der Großteil Thüringens einschließlich der Residenzstadt Eisenach gehörte damals zum geistlichen Sprengel des Mainzer Erzstuhls, und auch Rothe war mithin Mainzer Diözesanpriester. Nach der Darstellung, die er in seiner Weltchronik überliefert, führten die Thüringer Landgrafen, denen er sein Werk widmet, ihre Herrschaft außerdem auf eine Übertragung durch den Erzbischof von Mainz zurück, so dass die Stadt auch für die Legitimation der weltlichen Ordnung relevant war.
Читать дальше