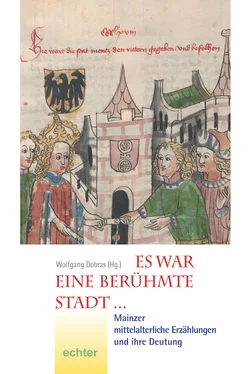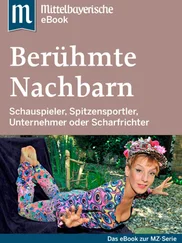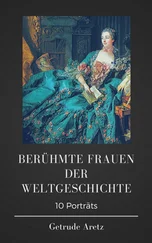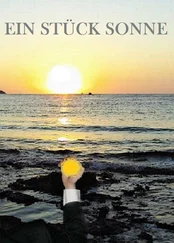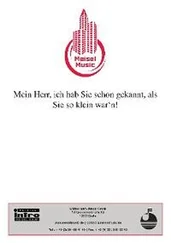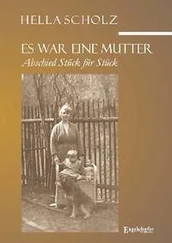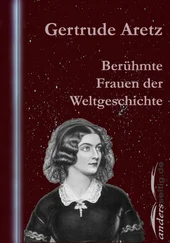1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 52 Drusum, Augusti privignum, aliosque Romanorum principes habuit [sc. Mainz] conditores et possessores (Gozwinus, Ex passione S. Albani, wie Anm. 45, cap. 24, S. 988).
53 So auch bei Gozwin (vgl. die vorhergehende Anmerkung); vgl. Sigehard von St. Alban, Passio sanctorum Aurei et Justinae (wie Anm. 34), lectio 10, fol. 7v.
54 Windeck-Fassung (wie Anm. a), S. 457f. Die Passage schließt unmittelbar an die Erzählung von der Gründung von Mainz an, vgl. den Schluss des diesem Beitrag vorangestellten Textabschnittes. Vgl. GOERLITZ, Facetten (wie Anm. 6), S. 81ff. Vgl. die Rekonstruktion des Drusus-Monumentes mit der Unterschrift „In Drusenloch olim“ bei Nicolaus SERARIUS oben in Abb. 2; sie geht auf den Mainzer Humanisten Hermannus PISCATOR OSB (wie Anm. 13) zurück und wird von diesem unter anderem aufgrund der Erzählung vom „Ursprung der Stadt Mainz“ entstehungsgeschichtlich wie auch von Serarius vom erhaltenen „Eichelstein“ (bei Serarius: „Aichelstein“), in dem die Forschung das Kenotaph Drusus’ d. Ä. sieht, unterschieden (GOERLITZ, Humanismus, wie Anm. 13, S. 154f, 189f).
55 SCHEDEL, Weltchronik (wie Anm. 49), fol. XXXIXv.
56 Sorbillo, Brief an Hermannus Piscator (wie Anm. 13) fol. 9v: vrbemque Maguntinam licet antiquissimam adeo decorauit, vt quasi de nouo a Druso putaretur condita .
57 Hier und im Folgenden PISCATOR, Brief an Petrus Sorbillo (wie Anm. 13), fol. 13v–14v.
58 Vgl. oben mit Anm. 5.
59 Die Zitate sind dem grundlegenden Beitrag von SEIDENSPINNER, Sage und Geschichte (wie Anm. 2), S. 19 und 34 entnommen.
60 SEIDENSPINNER, Sage und Geschichte (wie Anm. 2), S. 34.
PONTIUS PILATUS – EIN UNEHELICHER KÖNIGSSOHN AUS MAINZ
Andreas Scheidgen
Für Uwe Ruberg
„Wie Pilatus geboren wurde
Ein König war am Rheine ansässig, der Atus hieß und den das einfache Volk noch heute König Artus nennt. Der baute am Rhein eine zerfallene Stadt, die zu weit vom Fluß entfernt gelegen hatte, wieder auf und nannte sie Maguncia. Wir nennen sie heute Mainz. Und er gab ihr den Namen nach zwei Gewässern, die dort in den Rhein fließen: dem Main oberhalb der Stadt und der Cya neben ihr. Einmal übernachtete er am Rhein, um nicht mehr über den Fluß setzen zu müssen, und fand Herberge in einer Mühle.
Nun hatte der Müller eine gar schöne Tochter, die Pila hieß. Bei der schlief der König des Nachts, und sie empfing von ihm einen Sohn. Als sie ihn aufgezogen hatte und er drei Jahre alt war, sandte sie ihn seinem Vater, dem König. Dieser fügte den Namen der Mutter und seinen Namen zusammen und bildete dem Sohn daraus einen Namen, der Pilatus lautete. Nun hatte der König auch einen Sohn von seiner rechtmäßigen Ehefrau, der ungefähr so alt wie Pilatus war. Beide warfen gemeinsam mit Schleudern nach Vögeln und spielten oft miteinander, bis Pilatus voller Heimtücke beim Spiel seinen Bruder mit einem Steinwurf tötete. Da mochte ihn der König nicht länger mehr dulden und schickte ihn als Geisel dem Kaiser nach Rom, wie es die Fürsten damals mit ihren Kindern tun mussten. Da blieb er, bis er zu einem Mann wurde.“
Wie Pylatus geborn wart
Eyn konigk was an dem Reyne gesessen der hießs Athus, den das gemeyne volk noch nennet konigk Arthus, der buwete an den Reyn eyne zu brochene stat, die zu verre dorvon gelegen hatte, und hießs die Maguncia, die wir nu Mentz nennen, unde gap or den namen von zwen wassern dieyn den Reyn do flißsen: der Möyin pobir der stat und die Cya do nebene. Der benachte an dem Reyne das her nicht mochte obir geschiffen unde herbergitte yn einer molen. do hette der moller gar eyne schone tochtir die hießs Pyla, die beslieff der konigk des nachtis unde sie entphingk vonn ym eynen ßsonn. Unde do sie den generte das her dreier jar alt war, do sante sie on seyme vater dem konige, unde der satzte der muter namen unde seynen namen zu sampne unde machte dem ßsone eynen namen das her sulde heißsen Pylatus. Nu hatte derselbe konigk eynen son bey seyner elichen frowen, der was nahe bey Pylatus aldir. die worffen mit sleudern noch vogilchen unde spelten als mit eynander, also lange das Pylatus vil hemischlichen geschymphte, das her seynen bruder mit eyme steyne zu tode gewarf Do mochte on der vatir nicht lenger geleiden unde sante ynn zu gisil dem keyser zu Rome, also die fursten ere kynder musten thun, unde do was her bys das her zu eyme manne wart .
Aus der „Thüringischen Weltchronik“ des Johannes Rothe, 1421 1
Es ist starker Tobak, den der Eisenacher Geschichtsschreiber Johannes Rothe den Lesern seiner „Thüringischen Weltchronik“ aus dem Jahr 1421 vorsetzt: Pontius Pilatus – ein Mainzer? Und nicht nur das, auch noch ein Sohn des Königs Artus, gezeugt beim Ehebruch des ebenso tugend- wie sagenhaften Herrschers, der dabei gleich als Stadtgründer von Mainz vereinnahmt wird, mit einer schönen Müllerin! Nun wird niemand diese kuriose Mixtur für bare Münze nehmen. Wo Pilatus wirklich geboren wurde, wissen wir nicht; vermutlich stammte er aus Italien. 2Aber manch einer mag sich fragen, ob die Geschichte nicht doch einen wahren Kern hat. Eine verloren gegangene Überlieferung über Verbindungen zwischen der römischen Garnisonsstadt Mainz und der Provinz Judäa zur Zeit Jesu Christi vielleicht? Für einen Fabulierer und Märchenerzähler wurde Johannes Rothe von seinen Mitbürgern in Eisenach jedenfalls nicht gehalten. Sonst hätten sie ihn, den angesehenen Priester und Schulmeister, sicher nicht zum Stadtschreiber gemacht und ihm die Zusammenstellung eines Rechtsbuchs anvertraut, ein Jahrhundertprojekt der Sammlung und Kodifizierung, dazu bestimmt, das Zusammenleben in der Stadt für Generationen zu regeln. 3Wenn ein solcher Mann die Geschichte von Pilatus aufschrieb, dann deshalb, weil er sie für wahr hielt. Warum konnte er das?
I. Legende
Rothe hätte vermutlich nachdrücklich widersprochen, wenn man seine Geschichte – wie in diesem Band – unter die Sagen gezählt hätte, denn das wäre in seinen Augen einer Bestreitung nicht nur ihres Wahrheitsanspruchs, sondern auch ihrer religiösen Dignität gleichgekommen. Beruhte sie doch auf einer breiten und ehrwürdigen Überlieferung. 4Denn Pontius Pilatus war ja nicht nur eine Gestalt der Bibel und im Glaubensbekenntnis erwähnt. Auch die ältesten Kirchenväter hatten sich mit ihm beschäftigt und damit die Ausformung des Bildes seiner Persönlichkeit im Mittelalter grundgelegt. So behaupteten die christlichen Autoren Justin und Tertullian, Pilatus habe dem Kaiser einen Brief geschrieben, in dem er über Jesu Leben und seine Wundertaten, über den Prozess und Tod sowie die Auferstehung des Heilands berichtet habe. Pilatus wird hier als Zeuge für die Wahrheit der christlichen Verkündigung sowie für die Unschuld Jesu in Anspruch genommen. Die verfolgte Kirche berief sich auf den römischen Amtsträger. Auf der anderen Seite überlieferte der gelehrte Bischof Eusebius von Cäsarea in seiner Kirchengeschichte, dass Pilatus unter der Regierung des Kaisers Caligula ins Unglück geraten sei und sich das Leben genommen habe. Die göttliche Gerechtigkeit habe, so erklärt Eusebius, das Verbrechen am Heiland nicht ungestraft lassen wollen. Im unrühmlichen Untergang des Pilatus bekundet sich für ihn das Walten der göttlichen Vorsehung.
Zwischen diesen beiden Polen, dem günstigen des „Pilatus-Briefs“ und dem ungünstigen des Selbstmord-Motivs, schwankt die Legendenbildung lange. 5Ihr wichtigstes Sammelbecken, aus dem die weiteren Entwicklungslinien abzweigen, ist das apokryphe Nikodemusevangelium aus dem 5. Jahrhundert. Dieses heterogene Konglomerat von Erzählungen rund um die Passion Jesu Christi besteht in einem ersten Teil aus den sogenannten „Acta Pilati“, einem mit zahlreichen wundersamen Begebenheiten ausgeschmückten Bericht über den Prozess vor Pilatus, in dem dieser stärker als in den kanonischen Evangelien als Fürsprecher Jesu auftritt. Hinzu tritt allerdings schon bald eine Reihe von Anhängen, die die Handlung bis zum Selbstmord des Pilatus weiterspinnen. Dabei tritt mit der Zeit immer stärker die Figur der Veronika in den Vordergrund, einer Frau, der man den Besitz eines mit übernatürlichen Heilkräften ausgestatteten Christusbildes zuschrieb. Dieses Bild, das man sich zunächst als Statue vorstellte, gelangt nach Rom, heilt dort den schwer kranken Kaiser Tiberius und motiviert dadurch dessen Bekehrung und seinen Entschluss, die Schuldigen am Tode Jesu zu bestrafen. So kommt es zu Verurteilung und Selbstmord des Pilatus. Pilatus- und Veronikalegende sind deshalb genetisch eng miteinander verbunden und münden in einen Erzählkomplex, der sich mit der Bestrafung der Gottesmörder beschäftigt. Zu diesen gehören neben Pilatus vor allem und in erster Linie die Juden, denen man die Hauptschuld am Kreuzestod Jesu anlastete. Im Anschluss an die Berichte des Historikers Flavius Josephus, jedoch in zuweilen abstoßend blutrünstiger und antisemitischer Überarbeitung, wurden dabei der Jüdische Krieg des Jahres 70 n. Chr. und die Zerstörung Jerusalems als göttliche Vergeltung für den Mord am Heiland dargestellt und zu einem Gesamtbild der unmittelbaren nachbiblischen Geschichte ausgestaltet.
Читать дальше