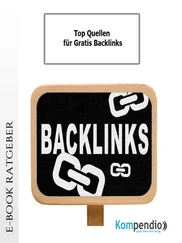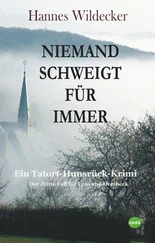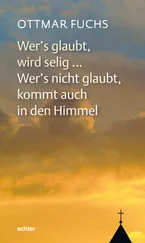Es wäre allerdings ein verhängnisvolles Missverständnis, die hier vorgelegte gnadentheologisch vertiefte Sakramententheologie und Ekklesiologie so zu verstehen, als käme es nicht mehr auf den Glaubensvollzug und das diakonische Handeln an. Hier wird nur in elementarer Weise ernst genommen, dass die Gnade allem Handeln vorausgeht, sowohl in den Symbolhandlungen als auch im sozialen und solidarischen Verhalten der Christen und Christinnen. Das Ganze wäre völlig missverstanden, wenn Gott uns seine Gnade schenkte, damit wir so bleiben, wie wir sind. Die Bibel unterstellt Gott, er habe im Lauf der geschichtlichen Begegnung mit den Menschen gelernt (was selbstverständlich den Lernprozess der Menschen selbst widerspiegelt), dass er mit Zwang und Forderungen nichts bei den Menschen erreichen kann. In der Perspektive des leidenden Gottesknechtes bzw. des Jesus am Kreuz verzichtet Gott völlig auf jede Art von zwingender Herrschaft, um so den Menschen etwas zu schenken, was sie zwischenmenschlich in dieser radikalen Weise nicht erfahren können, nämlich die Bedingungslosigkeit seiner Liebe und damit die Ermöglichung, aus dieser Liebe heraus entsprechend miteinander umzugehen. Gott fordert nicht, was er nicht im Übermaß geschenkt hätte. Befehle und Gesetze allein geben niemals die Kraft, sie in Freiheit zu erfüllen. Gott verzichtet darauf, zum Guten zu zwingen, sondern schenkt dafür die das Gute ermöglichende Gnade.
Es geht hier also nicht um eine billige Stabilisierung der bestehenden Praxis mit einer ebenso billig missverstandenen „Gnadentheologie“, sondern um eine Gnadenerfahrung, in der die Unendlichkeit des göttlichen Geheimnisses bis zur Hingabe unentgrenzter und damit radikalisierter Solidarität zu tragen vermag. Nicht Bestätigung ist die Wirkung, sondern eine Herausforderung, die tiefer geht als jede Aufforderung.
1.7. Vor-Sakramentale Symbolgabe
Wo es keine Sprache mehr gibt, keine Worte, um die Tiefen des Bösen und des Leides eines Geschehens zu begreifen, wo Menschen fassungslos dastehen müssen, hilflos nichts mehr verhindern können, wo es keine Antworten gibt, die beruhigen, wo man sich zugleich weigert, dem Zynismus oder dem Banalismus allzu schneller Antworten und Reaktionen zu erliegen, da öffnet sich die Sehnsucht nach anderen Ausdrucksformen als denen des Wortes und des Gesprächs. Viele Menschen, auch solche, die es sonst nicht tun, begeben sich dann in die religiöse Symbolwelt; zünden Kerzen an und bringen sie an entsprechende Orte des Gedächtnisses, legen Blumen nieder, schreiben Texte, auch wenn sie nicht unbedingt zum Lesen für andere gedacht sind. Es geht um die Verwortung ihrer Trauer und ihres Mitgefühls, darum also, dass sie geschrieben und mit Kerze und Blumen zusammen oder für sich hingelegt werden. Die eigene Ohnmacht und Anteilnahme können sich in dieses Ritual, in dieses symbolische Handeln hinein verleiblichen. Und damit verbindet sich nicht zuerst Reden, sondern Schweigen.
Von der Schreckenssprache des ersten Entsetzens, wenn sie denn verfügbar war, fällt man in die Symbolsprache, von der Aufregung in die Ruhe, die aber keine unangemessene Beruhigung darstellt, sondern in der Ruhe erst die Tiefe des Geschehens zu ertasten sucht. Solche Symbolhandlungen und Gottesdienste gibt es nach katastrophalen Ereignissen, öffentlich und privat. Dass sich die Kirchen mit ihren Räumen und Symbolen absichtslos zur Verfügung stellen, ist ein eigener sakramentaler Vorgang, nämlich kontrafaktisch zur Zerstörung dem Mitleid und der Solidarität Ausdruck zu geben, auch wenn dadurch das Geschehene nicht geheilt werden kann. Auch dies ist eine Art von Kasualpastoral und darf nicht mit der zynischen Vokabel eines kompensatorischen Zeremonienmeisters der Gesellschaft diffamiert werden. In solchen Tagen wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis nach anderen als bisherigen Ausdrucksformen ihrer Existenz und ihrer Gefühle.
So werden die Kirchen ihre angesprochenen Ressourcen immer zur Verfügung stellen. Als Orte, wohin die Menschen sich zusammenfinden können in ihrem Bedürfnis nach Schutz und Heimat in der Situation der Fassungslosigkeit, als Räume, wo andere Ausdrucksmöglichkeiten geschenkt sind als die alltäglichen. Und zugleich werden sie sensibel, unindoktrinierend, aber deutlich das inhaltlich Andere mitbenennen, das diese religiöse Sprache trägt. Denn die kirchlichen Symbole haben nicht nur eine beleihbare Ausdruckskraft, sondern sie haben auch bestimmte inhaltliche Ausrichtungen.
So wird man es auch jenen gönnen, die Christophorus-Plakette im eigenen Auto anzubringen, die ansonsten nicht viel mit Kirche und christlichen Inhalten zu tun haben. Dies ist nicht das Problem. Das Problem liegt in der Verantwortung, die die Kirche auch noch für diese ausgewanderten Symbole hat, insofern sie (z. B. bei Autosegnungen) darauf besteht, dass die Christophorus-Plakette kein Freibrief für rücksichtsloses und menschengefährdendes Fahren ist, sondern dass sich hier der Schutz des eigenen Lebens mit dem Schutz der anderen verbindet. Die Enteignung der Symbole geschieht nicht dadurch, dass sie frei verfügbar sind, sondern sie geschieht erst dann, wenn sie für Handlungen und Positionen benutzt werden, die nicht im Ursprung ihrer Inhalte und der Inhalte des Evangeliums liegen. Ähnliches gilt für die Pastoral der Sakramente, und zugleich hat die Pastoral hier wie dort keine andere Macht als die vertiefte Erfahrung der Gnade. Verweigerungen und Zwänge verschärfen das Problem.
2. Unbedingte Vor-Gegebenheit
2.1. Überbrückende Kraft
Wenn das Verhältnis von Erfahrung und Ritual hinsichtlich der heilenden und erlösenden Zusage ein annähernd korrelatives, analoges und paralleles ist, dann geht es den Menschen gut, dann erleben sie etwas oder vielleicht sogar viel von dem Glück eines Gottes, der es gut mit ihnen meint. Dann wird als Erfahrung gefeiert, was im Ritual gezeigt und symbolisch versprochen wird. Neben dem analogen ist aber auch ein widersprüchliches Verhältnis zwischen Erfahrung und sakramentalem Symbolgeschehen in den Blick zu nehmen. Wenn die „direkte“ Erfahrung nicht mehr mithält, kann der Vollzug des Rituals dennoch wirken, ohne dass es Ritualismus ist. So kann auch in Beziehungen das Alltagsritual wie ein „Geländer“ über Krisenzeiten hinweghelfen, wenn es Blockaden gibt, ein Problem unmittelbar anzusprechen, wenn man also Zeit braucht, um miteinander zurechtzukommen. Dann trägt das Ritual über diese Kluft hinweg. Entsprechend kann sich auch eine Unsicherheit im Glauben durchaus mit der Aufrechterhaltung umso sichererer Rituale bzw. des Gottesdienstbesuchs verbinden.
Es ist, wie wenn man im Ritual einen Brief schreiben würde, von dem man aber nicht so recht glauben kann, dass er ankommt. Gleichwohl beinhaltet die Treue zum Ritual in sich die leise Hoffnung, dass diese formale rituelle Verbindung irgendwie nicht ins Leere geht. Vielleicht auch die Hoffnung, dass über Jahre und Jahrzehnte hinweg dann doch die Chance gewahrt bleibt, dass auch die eigene Gottesbeziehung wieder Leben gewinnt. Wenn man es nicht moralisierend, sondern im Sinne eines tatsächlichen An-Gebotes auffasst, könnte man diese Überlegungen auch als Plädoyer für das Sonntagsgebot verstehen.
Der inhaltliche Sicherheitsverlust wird über die formale Verlässlichkeit aufgefangen mit der Hoffnung, dass darin nach kurzen oder auch langen Durststrecken wieder die inhaltliche Verlässlichkeit aufscheint. Man kann diesen Zusammenhang auch auf der Zeitschiene und damit endzeitlich verstehen. Was das Ritual vergegenwärtigt, ist immer zugleich ein Versprechen, das jetzt in vieler Hinsicht in den Erfahrungen der Menschen noch nicht zuhause ist, sondern auf Hoffnung hin und oft genug wider alle Hoffnung (vgl. Röm 8,24), eine Verheißung, die als etwas erfahren werden darf, was gleichwohl bereits in einer bestimmten Weise gegenwärtige Wirklichkeit ist. Das Ritual wird zum Platzhalter dafür, dass Gott am Ende dieses Äons all das erfahrungsmäßig einlösen wird, und weit über die jetzigen Vorstellungen hinaus, was im Symbolvollzug des Sakraments als „antizipiertes Faktum“, als im Glauben vorweggenommene Zukunftswirklichkeit geschenkt ist. 27Das Sakrament ist der Schwur Gottes, dass seine Liebe den Menschen gegenüber auch kontrafaktisch gilt, geglaubt und gehofft werden darf, ohne sie unmittelbar zu erfahren.
Читать дальше