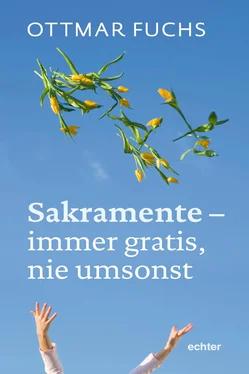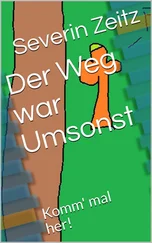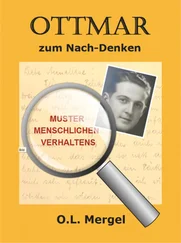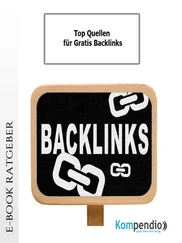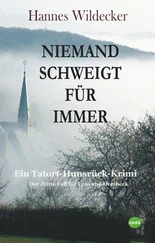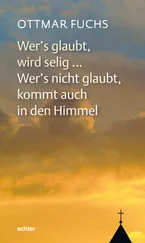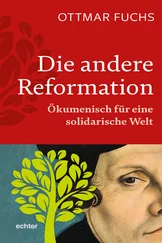und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Sie gingen ins kleinste Café am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.
Ähnlich kann auch ein religiöses Ritual funktionieren: nämlich dass es nur noch funktioniert und das eigentlich damit zu verbindende Leben ersetzt. Dies kann eintreten, wenn der kultische Vollzug einen Versuch darstellt, Gott für die eigenen Belange in Anspruch zu nehmen und damit die Beziehung zu Gott zu zerstören: mit einem Wenndann, das die Beziehung unter Bedingungen stellt. Nach der Ritualforscherin Mary Douglas ist Ritualismus jener Vorgang, in der in einer Gesellschaft die manchmal verunsichernden Erscheinungen unmittelbarer Religiosität (wie etwa in der Ekstase) zugunsten einer gesteigerten Kontrolle durch Rituale unterdrückt werden, die die lebendige Gottesbeziehung, vor allem die der Klage und Anklage, die widerständig ist, durch ein regelgeleitetes Verhältnis ersetzt. 14
Es gibt in der Geschichte von Religionen wie auch in Biographien von gläubigen Menschen eine Abfolge unterschiedlicher Schwerpunkte von „direkter“ Gottesbeziehung und Sakrament bzw. Liturgie, ein Pulsieren zwischen diesen beiden Formen der Transzendenzbeziehung. Und offensichtlich scheint das jeweilige Durchbrechen zur unmittelbaren und aus der eigenen Situation heraus formulierten Begegnung immer auch eine Unterbrechung und Kritik allzu selbstverständlich gewordener oder inhaltlich problematisch gewordener Symbolvorgänge bzw. Rituale zu sein. Dafür steht die biblische Prophetie, die immer wieder die Sicherheit kritisiert, die man mit Ritualen zu erwerben glaubt.
Aus dieser Perspektive kann die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums als Flexibilisierungsschub einer relativ festgefügten Liturgie angesehen werden zugunsten einer persönlichen Erfahrungsbeteiligung an Symbolvorgängen in Richtung auf eine „actuosa participatio“ (aktive Teilnahme bzw. Teilhabe) der Gläubigen. Mit der Liturgiekonstitution ist damit für das Gesamtkonzil etwas eröffnet worden, was alle Texte durchzieht, nämlich das Bestreben, kirchlichen Glauben und die Erfahrung der Gläubigen, Dogma und Pastoral, Liturgie und Leben in einer sich gegenseitig erschließenden Weise aufeinander zu beziehen. 15
1.5. Symbolhandlung als Erfahrung der Gnade
Die relative Vorgegebenheit und Kontinuität des Rituals bildet die „natürliche“ Entsprechung für jene Vorgegebenheit, dass den Menschen die Liebe Gottes geschenkt ist, noch bevor sie diesbezüglich etwas leisten müssten. Diesen Glauben formuliert vornehmlich die Gnadentheologie 16und Rechtfertigungstheologie. In der Lehre der Sakramente gilt das Sakrament demnach als ein von Christus eingesetztes wirksames Gnadenzeichen. 17Zu den anderen, den erzählerischen, bekenntnis- und lehrhaften Eingaben der Tradition, verhält sich das Ritual wie die Energiemitte eines Sterns, in dessen Mitte viele Strahlen, Geschichten und Inhalte münden und aus dessen Mitte viele Strahlen kreativer Geschichten sich zu entfalten vermögen.
Selbstverständlich ist Gott die personale Bedingung und Wirkursache dieses Symbolgeschehens und nicht das Symbolgeschehen selbst. Aber das Symbolgeschehen ist es, das durch sich selbst die Sicherheit dieser Ursache vermittelt. Die „Wirksamkeit“ der Sakramente aus ihrem Vollzug heraus (ex opere operato) bewahrt die Unbedingtheit der Gnade Gottes davor, von der Tätigkeit der empfangenden bzw. spendenden Person ursächlich abhängig zu sein. Was allerdings von der Tätigkeit ursächlich abhängt, sind selbstverständlich die Erfahrung dieser Gnade im eigenen Leben, die sprachliche Formulierung dieser Beziehung und das Innewerden ihrer Wirkmacht. Die katholische Sakramententheologie macht die Gnade nicht vom Glaubenserfolg der Empfänger/innen abhängig. Analog dazu könnte man die Theologie von der Selbstbewegung des Wortes, die nicht vom Verkündigungserfolg abhängig ist, bei Karl Barth auffassen. 18
Leonardo Boff formuliert den Zusammenhang so: „In der christlichen Tradition ist immer behauptet worden, dass die göttliche Gnade unfehlbar in der Realisierung des Sakraments gegenwärtig wird. … Die Gegenwart der göttlichen Gnade im Sakrament hängt nicht ab von der Heiligkeit sei es dessen, der das Sakrament spendet, sei es dessen, der es empfängt. Denn die Ursache der Gnade sind weder der Mensch noch seine Verdienste, sondern einzig Gott und Jesus Christus: … Wenn einmal der sakramentale Ritus vollzogen ist und die heiligen Symbole gesetzt sind, handelt Jesus Christus und kommt in unsere Mitte. Aber nicht kraft der Riten selbst; diese haben ja aus sich selbst nicht die geringste Kraft, sie symbolisieren nur. Sondern auf Grund des Versprechens, das Gott gegeben hat.“ 19Ich würde noch ergänzen, das sich in ihnen verleiblicht, so dass sie zur Repräsentanz dieses Versprechens werden. Ein Gebrauch der Sakramente mit Bedingungen (wenn ich das und jenes tue, dann ist mir Gott gut) ist weder nötig noch möglich, weil das, was mit ihnen als Bedingung geleistet werden soll, längst und auch ohne ihren Vollzug gegeben ist.
1.6. Sakramententheologische Vertiefung
Das durchaus anzustrebende korrelative oder korrespondierende Verhältnis von Symbolhandlung und Erleben oder Verstehen darf nicht zu der Ansicht führen, 20„seine (des Auferstandenen) wirkliche, aber von uns nicht geglaubte Präsenz wäre, banal gesagt, nur die halbe Miete“ 21. Es ist bereits die ganze Miete, ohne die es die in der korrelativen Erfahrung beanspruchte ganze Miete gar nicht gäbe. Und Milliarden von Menschen bedürfen eben nicht der Sakramente, können gut ohne sie leben, und doch erfahren sie Gottes Gnade in ihrem Leben, und doch feiert die Kirche stellvertretend für sie die Sakramente. 22
Es ist gut, nicht allzu schnell den Wechsel von Gott zum Menschen zu vollziehen: Gott bleibt Verursacher und Geber der Gnade und aller Sakramentalität. Der Glaube, was immer darunter genauerhin zu verstehen ist, ist nicht Wirkursache der Gnade, sondern disponierende Ursache für die Erfahrung der Gnade. Was das Sakrament zusagt, ist auch nicht davon abhängig, ob die Menschen das erfüllen, was im Sakrament geschenkt ist, sondern es bleibt auch dann gegeben, wenn dies nicht geschieht. Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte (vgl. Mt 5,25).
So ist auch der Begriff des „unauslöschlichen Merkmals“, das grundlegend mit dem Sakrament der Taufe gegeben ist, auf diesem Niveau zu verstehen: Er sagt aus, dass die göttliche Zusage in diesem symbolischen Akt unverlierbar an ihm haften bleibt und sich beim empfangenden Menschen selbst substantiell auswirkt. Die Zusage bleibt gültig, 23auch kontrafaktisch, also im Gegensatz zur Tatsächlichkeit, sollte der Mensch diese Zusage vergessen oder ihr nicht gerecht werden. Gott selbst hat sich an dieses Garantiezeichen seiner Treue gebunden.
Auch der sog. Taufscheinchrist bleibt dann ein für allemal in der Liebe Gottes und fällt nie aus ihr heraus: „Gott ruft sakramental den Menschen ganz persönlich und zugleich als Glied der Gemeinde Jesu an, und zwar in schöpferischer Weise, damit der Mensch im Glauben darauf antwortet. Gibt der Mensch seine Antwort nicht in der geschuldeten Glaubenshingabe, so zieht Gott seinen wirksamen Anruf doch nicht zurück, die neue Chance und Aufgabe bestimmt den Menschen bleibend als unauslöschliches sakramentales Siegel.“ 24Dessen dürfen die Gläubigen im Vertrauen auf dieses Versprechen Gottes sicher sein. 25
Genau dies spüren die Menschen, die „nur“ zu besonderen Fällen zur Kirche kommen, vor allem zu den Sakramenten Taufe, Firmung und Eheschließung. Man nennt diese Pastoral, vom Lateinischen „casus“ für „Fall“, Kasualpastoral und deshalb diejenigen, die nur aus diesem Grund kommen, Kasualienfromme. 26Diese Menschen ahnen, dass in den Sakramenten eine Vorgegebenheit Gottes auf sie zukommt, auf die sie gewissermaßen ein „Anrecht“ haben, nicht weil sie das Recht selbst besäßen, sondern weil es ihnen von Gott geschenkt ist. Sie reagieren rechtfertigungstheologisch und ekklesiologisch „richtig“, wenn sie die Sakramente als Außenbezug der real existierenden Kirche beanspruchen, um mit ihnen in ihre Lebensräume hinein den Kirchenbegriff mit sich selbst zu erweitern. Auch wenn sie kirchensoziologisch (sozialgestaltbezogen) nicht dazugehören, gehören sie (sakramenten- und darin gnadentheologisch) zur Kirche, zum „Leib Christi“ (1 Kor 12,27).
Читать дальше