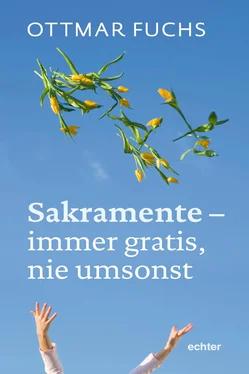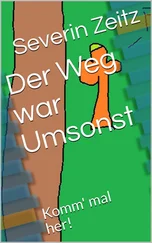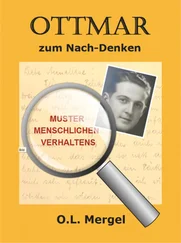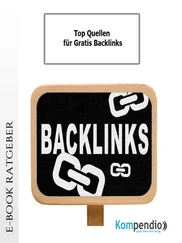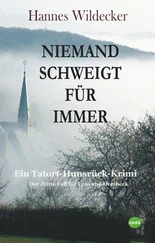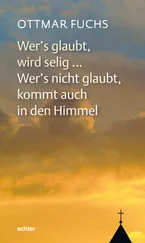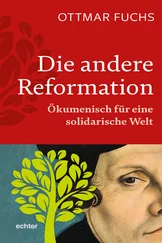1.3. Entlastung im göttlichen Geheimnis
Die Sehnsucht nach Sicherheit und Wertschätzung ist tief im Menschen angelegt. Was Menschen im Laufe ihres Lebens in Bezug auf diese Sehnsucht erfahren oder nicht erfahren, bestimmt viele ihrer Entscheidungen. Im religiösen Bereich ist der Glaube an eine Transzendenz unseres Lebens, also an eine handlungsfähige Wirklichkeit uns selbst gegenüber, die zugleich unendlich mehr und größer als wir selber ist, eine wichtige Erfüllungsform dieser Sehnsucht.
Nicht umsonst heißt das hebräische Wort für Glauben „‘aman“ in seiner Grundbedeutung „sich festmachen“, also hier sich festmachen in Gott bzw. in dem, was als Gegenwart Gottes in der eigenen Geschichte erlebt wird. Glauben bedeutet nicht nur von dieser Wortbedeutung, sondern von den in der Bibel erzählten Geschichten her, dass sich Menschen in Gott festmachen, dass sie seinen Verheißungen trauen. Basis dieses Vertrauens ist ein Gott, der die Menschen in ihrem Leben, in ihrem Hoffen und Leiden nicht klein macht, sondern anerkennt, der sie für wert hält, mit ihnen zu kommunizieren, sie zu geleiten und zu retten. Eine Transzendenz also, die das menschliche Leben als eigene und zu sichernde Wirklichkeit anerkennt, die letztlich nicht vernichtet, sondern ins Leben holt. Die biblische Schöpfungstheologie ist ein Niederschlag dieses Gewolltseins von Gott her, so dass man auch die eigene Existenz in Gottes Wunsch, dass der Mensch lebt und am Leben bleibt, vertrauensvoll festmachen kann.
Nicht nur in der biblischen Religion gibt es vor allem zwei Wege, die vornehmlich die Beziehung mit Gott in den Blick nehmen: einmal die „direkt“ im Wort gefasste Begegnung mit Gott (im Gebet, in Berufungserfahrungen usw.), zum anderen den kultischen bzw. liturgischen Gottesdienst, wobei sich beide durchaus überlappen können. Der direkten Frömmigkeit von Einzelnen bzw. des ganzen Volkes steht die Welt der Feste und Rituale gegenüber, in der Bibel vor allem des entsprechenden Tempelkultes und des Sabbats.
– Ein Blick in die Psalmen zeigt, dass die Aufnahme einer direkten Gebetsbeziehung mit Gott sehr viel Kraft, Zeit und Mühe kostet. Je problematischer die eigene Situation gesehen wird, desto schwieriger ist der Formulierungsaufwand, irgendwie wieder in die Beziehung zu Gott hineinzukommen. Die Klagepsalmen machen diesen Aufwand sehr deutlich: in der eingeholten Erinnerungsarbeit an die Väter, in der ausgiebigen Schilderung der eigenen Situation, in der intensiven aktuellen Gottesbeziehung als Konflikt und am Ende als Lobpreis seiner Rettung versprechenden Nähe (vgl. besonders Psalm 22).
– Von dieser „unmittelbaren“ Beziehungsarbeit gibt es einen Vermittlungsweg in das Ritual, nämlich wenn solche Gebete eine geprägte Fassung bekommen und als mündliche und/oder schriftliche Gebetsvorlage dienen. Diese erste Ritualisierung einer ursprünglichen Beziehung zwischen Mensch und Gott hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich dass sie die Beziehung von dem Druck entlastet, sie permanent neu sprachlich herstellen zu müssen. Es handelt sich um eine sprachlich vorgegebene Beziehung, auf die sich die Gläubigen einlassen und die sie für sich verwenden können.
– Im Symbolhandeln des Rituals (eines Opfers im Tempel in Jerusalem, des Paschamahls bzw. des Herrenmahls) erfährt diese Vorgegebenheit ihre dramatisierte Fassung. Wie sie ausgeführt wird, muss nicht neu erfunden werden, sondern sie wird in ihrer Vorgegebenheit vollzogen. Und in dem Maß, in dem sich die Gläubigen in ein solches Ritual hineinbegeben und es mit vollziehen und mitfeiern, haben sie Anteil an der darin gefeierten und zugleich vitalisierten Beziehung zur „Transzendenz“. Das Ritual beschenkt die Gläubigen mit einer Wirklichkeit, die sie nicht selbst zu gewährleisten und zu sichern haben. Vielmehr ist die Beziehung im symbolischen Geschehen selber gesichert.
– Hinzu kommt bei Ritualen ihr Vollzug in sogenannten performativen Sprechhandlungen. Was man spricht, das vollzieht sich im Sprechen selbst. „Ich taufe dich …“: Was gesagt wird, wird im Ritus vollzogen.
– Entscheidend ist auch, dass es eine Gemeinschaft bzw. Tradition gibt, die die rituelle Handlungsform begegnungsfähig hält. Sie schafft einen einbettenden Raum, in dem das Ritual die in ihm ausgesprochene lebendige Bedeutung auch tatsächlich hat und sich entsprechend auszuwirken vermag. Im Ritual kreuzen sich von daher ein kultischer Kern und eine erzählerische Deutung.
– Rituale können aus ihrer wiederholbaren Tiefe heraus immer wieder Phantasie und Kreativität anregen, weil sie letztlich nie restlos verstanden werden können. Es bleibt ein Überhang an Vor-Gegebenheit im Symbolbereich, dem nicht immer und nicht alle Erfahrungen hinreichend entsprechen (können). Gewissermaßen laufen die Symbolvollzüge auch den Erfahrungen davon, gerade weil sie aus der Vergangenheit heraus vorgegeben sind.
– Ein charakteristischer Aspekt vieler Rituale ist ihr liminaler, also grenzenberührender bis grenzenüberschreitender Charakter. Denn sie überbrücken aufbrechende Risse in Leben und Gemeinschaft, wie den Übergang von der Gesundheit zur Krankheit, vom Glück zum Unglück, vom Leben zum Tod, von der Kindheit zum Erwachsenensein usw. Diese besonderen „Rites de passage“ sind aber zu unterscheiden von dem prinzipiell schwellenüberschreitenden Charakter von Ritualen, insofern sie alle die Schwelle zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit überbrücken, also in dieser Hinsicht ganz bestimmte Passagen vom Sichtbaren und Handgreiflichen in die dahinterliegende Transzendenz eröffnen. 13
1.4. Spannung von Erfahrung und Symbolgeschehen
Man kann das relativ konstante, wenn auch kulturell unterschiedlich ausgeprägte prekäre Verhältnis von „unmittelbarer“ Begegnung und Ritualisierung auch mit Alltagsbeziehungen vergleichen. Wenn Beziehungen, Beziehungen der Freundschaft und der Liebe, noch im Anfangsstadium sind, ist die gegenseitige, ins Wort gebrachte Sehnsucht nach Vergewisserung noch sehr groß. Intensive und verlässliche Beziehungen der Freundschaft und der Liebe gelangen aber zu jener Reife, in der das gegenseitige Vertrauen nicht in jedem Augenblick vergewissert werden muss, sondern vorausgesetzt werden kann als etwas in der Beziehung dauerhaft Gegebenes, das man nicht in jeder Stunde neu zu machen hat. So kann man/ frau dann auch in Schweigen beieinandersitzen und dies als tiefe Beziehung erfahren. So ergeben sich Eigenrituale solcher Beziehungen in ganz bestimmten Gesten und sprachlichen Kurzformeln bzw. Symbolen, deren Bedeutung und Tiefe für die Beziehung vorausgesetzt wird und nicht eigens formuliert sein muss.
Gerade dieses Beispiel kann aber auch eindrücklich deutlich machen, wie ambivalent die Ritualisierung von Beziehung sein kann, wenn sie die Oberhand gewinnt und überhaupt nicht mehr die unmittelbare Vergewisserung der Beziehung zulässt bzw. Konfliktgespräche verdrängt. Gab es im Anfang der Beziehung einen Vergewisserungszwang, so kann es später einen Ritualzwang geben, um das Problem der beiderseitigen erneuten Vergewisserung zu meiden. Dann gibt es irgendeinmal den Augenblick, dass man/frau feststellen muss, dass der Beziehung die eigene vitale Basis abhandengekommen ist. Erich Kästner hat diesen Augenblick in einer eindrucksvollen Weise (1928) in dem Gedicht „Sachliche Romanze“ festgehalten:
Sachliche Romanze
Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut)
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
Sie waren traurig, betrugen sich heiter
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wussten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.
Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er sagte, es wäre schon Viertel nach vier
Читать дальше