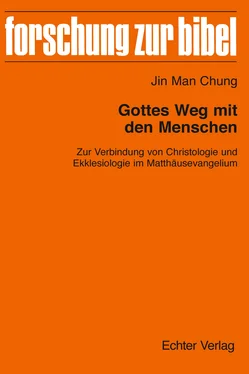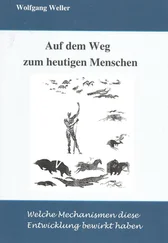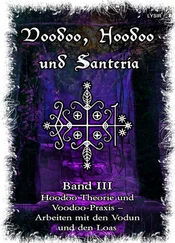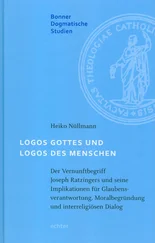Ergebnis und Ausblick
Die aktuelle Ausrichtung der Bibelexegese zeigt eine mittlerweile stark synchrone Orientierung. Das heißt nicht, dass die herkömmlichen Methoden in der Auslegung des Evangeliums bedeutungslos geworden wären. 53Der neue Trend der Bibelexegese verzichtet auf die eindeutige Trennung von Diachronie und Synchronie, versucht vielmehr in vielfältiger Weise 54beide in ein kommunikatives Beziehungsverhältnis zu setzen. Auch für die Kennzeichnung der Theologie des Matthäus wird nicht ein methodisches Instrumentarium gebraucht, sondern eine Integration beider exegetischer Zugangsweisen von Diachronie und Synchronie bevorzugt. Es bleibt aber umstritten, inwiefern dieser integrative Ansatz im Textfeld zugänglich ist und durchgeführt werden kann.
Die vorliegende Arbeit gewährt der narrativen Analyse eine wichtige exegetische Position, weil ihre Grundlinie sich orientiert an der Erzählung. Der Weg Gottes mit den Menschen wird im Rahmen des Evangeliums erzählerisch entfaltet. Die Erzählung wird zumal in die matthäische Tradition eingeordnet, weil gerade die Verbindung des Weges Jesu mit dem seiner Jünger untersucht werden soll. Die Erzählung wird konsequent auf den Jünger bezogen, von dem erzählt wird. Es handelt sich um die qualifizierte Wirkung Jesu, die in die Kirche ausstrahlt, aber vom bestimmenden Anfang her erschlossen werden soll.
1.2.2 Zu den Themen
In der Matthäus-Forschung ist das Kirchenverständnis ein wichtiges Thema. 55Eine Reihe von Aufsätzen und Monographien untersucht, welche Bedeutung ἐκκλησία (Mt 16,18; 18,17) bei Matthäus hat. Sie setzen sich mit der Fragestellung auseinander, wie sich die Kirche und Israel zueinander verhalten und wie in dieser Beziehung das Volk Gottes bestimmt ist. Das Verhältnis des Matthäus zum Judentum und sein Missionsverständnis sind dafür entscheidend. Ein Schwerpunkt ist die Darstellung der Jünger als Nachfolger Jesu; die „Jünger“ (μαθηταί) sind nach Matthäus für die nachösterliche Gemeinde die wichtigsten Identitätsfiguren (vgl. z. B. Mt 18,1-35). Sie sollen nach dem Sendungsauftrag des Auferstandenen zu seiner Nachfolge aufrufen und zur universalen Mission aufbrechen (vgl. Mt 28,16-20). Aber die Untersuchungen zum matthäischen Kirchenbild bleiben unzureichend, wenn die Begründung in der Christologie 56nicht genau beachtet wird. Matthäus spricht in seinem Evangelium keineswegs von der Kirche im Allgemeinen, sondern von der Kirche, die Jesus begründet hat (vgl. Mt 16,18). Die Jünger folgen dem Nachfolgeruf Jesu und partizipieren an seiner messianischen Sendung, so dass sie Jesu Person und Wirken repräsentieren. Die ekklesiologischen Elemente müssen auf der Grundlage der Christologie bestimmt werden.
Die Kirchenvorstellung des Matthäus ist mit der Ethik untrennbar verbunden. Dies ist für die christologische Begründung der Ethik nicht unwichtig – allerdings bereits untersucht, so dass diese Spur in dieser Studie nicht eigens verfolgt zu werden braucht. Durch Identifizierung der nachösterlichen Gemeinde mit den Jüngern wird Jesu Lehre in der Geschichte weitergetragen, welche sich in den großen Redekompositionen, besonders in der Bergpredigt (Mt 5-7), inhaltlich-sachlich entfaltet; sie orientieren das menschliche Handeln am „Willen des Vaters“ (Mt 7,21; 12,50), so dass jene, die Jesus nachfolgen, den „Weg der Gerechtigkeit“ (Mt 21,32) nicht verfehlen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn verfehlen, wenn sie die „überfließende Gerechtigkeit“ (Mt 5,20), die Jesus lehrt, nicht erkennen. Die Matthäus-Exegese erforscht die Bergpredigt als Programmtext der Ethik Jesu, um den Jüngern (und der christlichen Gemeinde) das wahre Ethos der Nachfolge als Norm zu vermitteln. 57Für die Bildung der Gemeinde sind die ethischen Weisungen Jesu verbindlich. Sie verdanken sich dem (alttestamentlichen) Gesetz. Dieses wird in göttlicher Vollmacht ausgelegt (vgl. Mt 5,17-20). So liefert die Christologie des Matthäus den Schlüssel zum Verständnis des Gesetzes und damit zum Leben der Kirche. Allerdings ist die Forschung kontrovers. Zur Diskussion steht die Grundfrage nach der Übernahme oder Ablehnung der Tora, ihrer Verbindlichkeit oder Ablösung. 58
Offenbar ist die Christologie das Fundament des Matthäusevangeliums. Die matthäische Theologie ist von der Überzeugung bestimmt, Jesus als der Sohn Gottes sei der erwartete Messias, der die Heilsverheißung Gottes erfüllt. 59Die Christologie hat somit einen herausragenden Stellenwert im Matthäusevangelium. Die Matthäusforschung beschäftigt sich dagegen aber mehr mit dem matthäischen Schlusstext (Mt 28,16-20) 60und den christologischen Titeln (z. B. der Gottessohn, der Menschensohn) 61als mit der narrativen Struktur der Jesusgeschichte im gesamten Evangeliumszusammenhang. 62Wie Donald Senior hervorhebt, „one should view the whole narrative and its impact on the reader as the medium for communicating Matthew’s theology“ 63. Er versteht die Christologie als „the summation of the meaning it assigns to the life, ministry, destiny, and person of Jesus“ 64. Die Exegese steht also vor der Herausforderung, dieses thematische Defizit in der matthäischen Forschung aufzuarbeiten.
Die vorliegende Arbeit widmet sich weder allein der Ekklesia-Thematik noch der Christologie, sondern setzt sich darüber hinaus mit der theologischen Fragestellung auseinander, wie Christologie und Ekklesiologie im Matthäusevangelium miteinander verbunden sind. In diesem Forschungsfeld gibt es Ansätze, die aber unterschiedliche Perspektiven und Akzentuierungen zeigen.
Günther Bornkamm
In einem redaktionsgeschichtlich programmatischen Beitrag „Enderwartung und Kirche im Matthäus-Evangelium“ (1956) 65zeigt Günther Bornkamm den Zusammenhang von Eschatologie, Ekklesiologie und Christologie auf. Er setzt dabei voraus, Matthäus habe die urchristliche Überlieferung, also die literarischen Quellen, so sorgfältig und planmäßig bearbeitet, dass seine theologische Konzeption anhand dieser Veränderungen dargestellt werden kann. Als Kennzeichen des Matthäusevangeliums gelten u. a. die Redekompositionen; aus ihrer Analyse ergebe sich, dass das Kirchenverständnis des Matthäus von der Erwartung des kommenden Gerichts geprägt sei. Die matthäisch spezifische Komposition zeige also eine „eigentümliche Verbindung von Enderwartung und Kirchengedanken“ 66. Die Klammer zwischen beiden bestehe „im Verständnis des Gesetzes und damit der neuen Gerechtigkeit, die die Jünger Jesu von Pharisäern und Schriftgelehrten unterscheidet, zugleich aber der Maßstab ist, nach dem die Glieder der Kirche selbst von dem kommenden Richter erst gerichtet werden“ 67. Das Matthäusevangelium entstand laut Bornkamm im jüdischen Milieu, sein Gesamtentwurf zeige damit eine stark jüdische Ausprägung. Vor diesem Hintergrund sei das Gesetz nicht unwichtig, um den jüdischen Charakter des Evangeliums zu bezeichnen. Nach Bornkamm versteht Matthäus das Gesetz nicht im Gegensatz zum Judentum, sondern „stellt sein Gesetzesverständnis bewusst in die jüdisch-schriftgelehrte Tradition“ 68. Die Frage nach der rechten Gesetzesauslegung sei aber strittig. Matthäus polemisiere gegen das Konzept der Gesetzesauslegung und die Diskrepanz zwischen Lehren und Tun bei den Gegnern Jesu. Er gewinne damit „sein radikales Verständnis des Gesetzes, indem er es sub specie principii , im Licht des in der Schöpfung kundgewordenen Willen Gottes, aber erst recht sub specie iudicii, im Sinne des universalen Weltgerichtes versteht, dem alle und gerade auch die Jünger entgegengehen“ 69. Diese konsequente und radikale Rezeption des Gesetzes bestimme das Kirchenverständnis bei Matthäus, sie sei aber in seiner Christologie begründet. Im Matthäus-evangelium erscheine Jesus als ein zweiter Mose, dessen Geschichte von der Erfüllung des Gesetzes (Mt 5,17) bestimmt wird. Seine messianische Würde werde von der Autorität der Schrift ausgewiesen.
Читать дальше