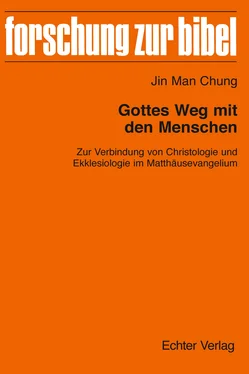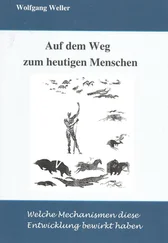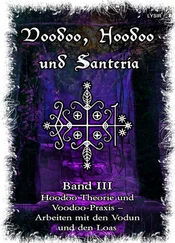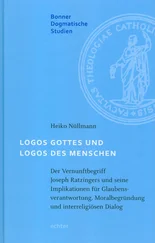Jin Man Chung - Gottes Weg mit den Menschen
Здесь есть возможность читать онлайн «Jin Man Chung - Gottes Weg mit den Menschen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gottes Weg mit den Menschen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gottes Weg mit den Menschen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gottes Weg mit den Menschen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Gottes Weg mit den Menschen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gottes Weg mit den Menschen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1.1.2 Die Problematik des Themas
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Christologie und Ekklesiologie ist prekär, nicht nur, weil gegenwärtig in vielen Regionen die Kirchenbindung schwindet und das Christusbekenntnis in der Öffentlichkeit verblasst. Entscheidend ist vielmehr, dass sich ein theologisches Grundproblem stellt, das nicht ohne Weiteres aufzulösen ist. Die katholische Theologie betont traditionell die Kooperation zwischen Jesus und der Kirche 6– nicht als gleichberechtigte Partner, die einander ergänzen, aber als Wirken Jesu durch die Kirche. Die Kirche ist keineswegs mit Jesus gleichzusetzen; Jesus ist aber in der Kirche wirksam gegenwärtig. Die Kirche kann nur ein Werkzeug Gottes bei der Vermittlung des göttlichen Heils für die Menschen sein; aber ihr Wesen und ihre Sendung ist es, dieses Sakrament zu sein. Mit Anspielung auf die Deuteropaulinen schreibt Walter Kasper : „Durch die Kirche und in ihr bezieht Gott in Christus das All in sein Pleroma ein.“ 7Bei der Betonung der untrennbaren Verbindung zwischen Jesus und der Kirche in der katholischen Ekklesiologie bleibt aber die Frage nach dem qualitativen Unterschied zwischen Jesus, dem Erlöser, und der Kirche, der Gemeinschaft der auf Hoffnung hin Erlösten, der gerechtfertigten Sünder, notorisch unbestimmt. Ohne die Differenzierung würde aber ein ekklesialer Triumphalismus herrschen, der blasphemisch wäre.
Die evangelische Theologie betont demgegenüber traditionell die Differenz zwischen Christus und der Kirche 8– nicht als Gegensatz, aber in der Weise, dass die Kirche gerade das „extra nos“ des Heiles bezeuge. Eine Heilswirksamkeit der Kirche wird damit nicht ausgeschlossen. Aber der Fokus liegt angesichts des Christusbekenntnisses, das, wenngleich im Kern identisch, geschichtlich bedingt und zeitlich variabel ist, beim Wirken des Heiligen Geistes in den einzelnen Gläubigen. Bei der Betonung der Differenz zwischen Christus und der Kirche bleibt die Frage nach der qualitativen Verbindung in der evangelischen Theologie notorisch unterbestimmt. Ohne die Verbindung würde aber ein Individualismus herrschen, der die gemeinschaftsstiftende Funktion des Glaubens unterschätzt und damit ihn selbst halbiert.
Die spezifisch konfessionellen Differenzen können im Rahmen einer Matthäusexegese nicht rekonstruiert und transformiert werden. Sie zeigen aber die Zusammenhänge und Hintergründe, die in die Matthäusforschung hineinspielen und mit denen sich die Auslegung des Matthäusevangeliums theologisch befassen muss. Die Aufgabe besteht darin, das Verhältnis zwischen Christologie und Ekklesiologie differenziert zu bestimmen, so die essentielle Differenz ebenso wie den essentiellen Zusammenhang zu erhellen.
1.1.3 Das Beispiel des Matthäusevangeliums
Das Matthäusevangelium ist eine wegweisende Reflexion über die Sendung der Kirche in der Nachfolge Jesu. In der systematischen Theologie wird die matthäische Theologie in ihrem spezifischen Profil kaum je reflektiert. Daraus, dass der Evangelist Matthäus unter den Evangelisten als einziger den Begriff ἐκκλησία (Mt 16,18; 18,17) 9verwendet, lässt sich aber das besondere Interesse dieses Evangeliums an der „Kirche“ erkennen. Die ekklesiologische Konzeption des Evangeliums orientiert sich an der Jüngerschaft. Die „Jünger“ sind bei Matthäus nicht nur eine historische Größe in ihrer Beziehung zu Jesus; indem sie den vorösterlichen Nachfolgekreis Jesu bezeichnen, gehen sie vielmehr über „eine geschichtliche Kontinuität “ 10mit der nachösterlichen Kirche hinaus. Matthäus verbindet mittels des Missionsauftrags des Auferstandenen (Mt 28,18-20) den vorösterlichen Jüngerkreis mit dem nachösterlichen, so dass die Jünger als „ Ausdruck einer inhaltlichen Programmatik “ 11den erweiterten Horizont für die Glaubensgeschichte der Kirche öffnen. Sie repräsentieren die Kirche, die Jesus selbst gebaut hat (vgl. Mt 16,18), „ihre Darstellung ist transparent für die Gegenwart der Gemeinde (Mt 18,1-35)“ 12. Die vorösterliche Jüngerschaft hat nach Matthäus eine fundamentale Bedeutung für die Kirche durch die Mission, wie der österliche Missionsbefehl abschließend bekräftigt: „Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe“ (Mt 28,20). Die Jünger werden nach dem Matthäusevangelium vorösterlich für ihre nachösterliche Aufgabe befähigt, indem sie von Jesus lernen. Sie sind die (ersten) Adressaten der Lehre Jesu. Sie haben die fünf großen Reden, die von Matthäus zusammengestellt sind (Bergpredigt [Mt 5-7], Aussendungsrede [Mt 10], Gleichnisrede [Mt 13], Gemeinderede [Mt 18], Gerichtsrede [Mt 24f.]), als „Grundlage für die Existenz in der Nachfolge und der Nachfolgegemeinschaft“ 13gehört und – jedenfalls im Ansatz – so verstanden (Mt 13,51), dass sie andere lehren können.
Die Ekklesiologie ist bei Matthäus in der Christologie begründet (vgl. Mt 16,18). Ohne Jesus gäbe es die Kirche nicht. Die Christologie ist bei Matthäus so entwickelt, dass die Schnittstelle zur Ekklesiologie deutlich wird. Besonders hervorgehoben ist im Matthäusevangelium die Immanuel-Christologie. Έμμανουήλ (Mt 1,23 [Jes 7,14]) ist ein Hapax legomenon des Neuen Testaments, im Matthäusevangelium stark betont. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der christologischen Kennzeichnung des Irdischen, sondern erweist sich auch darin, dass es einen Bogen schlägt zu dem letzten Wort des Auferstandenen (Mt 28,20), so dass es zum Schlüsselwort für das ganze Evangelium wird. 14Das Matthäusevangelium veranschaulicht Jesus als den Immanuel, dessen Geschichte sich als Konsequenz der bleibenden Verheißungstreue und des immerwährenden Beistandes Gottes erweist. Mit der Geburt des Immanuel (Mt 1,23) erfüllt sich die Heilszusage Gottes, die ihren genuinen Ort in Israel hat, von Matthäus aber so transformiert wird, dass sie für die Zustimmung aller Völker offen ist. Gott ist in seinem Volk gegenwärtig; Jesus ist Gottes Gegenwart bei seinem Volk auf dem Weg durch die Geschichte. So ist Jesus – als Immanuel – die leibhaftige Bestätigung der Verheißungstreue Gottes. Der nachösterliche Missionsauftrag des Auferstandenen garantiert der Kirche unter allen Völkern die Treue Gottes: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20). Das Matthäusevangelium bezeugt nicht nur eine historische Erinnerung des Evangelisten (und seiner Traditionen), sondern weist die durch den Immanuel fortbestehende Verheißungstreue Gottes auf und die darin begründete Verwurzelung der Ekklesia in Israel.
1.2 Der Stand der Forschung
Die unverkennbare Bedeutung sowohl der Immanuel-Christologie als auch der Jüngerthematik im Matthäusevangelium hat zahlreiche Einzelstudien hervorgerufen. Es gibt auch verschiedene Ansätze, beides miteinander zu verbinden, aber meist unter methodischen Voraussetzungen, die nicht mehr dem Stand der Forschung entsprechen, und nur unter speziellen Aspekten, speziell ethischen, aufgezeigt werden. Die relevanten Einzelstudien müssen unter methodischen und thematischen Gesichtspunkten sorgfältig reflektiert werden, damit der Ausgangspunkt der vorliegenden Studie genau bestimmt werden kann.
1.2.1 Zur Methodendiskussion
Die Methodenfragen schlagen auf die inhaltliche Erschließung des Zusammenhanges zwischen Christologie und Ekklesiologie durch. Je nach der Untersuchungsperspektive, die sie wählen, treten der historische Ort, die geschichtliche Wirkung oder die literarische Form des Evangeliums vor Augen.
Redaktionsgeschichte
Eine größere Aufmerksamkeit für die matthäische Theologie ist in der historisch-kritischen Exegese erst durch die Redaktionsgeschichte geweckt worden. Die redaktionsgeschichtliche Methode hat u. a. Willi Marxsen (1919-1993) 15in die Evangelienforschung einbezogen. Er erprobte die redaktionskritische Arbeitsweise programmatisch am Markusevangelium, um besonders die markinische Eschatologie unter dem Gesichtspunkt der Zeitgebundenheit dieses Evangeliums hervorzuheben. Das Arbeitsgebiet der redaktionsgeschichtlichen Exegese wurde dann auf die übrigen Evangelien sowie die Apostelgeschichte erweitert. Für die Exegese des Matthäusevangeliums war Günther Bornkamm (1905-1990) 16wegweisend. Die von ihm gewählte Methode setzten u. a. Wolfgang Trilling (1925-1993) 17, Georg Strecker (1929-1994) 18und Reinhart Hummel (1930-2007) 19fort. In der redaktionsgeschichtlichen Matthäus-Forschung gibt es allerdings stark divergierende Positionen. Einerseits markieren Bornkamm und Hummel einen judenchristlichen Standort des Matthäusevangeliums. Der Evangelist Matthäus habe als Judenchrist eine große Nähe zum Judentum gehabt; er schreibe das Evangelium mit einem stark jüdischen Akzent; seine primären Adressaten seien judenchristliche Gemeinden. Andererseits interpretieren Trilling und Strecker das Matthäusevangelium als eine heidenchristliche Schrift. Für sie gehört die matthäische Gemeinde nicht mehr zum Judentum. Matthäus distanziere sich eindeutig vom Judentum ( Trilling ) und bearbeite judenchristliche Traditionsbestände mit hellenistischen Elementen ( Strecker ), um so das Heidenchristentum zu erreichen. Beide konträren Positionen sind für das Verhältnis von Christologie und Ekklesiologie ebenso voraussetzungs- wie folgenreich. Deshalb muss es – mit heutigen Methoden – neu bestimmt werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gottes Weg mit den Menschen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gottes Weg mit den Menschen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gottes Weg mit den Menschen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.