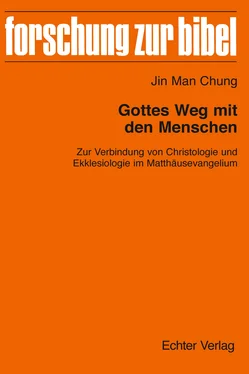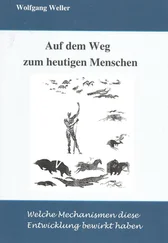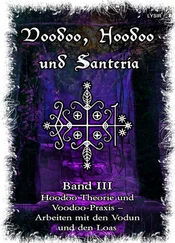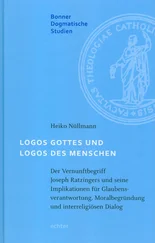Die Fülle christlicher Aussagen werde, so Bornkamm , nicht schon mit einer Reihe von ekklesiologischen Begriffen und Motiven ausgeschöpft. Aber es sei möglich, dass die Jüngerschaft die Messianität Jesu und seine Lehre vertrete. Der „Jünger“ habe im Matthäusevangelium nicht dieselbe Position wie der Schüler eines jüdischen Lehrers. Seine Identität werde von der Berufung in die Nachfolge und der Beauftragung zur Verkündung der Gottesherrschaft (Mt 10,7) und zur Lehre der Gebote Jesu (Mt 28,20) begründet. Die nachösterliche Jüngerschaft stehe mit Jesus nicht so in Verbindung, wie man in Verbindung mit einem Rabbi der Vergangenheit verbunden sein könne, sondern werde von der Beistandszusage des erhöhten Kyrios begleitet (Mt 28,20; vgl. 18,20). Das Kirchenverständnis des Matthäus habe auf diese Weise in der Christologie seine Entsprechung und Begründung (vgl. Mt 16,17-19 im Kontext von 16,13-28).
Auswertung: Bornkamms Untersuchung, die redaktionsgeschichtlich angelegt ist, zeigt großes Interesse am matthäischen Kirchenbild. Die Kirche ist eschatologisch ausgerichtet, wie die spezifisch matthäischen Redekompositionen ausweisen. Sie richtet ihren Blick auf den letzten Tag, wobei die Gerechten sich von den Ungerechten nach dem Maßstab der „besseren Gerechtigkeit“ (Mt 5,17-19) unterscheiden werden. Das Gesetz kommt durch die messianische Lehre Jesu zur Geltung. Jesus bestimmt gleichzeitig das Wesen der Kirche mittels seiner vor- und nachösterlichen Verbindung zur Jüngerschaft. Bornkamm arbeitet das Verständnis der Kirche bei Matthäus im eschatologischen und christologischen Zusammenhang heraus. Demgegenüber wird in dieser vorliegenden Studie die Aufmerksamkeit in erster Linie auf die direkte Verbindung von Christologie und Ekklesiologie gerichtet. Die Eschatologie wird nicht in direkter Verbindung zur Ekklesiologie behandelt, sondern ist in die christologische und ekklesiologische Themendarstellung mit einbezogen. Ihre große Bedeutung im Matthäusevangelium (z. B. Mt 24-25) ist aber keineswegs zu unterschätzen.
Georg Strecker
Die Habilitationsschrift von Georg Stecker „Der Weg der Gerechtigkeit“ (1962) hat neben dem einleitenden Teil zwei Hauptteile, nämlich einen christologischen und einen ekklesiologischen. Diese klare Arbeitsgliederung zeigt an, dass Strecker für die theologische Konzeption des Evangelisten den Fokus insbesondere auf die Christologie und Ekklesiologie richtet. Beide Perspektiven sind davon geprägt, dass er Matthäus in der Darstellung Jesu eine historisierende Tendenz zuschreibt, deren theologische Qualität bei Strecker in Verbindung mit der Eschatologie und der Ethik gewonnen wird; so entstehe eine Vorstellung von Heilsgeschichte.
Strecker hebt hervor, das Evangelium sei „als Darstellung des Lebens Jesu seinem Wesen nach primär christologische Aussage“ 70. Seine Untersuchung widmet sich daher zunächst – und umfänglich – der Christologie des Matthäus, die dann durch die historischen und die eschatologischen Bezüge herausgestellt wird. Nach Strecker deutet Matthäus unter der Bestimmung einer Historisierungstendenz seine Christologie historisch, wie es sich in der Zeitanschauung, den geographischen und den sachlichen (Israelthematik und Jesus als Davidssohn) Vorstellungen zeigt 71. Er hebe die Zeit Jesu als einen einmaligen Ausschnitt aus der Vergangenheit hervor. Er blicke von seiner Gegenwart auf den besonderen Zeitabschnitt Jesu in der Vergangenheit. Er zeichne eine kontinuierliche Linie von der Geburt bis zum Tod und zur Auferstehung, um der Biographie Jesu den historischen Charakter zu verleihen. Seine christologische Aussage als „ein der Vergangenheit angehörendes, zeitlich und räumlich fixierbares ‚Objekt‘“ 72schließe jedoch nicht mit einem in sich geschlossenen Teil des Zeitablaufes, sondern deren Deutungshorizont werde dadurch erweitert, dass einerseits die Geschichte Israels als eine Vorgeschichte des Evangeliums vorgestellt (Mt 1,1-16) wird und andererseits eine neue Epoche, die Zeit der Kirche und ihrer Mission, nach der Auferstehung angedeutet ist (Mt 28,16-20). Der Zeitabschnitt des Lebens Jesu habe auf der historischen Ebene eine besondere Bedeutung, sei aber zugleich „von dem noch ausstehenden, Gericht und Heil bringenden Ende der Geschichte deutlich abgehoben“ 73. Die theologische Bedeutung Jesu sei nicht allein auf der Grundlage der Historie zu beschreiben. Jesus sei nicht nur der historische, sondern der eschatologische Kyrios, der gekommen ist. So werde sein Leben nicht zuletzt durch die Verkündigung gekennzeichnet, die sich als ethische Belehrung versteht, also als „Forderung, die durch den Blick auf das Eschaton motiviert ist, daher eschatologischen Anspruch erhebt“ 74. Der historische Moment werde jedoch nicht dem eschatologischen untergeordnet, umgekehrt aber auch nicht. Die Christologie des Matthäus sei nicht durch die Alternative „historisch“ oder „eschatologisch“ zu erschließen, sondern durch die Zusammenschau beider Aspekte. Insofern könne man das Leben Jesu „in den Kategorien der ‚Heilsgeschichte‘ begreifen, in der die lineare Periodisierung mit der eschatologischen Heilsbedeutung der Zeit zur Einheit verbunden ist“ 75. In der Mitte dieser Heilsgeschichte werde die eschatologische Forderung verkündet und vorbildhaft durch das Handeln Jesu praktiziert – z. B. bei seiner Taufe und seiner Passion.
Die Zeit Jesu, die von den Propheten vorausgesagt war, weite sich nach der Ablehnung der Vorrechte Israels mit der Zeit der Kirche aus. Daher beginne mit der Auferstehung eine neue Periode der Heilsgeschichte, die von der Zeit Jesu abgehoben ist. Sie stehe allerdings in Verbindung mit der Vergangenheit. Sie bekomme vom Leben und Werk Jesu Sinn und Aufgabe. Die christologische Aussage finde in der ekklesiologischen einen Niederschlag. Matthäus charakterisiere seine Ekklesiologie durch die „Jünger“; sie bezeichneten die geschlossene Gruppe, die dem Herrn gegenübersteht. Sie bildeten zugleich die spätere Gemeinde im Voraus ab. In der Historisierungstendenz des Evangelisten sei der μαθητής-Begriff den Zwölf vorbehalten. Sie seien die Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu. Sie würden in der Aussendungsrede mit ihm parallelisiert, da sie durch ihre Machttaten das Eschaton vergegenwärtigen. In der Darstellung ihrer Gestalt spiegele sich die historisierende Akzentuierung wider, die aber durch das Petrusbild in ekklesiologischem Sinn typologisiert wird. Die Sendung der Jünger an alle Völker (Mt 28, 16-20) sei der Anfang der Kirche, so dass die Verbindung mit der heilsgeschichtlichen Periode gesichert ist. Die Ekklesiologie erlange eschatologische Qualität dadurch, dass die Gemeinde sich an den ethischen Forderungen Jesu ausrichte; sie solle in der Nachfolge Jesu die eschatologische Gerechtigkeit erfüllen. Sie sei aber fortwährend von der Versuchung der Sünde bedroht. Ihre christliche Existenz werde „durch eine ständige Bewegung zwischen Bejahung und Verneinung, Erfüllung und Nichterfüllung des eschatologischen Imperativs“ 76charakterisiert. Für die Vollkommenheit hat deshalb dieses corpus mixtum die Paränese notwendig.
Auswertung: Streckers Untersuchung zielt auf die Rekonstruktion der Heilsgeschichte ab. Das irdische Leben Jesu – von der Geburt über sein öffentliches Wirken bis zum Tod und zur Auferstehung – vollzieht sich auf der historischen Ebene. Das Heilsgeschehen durch Jesus entfaltet sich mit der Sendung der Kirche weiter, jedoch unter der Voraussetzung der Ablehnung Jesu durch Israel. Die Zeit der Kirche ist am letzten Gericht Gottes orientiert. Die ethischen Forderungen an die Jünger als Gegenstand der Basileia-Verkündigung Jesu sind schon eschatologisch ausgerichtet. Bei Strecker ist die Heilsgeschichte von der Historisierungstendenz bestimmt. Christologie und Ekklesiologie bewegen sich auf der historischen Ebene. Die Geschichte Jesu beruht aber m. E. nicht nur auf der historischen Erinnerung, sondern hat einen bleibenden Gegenwartsbezug. Sie gewinnt ihre Bedeutung dadurch, dass sie durch die Sendung der Kirche fortbesteht und damit transparent bleibt.
Читать дальше