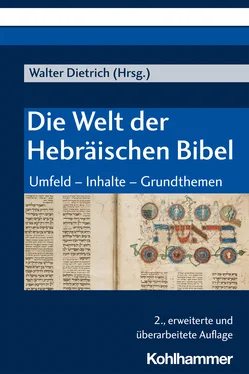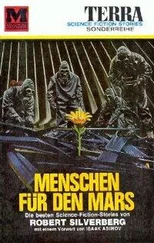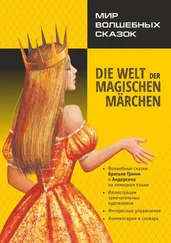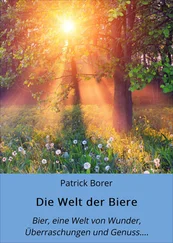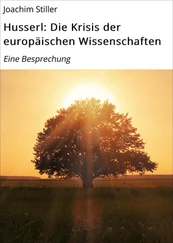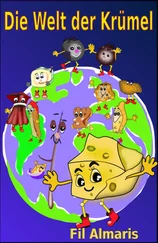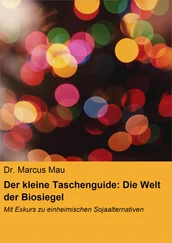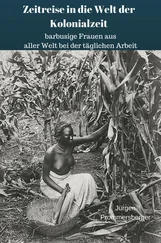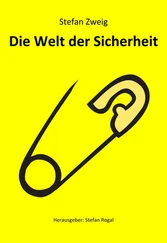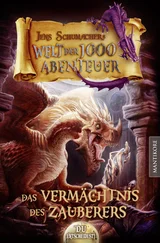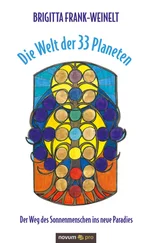Schon die Anfänge »Israels« waren eng mit den Nachbarn verbunden. Wie auch immer man die genauen Vorgänge rekonstruiert, 9nicht umsonst ist die erste außerbiblische Bezeugung des Begriffs »Israel« auf einer ägyptischen Stele des Pharaos Merenptah zu finden (1208 v. Chr.), 10und einer der zentralen Ursprungsmythen der Entstehung des alten Israel, die Exoduserzählung, zentriert sich um das Reich der Pharaonen. Und auch in den folgenden Epochen setzt sich die enge Verbindung des alten Israel mit seinen näheren (Moab, Edom, Ammon, Aram-Damaskus, Tyros, Ekron, Aschdod, Gaza etc.) und ferneren Nachbarn (Ägypten, Mesopotamische und »Griechische« Reiche) weiter fort. Entweder weil die südliche Levante durch einen Feldzug umgestaltet oder auch nur in Mitleidenschaft gezogen wurde, oder weil die Königreiche Israel (Nordreich) oder Juda (Südreich) Allianzen oder Intrigen mit ihren Nachbarn schmiedeten, kollaborierten oder rebellierten, oder einfach mit ihnen Handel trieben. Auch von interkulturellen Eheschließungen weiß die Hebräische Bibel zu berichten, wenn z. B. Isaak mit Rebekka eine Aramäerin (Gen 25,20), Salomo eine Pharaonentochter (1Kön 3,1) oder Ahab mit Isebel eine Phönizierin (1Kön 16,31) ehelichen. Politische Verflechtungen zwischen Israel/Juda mit den Nachbarn spiegeln sich vor allem im Kanonteil der (Vorderen und Hinteren) Propheten, wenn die Königsbücher bestimmte Feldzüge oder Tributzahlungen notieren (2Kön 15,19f.; 738 v. Chr. Menahem von Israel zahlt dem Assyrerkönig Tiglat-Pileser III. Tribut 11; 734 v. Chr. Ahas von Juda u. a. zahlen demselben König Tribut 2Kön 16,7 12; 722/0 v. Chr. Fall Samarias 2Kön 17,5f. 13), in den Prophetenbüchern (bes. Jeremia und Jesaja) vor diplomatischer Schaukelpolitik und falschen Allianzen gewarnt wird, Fremdvölkerorakel Jhwhs Willen über die Völker bekunden (z. B. Jes 19), wenn das Prophetenbuch Nahum erleichtert über den Untergang des neuassyrischen Reichs frohlockt, wenn Jes 45,1 den Perserkönig Kyros als Messias bezeichnet, u. a. weil damit die verhasste babylonische Herrschaft ein Ende haben wird, oder auch wenn das Edikt des Perserkönigs Kyros (538 v. Chr.) gleich mehrfach überliefert wird (Esr 6,3–5; 5,14; 1,2–4 = 2Chr 36,23).
Dieser kurze Durchgang zeigt: Im 1. Jt. geriet Palästina wiederholt in die Einflusssphäre seiner expandierenden Nachbarn, die denn auch sein politisches und wirtschaftliches Geschick bestimmten. Viele der religiösen und politisch-sozialen Vorgänge innerhalb der Levante spielten für die Autoren und Redaktoren des Alten Testaments keine Rolle, da sie ihnen keine Relevanz für die Glaubensgeschichte mit Jhwh zuerkannten. Folgerichtig ließen sie sie weg oder erwähnten sie nur am Rande. Andere wurden mit klaren Bewertungen versehen oder wurden als derart bedeutend angesehen, dass sie gleich mehrfach erzählt wurden, so dass sich Doppelüberlieferungen ergeben, die unterschiedliche Perspektiven zum Ausdruck bringen. Den alttestamentlichen Theologen lag durchwegs an einer theologisch-programmatischen und nicht an einer historisch-deskriptiven Aussage. Um zu erkennen, was die jeweiligen Autoren nun in ihrer Darstellung für wichtig und was sie für unwichtig erachteten, wo sie also ihre Akzente setzten, selektierten, (ver-)schwiegen, umdeuteten oder auch wie sie ihre theologisch-programmatische Aussage gestalteten, ist es wichtig, die biblische Erzählung mit anderen Quellen zu konfrontieren, die aus derselben Lebenswelt stammen, wenn nicht gar dasselbe Ereignis oder dieselben Vorgänge zum Gegenstand haben. Nur so kann man profilieren, was genau einem biblischen Autor am Herzen lag, und was er den nachfolgenden Generationen mitteilen wollte. Das war im seltensten Fall die reine Information über das Stattfinden irgendeines Krieges in irgendeiner Stadt im Vorderen Orient, sondern der Erweis des göttlichen Heilsplans mit seinen Menschen. Die theologische Interpretationsleistung der biblischen Autoren kann vor dem Hintergrund der (Re-)Konstruktion der Ereignisse, wie sie sich unabhängig von ihrer theologischen Interpretation vielleicht »tatsächlich« abgespielt haben (was immer unter dem Vorbehalt der Hypothese bleibt), erst präzise erfasst werden (was ebenso immer hypothetisch bleibt). Das ist nicht immer möglich, da für die historische (Re-)konstruktion mit den Methoden der modernen Geschichtswissenschaft häufig die außerbiblischen Quellen fehlen, die die Vorgänge der Vergangenheit erhellen könnten. Doch wurden in den letzten Jahrzehnten in dieser Hinsicht große Fortschritte erzielt. Zum einen sind aus Palästina selbst außerbiblische Schriftzeugnisse hinzugekommen, zum anderen wird aus den Nachbarkulturen unaufhörlich neues Textmaterial bekannt, aus dem sich neue Erkenntnisse gewinnen und alte verifizieren oder falsifizieren lassen. Generell gilt: Je mehr man bereit ist, verschiedene Quellenbereiche (archäologische Befunde, biblische und außerbiblische Texte, Bilder), Methoden und die daraus erarbeiteten Interpretationen miteinander ins Gespräch zu bringen, desto differenzierter, plastischer und dichter wird die vergangene Kultur und Gesellschaft Palästinas zu beschreiben sein. Und umso besser werden wir die biblischen Autoren und ihre Schriften verstehen.
b) Vernetzung der Alltagskultur und Realien Israels und der biblischen Schriften mit der altorientalischen Lebenswelt
Die Ergebnisse der Biblischen Archäologie, insbesondere der Ikonographie und des Studiums der altorientalischen Bild- und Realienwelt, können für die Interpretation biblischer Texte von Relevanz sein, wenn es um die Klärung von topographischen Gegebenheiten, Realien, Sozialstrukturen, Technologien, Verkehrswegen, Importen und Handelsstrukturen u. a. m., also der Alltags- und Lebenswelt der Menschen geht, welche die Hebräische Bibel geschrieben haben und für die sie geschrieben wurde. Selbst biblische Ortsangaben (z. B. Mamre) können mehr als ein topographischer Hinweis sein und eine theologische Konnotation enthalten. Um dies zu verstehen, muss man die Topographie Palästinas kennen.
Auch die Bildsprache und Metaphorik der Hebräischen Bibel ist der altorientalischen Lebenswelt verpflichtet, so dass sie sich erst voll erschließt, wenn man diesen Hintergrund ausleuchtet. Als Beispiel sei auf die Metaphorik verwiesen, die im Alten Orient, Alten Testament oder in den wenigen einschlägigen epigraphischen Funden aus Palästina benutzt wurde, um Sterben, Tod und Unterwelt zu beschreiben. Im Zusammenhang mit der Rede vom Übergang vom Leben zum Tod und vom Dasein des Toten in der Unterwelt teilen sich Alter Orient und Altes Testament zahlreiche Vorstellungen (z. B. das Schattendasein der Toten in der Unterwelt). Aber auch die Metaphorik diesbezüglich zeigt einen beachtlichen gemeinsamen Fundus, da man eben Bilder aus dem Bereich der Flora (Ps 102,5.12 versengte Kräuter) und Fauna (Ps 102,7 Dohle/Pelikan in der Wüste, Eule in Ruinen, 102,8 einsamer Vogel) der israelitisch-judäischen und altorientalischen Lebens- und Erfahrungswelt (Hiob 13,28 Kleid mit Mottenfraß, 14,11 vertrocknender Fluss; Ps 31,13 zerschlagenes Gefäß, 102,12 länger werdender Schatten) verwandte, um diesen Grenzbereich menschlichen Daseins sprachlich und begrifflich zu erfassen. Eine Metapher, die in mesopotamischen wie alttestamentlichen Texten verwendet wird, um der Rede vom Sterben eines Menschen eine spezielle Nuance und Färbung zu geben, ist der Vogelfang: Der konkrete Vorgang aus dem Bereich der Jagd 14wird aufgenommen, wenn das Fangen von Vögeln mit Fallen und Netzen als Bild für den bedrohten und sterbenden Menschen gebraucht wird. 15Der lebendige Mensch wird dabei mit dem freien Vogel assoziiert, der somit zur Metapher für die individuelle menschliche Vitalität (hebr. naepaeš 16), steht. Ebenso schnell wie der freie Vogel gefangen werden kann, kann der Tod den Menschen ereilen. So werden Vogelfang und Sterben (wie auch Fischfang und Sterben) z. B. in Koh 9,12 miteinander assoziiert, wenn festgestellt wird:
Читать дальше