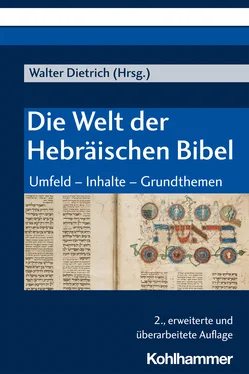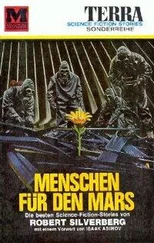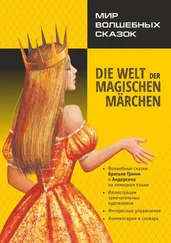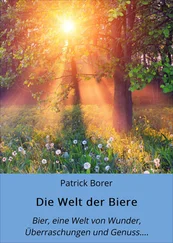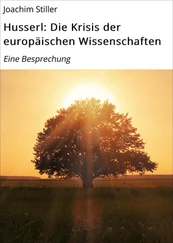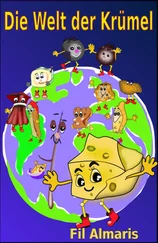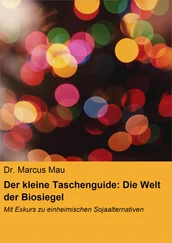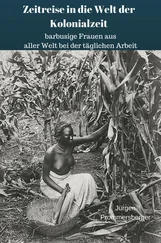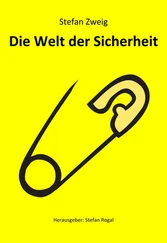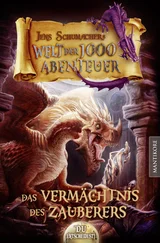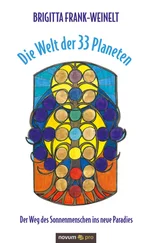Man kann mit diesem Band auf verschiedene Weisen umgehen. Man kann sich mit ihm allein oder in Gruppen befassen (etwa in Lesekreisen oder in Examensrepetitorien). Man kann ihn integral, von vorn nach hinten, man kann aber auch eines oder mehrere der sechs Hauptkapitel – oder auch nur einzelne der zweiunddreißig Paragraphen lesen, je nach Interesse und Bedürfnis. Man kann auch von den Namen der Mitwirkenden ausgehen: Welche von ihnen möchte ich gern im Originalton kennenlernen? Schließlich kann man das Buch mit Hilfe der Register – eines Stichwort- und eines Bibelstellenverzeichnisses – auch als Nachschlagewerk nutzen. Darüber hinaus lassen sich jederzeit die aus ihm gewonnenen Erkenntnisse aus anderen Überblicksbüchern wie den oben genannten oder ausgehend von den Einzelbibliographien noch erweitern.
Es bleibt an dieser Stelle noch herzlich zu danken: in erster Linie den Autorinnen und Autoren. Die Kooperation mit ihnen war wohltuend unproblematisch, wofür ein Herausgeber nur sehr, sehr dankbar sein kann. (Ziel war es übrigens nicht, sie alle nur einen Stil schreiben oder in strittigen Fragen immer nur einer Meinung sein zu lassen; sie durften in ihrer sprachlichen und sachlichen Eigenart ruhig erkennbar bleiben.) Mein Dank gilt ferner Frau Dr. Renate Klein in Fogarasch/Rumänien für ihr sachkundiges und achtsames Lektorat sowie dem Kohlhammer Verlag, insbesondere Herrn Florian Specker im Lektorat für Theologie, für die kompetente und sorgfältige Betreuung des Bandes von seinen Anfängen bis zu seinem Erscheinen.
Mit dem Wunsch, dieses Buch möge seiner Leserschaft die Welt der Hebräischen Bibel in ihrem Reichtum erschließen helfen, verbindet sich eine Bitte. Herausgeber und Autorenschaft freuen sich über Rückmeldungen jeglicher Art (auch kritische!): zur Anlage als ganzer, zu bestimmten Kapiteln oder Paragraphen, zu einzelnen Gedanken und Formulierungen bis hin zu kleinen Schreibversehen. Zuschriften sind erbeten an die e-mail-Adresse walter.dietrich@theol.unibe.ch; alles, was nicht (nur) den Herausgeber betrifft, wird zuverlässig weitergeleitet. Es wäre schön, wenn durch dieses Buch das seit Jahrtausenden anhaltende vieltausendstimmige Gespräch über die Bibel noch ein wenig bereichert würde.
Erfreulich rasch wurde eine zweite Auflage der »Welt der Hebräischen Bibel« nötig. Ich bin dem Verlag – und insbesondere Herrn Florian Specker im theologischen Lektorat – dankbar, dass er diese Aufgabe an die Hand genommen hat. Dankbar bin ich auch allen Autorinnen und Autoren des Bandes, die ihre Texte noch einmal durchgesehen, kleinere Mängel behoben, hier und dort Aktualisierungen vorgenommen, insbesondere: die Literaturlisten angepasst, mitunter auch größere Passagen neu geschrieben haben. Dankbar bin ich besonders Friedhelm Hartenstein, der neu einen Schluss-Paragraphen über die »Theologie des Alten Testaments und gesamtbiblische Perspektiven« beigetragen hat; ein solcher Abschnitt wurde in der Erstauflage verschiedentlich vermisst. Möge der Band in neuer Fassung und neuer Ausstattung weiterhin das ermöglichen, wozu er geschaffen wurde: Einblicke in und Überblicke über die Hebräische Bibel zu gewinnen.
Bern, im Herbst 2020 Walter Dietrich
1. Kapitel: Umfeld
§ 1 Bibel und Orient
Angelika Berlejung, Leipzig/Stellenbosch
Das Alte Testament, die hebräisch-aramäische Bibel (TNK) 1, ist eine altorientalische Bibliothek in hebräischer (und z. T. aramäischer) Sprache. Als Sammlung verschiedener Literaturwerke, die aus dem Alten Palästina des ersten vorchristlichen Jahrtausends kommen und dort tradiert wurden, kann das auch nicht anders sein. Denn Palästina verbindet als Landbrücke Nordafrika und Vorderasien, was konkret heißt, dass die Heimat des Alten Testaments mitten am Westrand des Alten Orients liegt: Im Süden grenzt Palästina an Ägypten, im Norden liegen Syrien und Anatolien, im Westen blühen die Küstenstädte, die in der südlichen Levante zu dieser Zeit unter philistäischer, in der nördlichen Levante unter phönizischer Herrschaft waren; auch Zypern, Kreta und »die Inseln« des Mittelmeers können als westliche Nachbarn betrachtet werden. Im Osten schien Mesopotamien vielleicht geographisch weit entfernt gelegen, jedoch bildeten sich dort im ersten vorchristlichen Jahrtausend große, expansive und international agierende Imperien, die von Norden kommend, mit ihren Armeen die syro-palästinische Landbrücke betraten (Assyrer, Babylonier, Perser).
Die besondere geographische Lage in einem Korridor brachte es für Palästina frühzeitig mit sich, dass die benachbarten Reiche, die sich weit vor den Staatenbildungen in Palästina 2konsolidiert hatten, immer wieder wirtschaftlich, politisch und militärisch auf diese strategisch wichtige Region ausgriffen, zumeist, um sich einen Zugang zum Mittelmeer zu verschaffen und/oder um Ägypten zu erobern. Beides versprach reiche Beute und war daher sehr lukrativ.
Palästina selber war im ersten vorchristlichen Jahrtausend keine unabhängige, selbstverwaltete politische Einheit, sondern entweder in kleine regionale Einheiten als Einzelstaaten mit wechselnden Allianzen zerstückelt, oder (und zum Teil auch gleichzeitig) in Vasallenstaaten, Provinzen oder Kolonien unter der Regie einer benachbarten Großmacht aufgeteilt. Diese Oberherrschaften bzw. Gebietsaufteilungen in der südlichen Levante wechselten sich leicht zeitverzögert zum Aufstieg und Untergang der jeweiligen Machthaber oder Reiche mit Expansionsambitionen ab. Im Zuge dieser fremdherrschaftlichen Dominanzen fanden sich auf palästinischem Boden schon spätestens seit dem 3. Jt. v. Chr. Ägypter, ab dem Ende des 2. Jt.s v. Chr. »Seevölkergruppen« (darunter die Philister aus der Ägäis), etwas später dann Aramäer aus dem Norden 3, Assyrer, Babylonier, Perser, und zuletzt noch Griechen und Römer ein. Nicht nur politische Fremdherrschaften und Gebietsansprüche beeinflussten die kulturelle und religiöse Entwicklung Palästinas nachhaltig, sondern auch Handelskontakte mit den verschiedenen Nachbarn, z. B. den philistäischen Stadtstaaten der südlichen Küstenregion, den phönizischen Stadtstaaten der nördlichen Küstenregion, den Bewohnern Zyperns, Griechenlands oder den nord- bzw. südarabischen Stämmen. Palästina hat selber außer dem Mittelmeer im Westen keine natürliche Grenze, denn die Grenzen zu den unmittelbaren Nachbarregionen darf man sich nicht allzu abgeschlossen und scharf vorstellen: Die Übergänge zu den Steppen- und Wüstenregionen des Negev und dem (Palästina nicht zuzurechnenden) Sinai im Süden, im Osten zur jordanischen Wüste oder im Norden zur Küstenregion des heutigen Libanon oder zum heutigen Syrien waren fließend. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass Palästina als Schwellen- und Durchgangsland mit »offenen Grenzen« die besten Voraussetzungen dafür bot, dass für die dortige Bevölkerung interkulturelle Begegnungen, Hochzeiten und entsprechend auch Mehrsprachigkeit an der Tagesordnung waren, insbesondere dann, wenn man als Händler auf Kontakte und Netzwerke angewiesen war oder an einer der zentralen Straßen (z. B. der sog. Via maris) wohnte. Aus dem Gesagten ist deutlich, dass die politische, die Sprach-, Kultur-, Sozial-, Religions- und Theologiegeschichte Palästinas eng mit den Vorgängen und Entwicklungen im Land, jedoch auch mit denen in der näheren (syrisch-phönizisch-arabischen) oder ferneren (ägyptisch-mesopotamisch-griechischen) Umgebung vernetzt waren und ohne Kenntnis derselben nicht sachgemäß beschrieben und verstanden werden können.
Die Heimat des hebräischen (und aramäischen) Alten Testaments, des TNK, liegt wie gesagt im Alten Orient. Der Alte Orient ist damit der Verstehenshorizont des Masoretischen Texts, wovon u. a. auch zahlreiche Lehnworte aus den dem Hebräischen verwandten Sprachen (z. B. dem Aramäischen, Akkadischen, Arabischen) zeugen. Für die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta (LXX) 4, gilt dies nicht in gleichem Maße. Hier ist auch die griechische Antike mit einzubeziehen. Grundsätzlich ist jede Übersetzung eine Interpretation des Übersetzers und daher von seinem Vorwissen und Kontext, seinen philologischen Kompetenzen, stilistischen Präferenzen und theologischen oder didaktischen Intentionen abhängig. Dies ist auch bei der LXX so, die auf die neue Situation des Judentums in der hellenistischen Zeit reagierte und den hellenistischen Juden ihre normativen Schriften in der inzwischen üblichen griechischen Sprache vorlegte. Sie stellte also für das Gemeinde- und Schulleben des hellenistischen Judentums eine enorme Erleichterung dar. Zugleich wurde durch sie die Hebräische Bibel zum ersten Mal der griechischen Welt vorgestellt. Die Übersetzung der biblischen Bücher begann mit der Tora wohl in der 1. Hälfte des 3. Jh.s v. Chr. in der zumeist Griechisch sprechenden, jüdischen Diasporagemeinde in Alexandria, wohingegen erst im Laufe der folgenden zwei Jahrhunderte die übrigen Bücher sukzessiv folgten (s. Prolog zu Jesus Sirach um 132 v. Chr., der das Gesetz, die Propheten und manche der Schriften in ihrer griechischen Version kennt). Es gab verschiedene Übersetzer, die mit unterschiedlich guten Sprachkompetenzen in der Ausgangssprache (dem Hebräischen und Aramäischen) und der Zielsprache (dem Griechischen) ausgestattet waren. Dies spiegelt sich darin, dass die Übersetzungsqualität der einzelnen Bücher recht unterschiedlich ist. Aus dieser Entstehungsgeschichte und dem Kontext der Übersetzer ergibt sich schon, dass die Septuaginta, ebenso wie der TNK, eine Bibliothek ist, wenngleich in griechischer Sprache. Sie ist aber weniger eindeutig altorientalisch als vielmehr stärker ägyptisch (s. Alexandria) als auch eben hellenistisch beeinflusst. Damit sind die Akzente deutlich verschoben, und hellenistische Elemente (z. B. griechisches Weltbild, griechische Philosophie) wurden bei der Übersetzung in die Texte mit eingetragen. Es kam somit zu einer Akzentverschiebung in Richtung auf die Aufnahme von Diskursen mit der hellenistischen Welt, faktisch also zu einer Hellenisierung des AT. Doch dies kann im Folgenden außer Betracht bleiben; wir konzentrieren uns ganz auf den Zusammenhang zwischen Hebräischer Bibel und Altem Orient. 5
Читать дальше