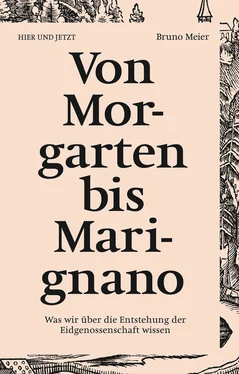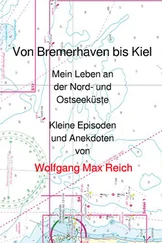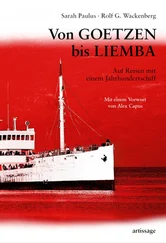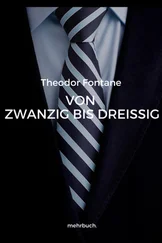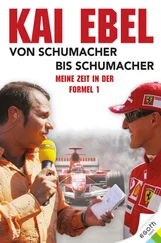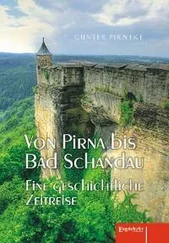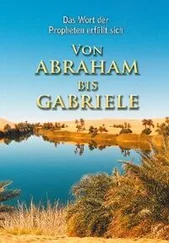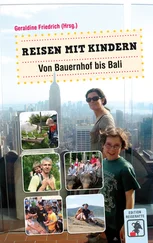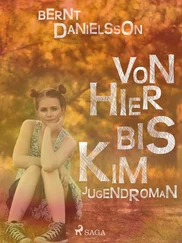Über die konkrete Ausgestaltung des Landesausbaus der Klöster in den inneren Alpentälern wissen wir wenig Bescheid. Die Form der klassischen Grundherrschaft mit zentralen Fron- und Dinghöfen unter der Führung von Meiern oder Ammännern, wie wir sie aus dem Mittelland kennen, wird sich im Alpenraum nur teilweise durchgesetzt haben. Die Wirtschaftsweise unterschied sich vom Mittelland. Der Ackerbau war zwar präsent, aber von geringerer Bedeutung. Die sogenannte Verzelgung des Landes, das heisst die Einführung der Dreizelgen-Brachwirtschaft mit Sommerfeld, Winterfeld und Brachfeld wird sich allenfalls an den Rändern zum Mittelland etabliert haben. Den klimatischen Bedingungen angepasst, war der Ackerbau im Alpenraum in einer Feld-Gras-Wirtschaft organisiert, das heisst in einer weniger geregelten Wechselwirtschaft von Acker- und Grasland. Allerdings betrieb man Ackerbau in weit höheren Regionen als wir uns das heute vorstellen. Extensive Viehwirtschaft wird schon früh eine wichtige Rolle gespielt haben, rund um die Gewässer auch die Fischerei; die Abgabenstrukturen der Klöster, die wir aus frühen Grundbesitzverzeichnissen kennen, deuten darauf hin. Zu den Abgaben gehörten unter anderem Milchprodukte (Käse, Ziger), Kleinvieh (Schafe, Ziegen) und je nach Ort Fische. Hinweise auf Grossvieh sind in der Zeit um 1200 selten. Die persönliche Bindung des Einzelnen an den Grundherrn im Rahmen der klösterlichen Genossenschaft wird zumindest teilweise bestanden haben. Den Gotteshausleuten, wie die klösterlichen Genossen genannt wurden, waren Heiratsverbote ausserhalb der Genossenschaft und Erbschaftssteuern (Fall oder Ehrschatz) auferlegt. Gerichtlich gehörten sie dem Personenverband des Klosters (oder auch eines Adligen als Vogt) und nicht einem kommunalen Verband an. Wie dieses theoretische System der Grundherrschaft im konkreten Fall ausgestaltet war, wissen wir aber kaum. Zugehörigkeit zu einer klösterlichen Genossenschaft bedeutete nicht Rechtlosigkeit. So stammten die führenden Familien der inneren Orte in der Regel aus der Gruppe der klösterlichen Ammänner. Typisches Beispiel dafür sind die Gotteshausleute des Fraumünsters in Uri, die nur mehr lose Bindungen nach Zürich hatten. Mit dem Verkauf des Besitzes des Klosters Wettingen an das Land Uri im Jahr 1359 erhielten die Wettinger Gotteshausleute den gleichen Status wie jene des Fraumünsters, waren mit anderen Worten weitgehend frei von personalen Bindungen.
Eine schwache Präsenz des Adels
Die mittelalterliche Feudalgesellschaft, vereinfacht gesagt die Differenzierung zwischen abhängigen Bauern und adligen Herren, scheint im Alpenraum wenig ausgeprägt gewesen zu sein. Dies mag damit zusammenhängen, dass die intensivere Besiedlung des Raums relativ spät erfolgt und vor allem durch die Klöster vorangetrieben worden war. Wie schon beschrieben, ist innerhalb der klösterlichen Organisation eine Führungsgruppe entstanden, die durchaus Berührungspunkte zum Adel haben konnte. Ländliche Potentaten, klösterliche Ammänner und Adlige sind oft schwer auseinanderzuhalten. Sie standen meist in verwandtschaftlichen Verbindungen untereinander und zum Adel im Mittelland und gehörten im weiteren Sinn zum Dienst- oder Ministerialadel («Milites»), der sich im Lauf des 13. Jahrhunderts im Umfeld grosser geistlicher und weltlicher Herrschaften entwickelte.
Die Angehörigen des alten Adels, das heisst die «Nobiles», die Hoch- oder Edelfreien, die sich direkt aus der Königsgefolgschaft rekrutierten, waren im Alpenraum schwach vertreten. Im mittelländischen Vorland gehörten zum Beispiel die Freiherren von Regensberg oder die Herren von Eschenbach, Vögte des Klosters Interlaken, dazu. Die Freiherren von Sellenbüren, Gründer des Klosters Engelberg, waren wahrscheinlich ebenfalls Teil dieser Adelsgruppe. Eine grosse, schwer durchschaubare Gruppe waren die Grafen von Rapperswil, die vor allem in Uri und Schwyz eine starke Stellung hatten und mit Adelsgeschlechtern im Bündner Gebiet, etwa den Herren von Vaz, verbunden waren. 8Die Hunwil in Luzern und später in Ob- und Nidwalden gehörten vielleicht auch dazu. In Obwalden präsent waren die Herren von Wolhusen. In Uri erreichten die Herren von Attinghausen-Schweinsberg, mit verwandtschaftlichen Verbindungen ins Emmental und den Aareraum, in der Zeit um 1300 eine grosse Bedeutung.
Tschudi schreibt in seiner Schweizer Chronik, dass dies «herren und edelknecht […] selbs mittlantlüt und mittregierer» waren. Das heisst, der Adel war Teil der kommunalen Körperschaft. Damit wird er nicht unrecht gehabt haben. Sie gehörten zur Führungsgruppe, die zu Beginn des 14. Jahrhunderts bei der Konstituierung der Waldstätte eine bedeutende Rolle spielte, vor allem auch weil sie ein grosses Interesse daran hatte, den Frieden nach innen und damit auch ihren Besitz zu schützen.
Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass der Alpenraum im Vergleich zum Mittelland oder anderen Reichslandschaften schwach feudalisiert war. Dies gilt nicht nur für die Innerschweiz, sondern für den Alpenbogen generell. Ein paralleles Beispiel sind die Südalpentäler in der französischen Dauphiné beidseits der heutigen französisch-italienischen Grenze, in der sich im Lauf des 13. und 14. Jahrhunderts mit den «Escartons de Briançon» ähnliche, kommunal verfasste Strukturen entwickelten. Die Landeshoheit verblieb aber mit dem Übergang der Dauphiné an Frankreich im Jahr 1349 beim französischen König.
Mit dem besseren Zugang zu den zentralen Alpenpässen und der wachsenden Bedeutung des Warenverkehrs von Nord nach Süd und umgekehrt geriet aber der Raum an Gotthard und Simplon verstärkt in den Fokus einerseits der Reichs- und Italienpolitik der Könige und ihrer Gefolgschaft, und wurde andererseits Teil des Wirtschaftsraums der den Handel dominierenden Städte, allen voran Mailand.
Die Pässe der Zentralalpen werden wichtig
Der Hildesheimer Bischof Gotthard, 1038 gestorben und 1113 heiliggesprochen, war Schutzpatron einer 1230 vom Mailänder Erzbischof geweihten Kapelle auf dem Monte Tremolo am Südhang des Gotthards. Er wurde zum Namensgeber des Passübergangs, der in den Jahrzehnten zuvor mit der Öffnung der Schöllenenschlucht besser zugänglich und damit für den Warenverkehr nutzbar geworden war. Auch die Kirche von Simplon ist 1235 dem heiligen Gotthard geweiht worden, dem Schutzpatron für Passkirchen. Die religiöse Versorgung der Passrouten deutet darauf hin, dass diese stark an Bedeutung zugenommen hatten. Hinweise zum Umfang des Warenverkehrs kennen wir erst aus der Zeit um 1300 von der savoyischen Zollstelle in Saint-Maurice und der habsburgischen in Luzern. Das Warenaufkommen am Gotthard scheint etwa doppelt so hoch wie am Simplon gewesen zu sein, war allerdings Schwankungen unterworfen. So haben zum Beispiel die nach dem Tod König Rudolfs von Habsburg im Sommer 1291 ausgebrochenen Konflikte den Verkehr am Gotthard deutlich beeinträchtigt und für eine starke Zunahme am Simplon und am Grossen St. Bernhard gesorgt. 9Die wachsende Bedeutung der Alpenpässe ist ohne die Rolle der Städte nicht zu verstehen. Dabei ist nicht nur die weit entwickelte Wirtschaftskraft der lombardischen Städte, besonders Mailands, zu betonen. Auch nördlich der Alpen entwickelte sich die Städtelandschaft seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert rasant. Es ist wohl kein Zufall, wenn König Friedrich II. Bern und Zürich nach dem Aussterben der Zähringer 1218 zu Reichsstädten aufwertete. Die Impulse von Bevölkerungszunahme und wirtschaftlichem Wachstum im 12. und 13. Jahrhundert brachten im Raum zwischen Bodensee und Genfersee eine dichte Städtelandschaft hervor. Zu den alten, in spätrömischer Tradition stehenden Orten wie Genf, Lausanne, Sitten, Solothurn, Basel, Zürich, Konstanz und Chur, oft auch Bischofssitze, kamen Dutzende mehr oder weniger erfolgreiche Neugründungen hinzu. Grössere und kleinere Adelsgeschlechter versuchten damit, ihren Machtbereich zu konsolidieren und wirtschaftlich aufzuwerten. Die Zähringer Gründungen Freiburg und Bern sind frühe Beispiele dafür. Dabei ging es um regional ausgerichtete Wirtschaftszentren, wie die Kyburger Städte Winterthur oder Frauenfeld im Thurgau oder die Habsburger Städte Brugg oder Bremgarten im Aargau. Die Gründung von Liestal, Olten und Zofingen im späten 13. Jahrhundert durch die Grafen von Froburg ist hingegen nur vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Strasse über den Hauenstein als Zugangsweg von Basel nach Luzern und zum Gotthard zu verstehen.
Читать дальше