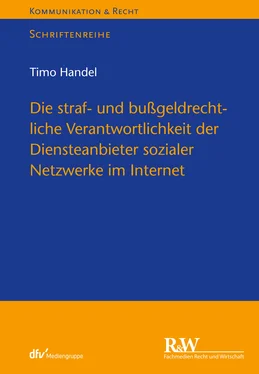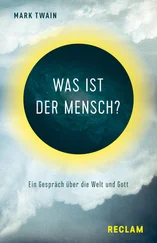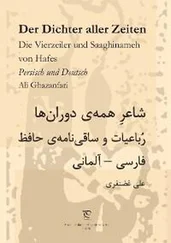k. Keine Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründe
Auch eine Qualifizierung der Haftungsprivilegierungen der §§ 8 bis 10 TMG als Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründe scheidet aus. Schuldausschließungsgründe betreffen den Fall, dass „der Täter unfähig war, das Unrecht der Tat einzusehen bzw. sich von dieser Einsicht leiten zu lassen“.487 Entschuldigungsgründe lassen demgegenüber ausnahmsweise den Schuldvorwurf wegen einer rechtswidrigen Tat entfallen, indem sie an „eine außergewöhnliche Situation“ anknüpfen.488 Diese Situation muss „die Entscheidung zum rechtgemäßen Verhalten“ erschweren.489 Sie muss zur Unzumutbarkeit der Normbefolgung führen, was grundsätzlich der Fall ist, wenn die Situation für den Täter „Unglück“ ist und „auch allgemein als Unglück definiert wird oder aber einer anderen Person zugerechnet werden kann.“490
Wie bereits dargestellt, beruhen die §§ 8 bis 10 TMG allein auf wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten. Sie dienen nicht der Auflösung einer persönlichen Zwangslage des Diensteanbieters. Die Haftungsprivilegierungen entsprechen deshalb nicht dem Charakter eines Entschuldigungsgrundes. Sie regeln zudem keinen Fall, in dem es dem Diensteanbieter an der Einsicht fehlt, das Unrecht seiner Tätigkeit einzusehen, wenn die von ihm übermittelte oder gespeicherte Information strafbar ist. Die Haftungsprivilegierungen stellen demnach auch keine Schuldausschließungsgründe dar.
Eine Einordnung auf der Schuldeben hätte wegen des rechtsgebietsübergreifenden Charakters zudem eine ungleiche Prüfung bzw. Anwendung der Haftungsprivilegierungen zur Folge. Im Rahmen von verschuldensunabhängigen Ansprüchen des Zivilrechts und öffentlichen Rechts würde eine solche Einordnung nämlich ausscheiden. Für diese gelten die §§ 8ff. TMG aber in gleicherweise wie für verschuldensabhängige Haftungsnormen.491
l. Keine persönlichen Strafausschließungsgründe
Persönliche Strafausschließungsgründe führen dazu, dass unabhängig von Unrecht und Schuld die Strafbarkeit der von ihnen erfassten Personen ausscheidet.492 Trotz des Vorliegens dieser Gründe bzw. Umstände ist die „Strafwürdigkeit der Tat [...] an sich zu bejahen, doch geben Unrecht und Schuld hier nicht allein den Ausschlag“, sondern die Strafbarkeit wird aus anderen – außerstrafrechtlichen, aber auch spezifisch strafrechtlichen – Gründen ausgeschlossen.493 Insbesondere kann es sich hierbei auch um kriminalpolitische Zweckmäßigkeitserwägungen handeln.494 Insoweit käme eine Qualifizierung der Haftungsprivilegierungen als persönliche Strafausschließungsgründe grundsätzlich in Betracht. Denn bei ihnen handelt es sich aus den dargestellten Gründen weder um Rechtfertigungsnoch Entschuldigungsgründe. Vielmehr werden mit ihnen wirtschafts- und rechtspolitische Zwecke jenseits von Unrecht und Schuld verfolgt, indem sie für die Diensteanbieter bestimmter Telemedien Rechtssicherheit schaffen und damit die Investitionsbereitschaft in solche Angebote erhöhen sollen.495
Einer Qualifizierung als persönliche Strafausschließungsgründe ist aber die horizontale Geltung der Haftungsprivilegierungen entgegenzuhalten, da sich diese auf das Strafrecht beschränken und „im Deliktsrecht keine Entsprechung haben“.496
m. Ergebnis zur zweistufigen Vorfilter-Lösung
Bei den Haftungsprivilegierungen der §§ 8 bis 10 TMG handelt es sich demnach richtigerweise um außerhalb der Haftungsnorm zu prüfende Vorfilter.
2. Bedeutung der dogmatischen Einordnung für die Annahme eines Irrtums
Zudem stellt sich die Frage, welche Folgen die dogmatische Einordnung der Haftungsprivilegierungen des TMG als außertatbestandliche Vorfilter für die Berücksichtigung eines Irrtums bzw. die Anwendung der strafrechtlichen Irrtumsregelungen hat. Im Ausgangspunkt ist zunächst festzustellen, dass jedenfalls eine direkte Anwendung des Tatbestandsirrtums (§ 16 StGB, § 11 Abs. 1 OWiG) ausscheidet, da die Haftungsprivilegierungen mit der hier gewählten Einordnung nicht zum gesetzlichen Tatbestand gehören. § 16 Abs. 1 Satz 1 StGB und § 11 Abs. 1 Satz 1 OWiG setzen aber voraus, dass der Beteiligte bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Aber auch eine direkte Anwendung des Verbotsirrtums nach § 17 Satz 1 StGB und § 11 Abs. 2 OWiG scheidet aus, da dieser das Unrechtsbewusstsein betrifft.497 Das Unrecht bleibt von den Haftungsprivilegierungen jedoch unberührt, da diese eine Strafbarkeit allein aus rechtspolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen entfallen lassen. Sie ähneln damit vor allem persönlichen Strafausschließungsgründen. Es stellt sich deshalb zunächst die Frage, ob die zu den persönlichen Strafausschließungsgründen vertretene Irrtumsdogmatik auf die Haftungsprivilegierungen des TMG übertragen werden kann.
a. Irrtümer bei persönlichen Strafausschließungsgründen
Zur Beantwortung der Frage, inwieweit sich die Irrtumsdogmatik persönlicher Strafausschließungsgründe übertragen lässt, ist in einem ersten Schritt festzustellen, ob und wie Irrtümer in Bezug auf persönliche Strafausschließungsgründe zugelassen und behandelt werden.
Während eine Ansicht498 die Möglichkeit eines Irrtums verneint, will die Gegenauffassung499 differenzieren und Irrtümer dann zulassen, wenn sich Schuldgesichtspunkte in dem persönlichen Strafausschließungsgrund widerspiegeln. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Behandlung des Irrtums vertreten; es finden sich insbesondere die Annahme eines Verbotsirrtums (§ 17 StGB) und einer analogen Anwendung des § 16 Abs. 2 StGB sowie einer ebenfalls analogen Anwendung des § 35 Abs. 2 StGB.500
Allerdings sind Irrtümer auch nach der differenzierenden Ansicht dann nicht zu berücksichtigen, wenn der betreffende persönliche Strafausschließungsgrund „ausschließlich oder überwiegend [...] staatspolitischen Belangen dient [...] oder auf kriminalpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen beruht“.501
Ein Beispiel für einen persönlichen Strafausschließungsgrund, der Schuldgesichtspunkte einschließt, ist § 258 Abs. 6 StGB. Danach ist trotz Verwirklichung einer Strafvereitelung straffrei, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht. Die Regelung trägt „der notstandsähnlichen Lage desjenigen Rechnung [...], der einen Angehörigen vor Strafe schützt“.502 Demgegenüber handelt es sich bei der Indemnität (§ 36 StGB) um einen persönlichen Strafausschließungsgrund, der staatspolitischen Belangen dient und keine Schuldgesichtspunkte beinhaltet, da gerade keine entschuldigungsähnliche Zwangslage Gegenstand des Strafausschließungsgrundes ist. § 36 StGB dient allein dem Zweck, „vor dem Forum des Parlaments eine möglichst freie Diskussion [zu] ermöglichen“.503
b. Folgen einer Übertragung dieser Grundsätze auf die §§ 8 bis 10 TMG
Nach der differenzierenden Ansicht wäre demnach eine Berücksichtigung von Irrtümern im Rahmen der §§ 8 bis 10 TMG möglich, wenn die Haftungsprivilegierungen auf Schuldgesichtspunkten beruhen und nicht allein staatspolitischen Belangen dienen oder auf kriminalpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen beruhen.
Die Haftungsprivilegierungen sollen den Diensteanbietern Rechtssicherheit verschaffen und durch die damit verbundene Risikoreduzierung vor allem zur „Investitionsbereitschaft in die neuen Medien“ beitragen.504 Sie beruhen auf dem Gedanken, dass sich die Tätigkeit der Diensteanbieter auf einen technischen Vorgang beschränkt und einen bloßen Vermittlungsvorgang darstellt.505 Auf eine persönliche Zwangslage des Diensteanbieters, die für diesen zu einer Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens führt, wie für Schuldgesichtspunkte im Rahmen eines Entschuldigungsgrundes üblich,506 wird nicht abgestellt.
Читать дальше