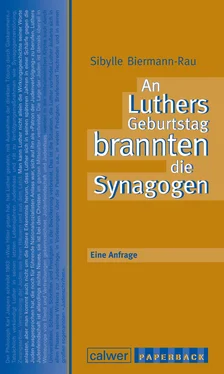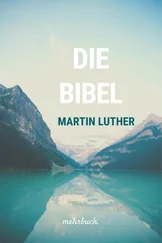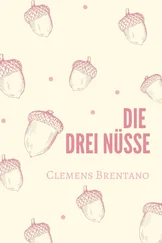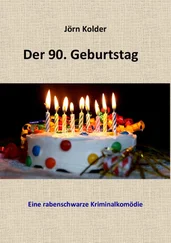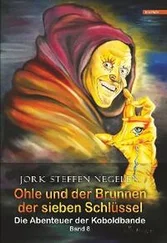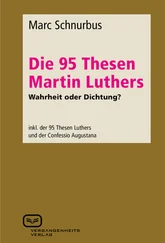Das mündet in die Frage: Wie verarbeitet die evangelische Kirche nach 1945 ihr Verhalten gegenüber den Juden während der Zeit des Nationalsozialismus?
Es dauerte Jahre, bis die mangelnde Solidarität mit den Juden als Schuld erkannt wurde. Und es brauchte Jahrzehnte, bis in Theologie und Kirche eine inhaltliche Abkehr vom traditionellen Antijudaismus vollzogen wurde.
Eine prägnante und verbindliche Distanzierung von Luthers Judenfeindschaft durch die Evangelische Kirche in Deutschland steht noch aus.
Als die Evangelische Kirche in Deutschland am Reformationsfest 2008 – nur wenige Tage vor dem Gedenken an die Reichspogromnacht vor siebzig Jahren – eine Lutherdekade ausruft, die bis zur fünfhundertjährigen Wiederkehr des Thesenanschlags am 31.Oktober 2017 dauern soll, sucht man vergeblich nach einem entsprechenden Wort.
Aber wie können wir heute in Deutschland Luther feiern, ohne seine furchtbaren Äußerungen zu den Juden als Irrweg zu erklären?
All diese Fragen haben mich nicht losgelassen. Und so ist daraus nun ein Buch geworden. Darin geht es um Luther, den Protestantismus und die Juden vor und nach 1945.
Inhalt des 1. Kapitels sind Luthers judenfeindliche Äußerungen, die im Dritten Reich eine nicht unbedeutende Rolle spielten.
Im Zentrum der Kapitel II-IV steht die von den Nationalsozialisten so genannte Reichskristallnacht, die aber nicht ohne den Zusammenhang der 12-jährigen nationalsozialistischen Judenpolitik dargestellt werden kann. Diese Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 markiert zeitlich ungefähr die Mitte des Dritten Reichs, und in den Zerstörungen dieser Nacht „kristallisiert“ sich der Antisemitismus der nationalsozi-alistischen Ideologie. Die brennenden Synagogen, die zerbrochenen Fensterscheiben, die auf die Straßen geworfenen Möbel, das war für alle in Deutschland sichtbar und hat sich als Bild für die Gewalt gegen Juden eingeprägt.
Und in der Reaktion der Christen auf die Zerstörung der jüdischen Gotteshäuser „kristallisiert“ sich der Antijudaismus der kirchlichen und gerade auch der lutherischen Tradition. Wenn seit Jahrhunderten die Tempelzerstörung als göttliche Bestrafung der Juden gepredigt wird, ist der ausbleibende Protestschrei der „Protestanten“ gegen die Zerstörung der jüdischen Gotteshäuser nicht überraschend.
In den Kapiteln V-VII wird der Weg der evangelischen Kirche in Deutschland nach 1945 aufgezeigt bis zur Erkenntnis der Mitverantwortung, bis zur Überwindung der „christlichen“ Judenfeindschaft und bis zur nötigen Distanzierung von Luthers entsprechenden Schriften und Predigten.
Schließlich geht mein herzlicher Dank an alle, die die Entstehung dieses Buches ermutigend begleitet haben. Er gilt Prälat i. R. Paul Dieterich, der das Manuskript nicht nur begutachtet, sondern die Arbeit durch wichtige Impulse bereichert hat. Ebenso Pfarrerin i. R. Dietgard Meyer, die als Zeitzeugin und frühere Freundin von Elisabeth Schmitz die entsprechenden Passagen kritisch und konstruktiv gegengelesen hat. Ausdrücklich möchte ich auch der Calwer Verlag-Stiftung und namentlich Andrea Scholz-Rieker als Lektorin für ihre hilfreiche Unterstützung danken.
Und nicht zuletzt haben viele aus dem Freundeskreis und der Familie durch ihr Interesse das Schreiben gefördert, ganz besonders Brigitte Wendeberg. Bei unzähligen Tischgesprächen und aufgrund ihres intensiven Manuskriptlesens hat sie mir darüber hinaus wertvolle Rückmeldungen gegeben. All das hat dazu beigetragen, dass das Buch auch für Nichttheologen verständlich bleibt.
| Albstadt-Ebingen, im November 2011 |
Sibylle Biermann-Rau |
Vorwort
zur zweiten Auflage
Die Resonanz auf dieses Buch macht eine zweite Auflage nötig. Sie ist im Wesentlichen unverändert, sodass der Seitenumbruch weitgehend beibehalten werden konnte. Druckfehler wurden beseitigt und ein paar Formulierungen präzisiert, ebenso wie einige Anmerkungen und das Literaturverzeichnis.
Eine inhaltliche Änderung bezieht sich auf den Brief von Elisabeth Schmitz vom 15.11.1938 (S. 158f. und Anmerkung 229): Andreas Pangritz/Bonn machte mich darauf aufmerksam, dass entgegen seiner bisherigen Annahme Schmitz unmittelbar nach der Reichspogromnacht nicht Gollwitzer, sondern Pfarrer von Rabenau kontaktiert und ihm diesen Brief geschrieben hat.
| Albstadt-Ebingen, im November 2013 |
Sibylle Biermann-Rau |
I
„Von den Jüden und ihren Lügen …”
(Martin Luther, 1543)
Der Philosoph Karl Jaspers schreibt 1963: „Was Hitler getan hat, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch Gaskammern.“ 1Tatsächlich verkündigt Martin Luther in seinen letzten Lebensjahren Judenhass und rät zu Verfolgungsmaßnahmen wie Synagogenzerstörung, Zwangsarbeit, Vertreibung der Juden aus ihren Häusern und aus dem Land.
Man kann Luther nicht allein die Wirkungsgeschichte seiner Worte anlasten, aber man kommt auch nicht um die bittere Erkenntnis herum, dass Luther sich in seinen späteren Jahren in einer Schärfe gegen die Juden ausgesprochen hat, die noch für führende Nationalsozialisten Anlass war, sich auf ihn als „Patron der Judenverfolgung“ zu berufen. 2
Luthers Judenfeindschaft ist allerdings nichts Neues, sie ist bei den Christen im ganzen Mittelalter verbreitet. Die Lage der Juden ist damals überall in Westeuropa von Elend und Vertreibungen gekennzeichnet. 3
Den Juden wird vor allem vorgeworfen, sie würden Menschen vergiften und Brunnen, und das sei der Grund für die Pestepidemie. Aber auch Hostienschändung, Ritualmord und Gotteslästerung werden ihnen zur Last gelegt … und nicht zuletzt die Schuld am Tod Jesu Christi. Der Grund für den Hass auf die Juden und den Wunsch, sie loszuwerden, liegt aber auch darin, dass viele Menschen bei den Juden Schulden haben und die handwerklich-gewerblichen Städter in den Juden unerwünschte Konkurrenten sehen.
Nach der Zeit der „spontanen“ lokalen Judenverfolgungen mit Plünderungen und Mord werden im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert die Juden aus den meisten deutschen Reichsstädten, Herrschaftsgebieten und Bistümern vertrieben. Gegen Bezahlung finden sie noch Schutz in manchen der vielen Länder im Deutschen Reich und in Dörfern. Hunderte von Synagogen sind bereits vernichtet. Judenfeindschaft und Judenhass werden in der mittelalterlichen Kirche auch durch Universitäten, Schulen, Schriften und Predigten in der Bevölkerung verbreitet. 4Das ist die Situation, die Luther vorfindet.
Luther äußert sich in allen Phasen seines Wirkens zur Judenfrage, in Vorlesungen über die Psalmen u.a., in vielen Predigten, Briefen und Tischreden und in seinen großen sogenannten „Judenschriften“ („Dass Jesus ein geborener Jude sei“/„Wider die Sabbather“/„Von den Jüden und ihren Lügen“/„Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi“/„Von den letzten Worten Davids“).
Das Thema steht für den Reformator nicht am Rande und ist auch nicht auf die genannten Sonderschriften beschränkt, sondern vielmehr im „Grundmuster der Theologie Luthers“ verankert. 5
Im Folgenden geht es vor allem um die Äußerungen Luthers aus seinen letzten Jahren, die von Judenfeindschaft und Judenhass geprägt sind (s. S.17ff.). Diese sollen zunächst – bis auf kurze Überleitungen – unkommentiert wiedergegeben werden. Eine Bewertung von Luthers Judenfeindschaft, die in der theologischen Diskussion durchaus unterschiedlich ausfällt, erfolgt erst an späterer Stelle (s.S. 292ff.).
Dieses Vorgehen erscheint mir möglich und auch sinnvoll, denn die meisten, die Luthers Worte seit Jahrhunderten hören und lesen, haben nicht den theologischen Hintergrund, um diese einzuordnen. Luthers Worte wirken zunächst so, wie sie dastehen. Und so werden sie gerade auch in den Veröffentlichungen aus der Zeit des Nationalsozialismus innerhalb und außerhalb der Kirche mit Berufung auf Luthers Autorität zitiert (s.S. 44ff.).
Читать дальше