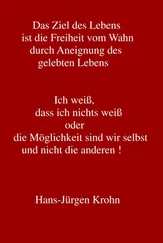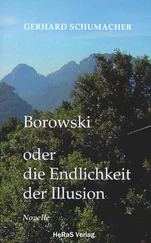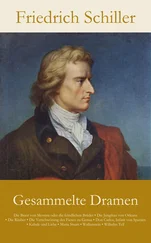Gerhard Gaedke
Sibylle oder Die Zugfahrt
Geschichten
Leykam
Über den Wolken. Unter uns lag die Nordsee. Meine Frau kramte in ihrer Tasche und gab mir einen kleinen Novellenband. Irgendwo da unten steht er, sagte sie und blieb trotz Nachfrage bei dieser Andeutung. Sie habe das Büchlein zufällig entdeckt, gab mir einen Kuss auf die Wange und schloss die Augen.
Der Leuchtturmwärter. Unbekannter Autor. Gott sei Dank kein 1000-Seiten-Wälzer, dachte ich. Vor uns lagen noch einige Flugstunden. Der Lesestoff würde mir die Flugzeit angenehm verkürzen. Und so machte ich mich unverzüglich an die Lektüre.
Womit begann alles?, fragte ich mich. Eigentlich mit dem Streit in der Redaktionskonferenz. Ich hatte einen mir wesentlich erscheinenden Artikel erst im letzten Augenblick abgeliefert, was selten vorkam. Der Chefredakteur vergaß Bildung und Position. Dass ich unfähig sei, war noch das Gelindeste, was er herausschrie. Ich schwieg. Es war nicht das erste Mal. Diesmal aber wollte ich konsequent handeln. Ich stand auf und erklärte vor versammelter Mannschaft, die Kündigung anzunehmen.
Von Kündigung sei keine Rede, bei diesem Satz mäßigte er den Ton.
Ich habe sie aber als solche verstanden, replizierte ich, nahm Block und Bleistift in die Hand und verließ den Raum, ging in mein Büro und steckte die wenigen persönlichen Dinge in meine Aktentasche. Milla, meiner Sekretärin, schenkte ich meinen Ficus benjamina mit der Auflage, ihn regelmäßig zu gießen, und verabschiedete mich.
Bei Josef, dem Wirt, der eigentlich nur von der Redaktion gut lebte, bestellte ich mir ein Glas Bier und erklärte ihm, dass ich mich mit dem Chef angelegt habe und daher meine Tage beim Tagblatt gezählt seien.
Das glaube er nicht, erwiderte Josef, auf mich könne die Redaktion niemals verzichten.
Doch, antwortete ich, jeder sei ersetzbar.
Was ich nun zu tun gedenke, fragte er.
Aussteigen, antwortete ich. Mit 55 könne man doch aussteigen. Schafhirte in der Lüneburger Heide, einen Mal- oder Töpferkurs belegen, oder mit dem Geschichtestudium beginnen, das wollte ich immer schon machen, erklärte ich ihm. Endlich frei zu sein, ohne Termindruck, ohne oberlehrerhafte Kürzungen der von mir verfassten Artikel, frei von unqualifizierten Äußerungen mancher Leserbriefschreiber.
Josef, bitte noch ein Bier.
Das gehe heute aufs Haus, erklärte er mir.
Milla, meine Redaktionsassistentin, stürmte bei der Tür herein, vermutlich hatte sie Josef verständigt.
Wenn ich ginge, gehe sie auch.
Nein, Milla.
Josef mischte sich ein. Er wird Schafhirte, erklärte er ihr mit einem Lächeln und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger an die Stirn.
Ich ignorierte Josefs Geste und versprach Milla, mich jeden Tag zu melden. Und dass ich keine Dummheiten vorhabe.
Am nächsten Tag kaufte ich mir die Wochenendausgaben verschiedener Zeitungen, kochte eine große Kanne Tee und lag den restlichen Vormittag entspannt auf der Couch. Ich las vom Angebot einer Greyhound-Tour von Seattle nach San Diego, vom Indian Summer in Vermont, einer Trekkingtour durch den Kaukasus. Dann stand nicht ganz unerwartet Milla mit einem selbst gebackenen Kuchen vor der Tür. Aus der Handtasche zog sie einen Brief. Ich wusste sofort, Milla war als Botschafterin ausgesandt worden. Ich konnte mir alle Redewendungen des Chefredakteurs vorstellen. Man bedaure zutiefst, stressbedingter Ausrutscher, man kenne sich doch so lange, das ganze Team trauere. Ungelesen gab ich den Brief Milla zurück.
Der Kuchen war besonders gut gelungen, wir tranken schon am Nachmittag eine Flasche Wein aus. Abends bestellten wir uns eine Pizza. Pizza Margherita. Und eine Flasche Rotwein. Im Bett gestand mir dann Milla, dass der Chefredakteur sie gebeten habe, sich für die Sache zu opfern. Es sei aber kein Opfer, erklärte mir Milla lachend.
Am nächsten Tag brachte ich Milla mit dem Taxi nach Hause, besorgte mir noch Sonntagszeitungen und widmete mich ihnen unten im Park. Und ich las: Leuchtturmwärter gesucht. Drei Wochen am Stück, eine Woche Landurlaub. Befristet von September bis Ende Februar. Technisch versierte Personen werden bevorzugt.
Leuchtturmwärter! Leuchtturmwärter auf einer einsamen Insel. Auszeit pur, dachte ich sofort. Ich lief in meine Wohnung, setzte mich an den Computer und schrieb sofort meine Bewerbung. Den akademischen Grad ließ ich weg, dafür verwies ich auf die norddeutschen Wurzeln meines Vaters und auf meinen Segelschein, den ich einmal in den Ferien in der Glücksburger Segelschule erworben hatte. Auch dass ich familiär ungebunden sei, erwähnte ich.
Und ich dachte nach. Für den Fall des Falles würde sich Milla um die Wohnung und meine Post kümmern, um meine Mieter im Haus die Hausverwaltung. Das Auto würde ich mitnehmen und auf dem Festland in einer Garage unterstellen.
Immerhin nahm man mit mir nach einer Woche Kontakt auf. Man mache aufmerksam, dass das Postschiff nur einmal pro Woche anlege. Man sei natürlich per Telefon verbunden und könne jederzeit, aber nur, wenn es die See zulasse, bei Notfällen ein Boot schicken. Neben der Wartung der Technik des Leuchtturms seien zwei Mal pro Tag das Wetter durchzugeben und eine Windmessung vorzunehmen. Zum Erstgespräch möge ich ein Gesundheitszeugnis mitbringen, man wolle schließlich kein Risiko eingehen. Nach dem Auslaufen des Vertrages werde der Leuchtturm umgebaut und mannlos betrieben.
Hamburg. Die beiden Herren vom Küstenamt waren freundlich, sie würden mich zur Besichtigung meiner künftigen Arbeitsstätte kommenden Freitag begleiten. Und ob ich seetauglich sei, wollten sie wissen. Oft könne nämlich die See sehr rau sein.
Ich verwies darauf, dass ich ein Hochseefischen ohne größere Probleme überstanden habe. Beide lachten, Hochseefischen wiederholten sie.
Der scheidende Leuchtturmwärter war, anders als ich es mir vorgestellt hatte, ein gepflegt aussehender älterer Herr. Am Anfang habe er sich einen Bart wachsen lassen. Tun Sie das auch, das verbessert die Eingewöhnung, riet er mir. Und dass zu einem Leuchtturmwärter der Bart dazugehöre, dabei lachte er. Bei der Anlegestelle könne man immer wieder kleinere, aber auch größere Fische fangen, die Angelrute lasse er mir da. Einer der beiden mich begleitenden Herren warf ein, dass ich ja ein Hochseefischer sei. Und jetzt lachten wir alle. Und wenn es einmal ganz fürchterlich stürmen sollte, empfehle er mir Flensburger Rum oder einen Bommerlunder. Ob den einer, der aus dem Rheinland kommt, kennt?, fragte er.
Ich schwieg.
Der Tag sei lang, erklärte er mir, er empfehle mir einen Stapel Bücher mitzunehmen, einige Bände würden sich auf der Stellage im Schlafraum finden. Außerdem werde man genügsam.
Genügsam, das Wort wiederholte ich leise. Das war ja genau das, was ich anstrebte.
An den Wänden des Stiegenaufgangs waren Fischnetze und ein Enterhaken befestigt. 200 Stiegen seien zu bewältigen. Ich sah es als tägliches Training. Sogar bezahlt, dachte ich mir. Der Ausblick von der Turmspitze war großartig, von hier aus sah man nicht nur die in der Ferne kreuzenden Schiffe, sondern konnte auch die gesamte Insel überblicken.
Falls Sie Seeräuber überfallen, sagten fast alle gleichzeitig, sperren Sie sich ein, dabei lachten sie laut. Eine Signalpistole liege unten im Vorraum, ergänzte der Leuchtturmwärter.
Dann wurde ich eingewiesen. Täglich Reinigung der Glasscheiben und Kontrolle der Lampen, Führung des Kontrollbuches und Meldungen von Wetter und Windstärke.
Jetzt könne ich es mir noch überlegen.
Ich schüttelte den Kopf. Ich hätte nur Angst vor der Technik gehabt, aber das müsste zu schaffen sein, ergänzte ich.
Milla war über meinen Entschluss entsetzt. Alle hätten bis zum Schluss gehofft, ich würde mich umbesinnen. Und ob ich regelmäßig nach Hause komme. Ich hätte doch Anspruch auf Freizeit.
Читать дальше