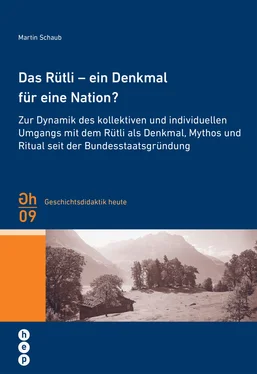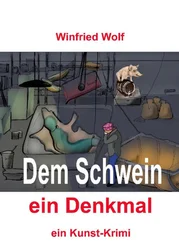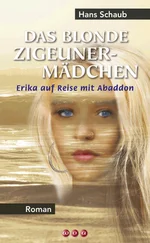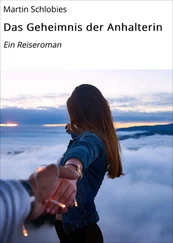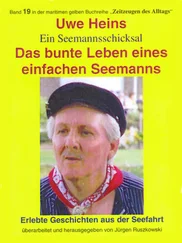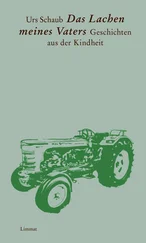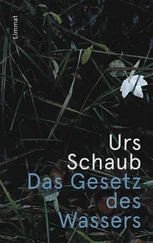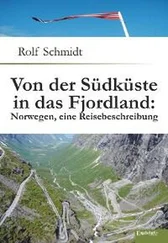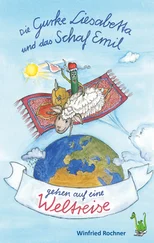Um den Kommandanten der Armee seine teilweise umstrittene Réduit-Strategie zu erläutern sowie die Notwendigkeit des Widerstands darzulegen, beorderte Guisan 650 höhere Offiziere auf den 25. Juli auf das Rütli.[131] Die Ortswahl begründete er im Nachhinein: «Ich hätte das ja in irgendeinem Lokal oder auf irgendeiner anderen Wiese tun können, bei Morgarten vielleicht oder bei Sempach – doch, nein, es musste hier geschehen, auf der Rütliwiese, an der Wiege unserer Unabhängigkeit, auf dem Boden, der jedem so vieles vor dem geistigen Auge heraufbeschwören musste. Ich war überzeugt, dass dort jeder mich besser als irgendwo anders verstehen würde.»[132] Verordneter Treffpunkt für die Teilnehmer war die Schifflände in Luzern, von wo aus das Dampfschiff «Luzern» gemäss Marschbefehl zum Rütli fuhr.[133] Auf der Wiese hielt der General eine Ansprache. Quellen zu diesem bedeutungsvoll gewordenen Ereignis sind rar. Aufnahmen der Rede Guisans gibt es keine, der Wortlaut seiner frei gehaltenen Rede deckte sich wohl nicht mit dem Armeebefehl, der aus der Feder von Bernard Barbey stammen dürfte, dem persönlichen Stabschef des Generals, und der als 26-seitiges Dokument den Teilnehmern nach dem Rapport ausgehändigt wurde.[134] Ansonsten erstaunt es, wie widersprüchlich und auch unsicher sich die Augenzeugenberichte präsentieren.[135] So ist bis heute umstritten, in welcher Sprache der General sprach, wie viele Teilnehmer effektiv dabei waren und wie das Wetter war. Hier hilft eine zweite Hauptquelle weiter, die den Rapport dokumentiert. Es sind die Fotografien, die der junge, aufstrebende Fotograf Theo Frey schoss. Auf ihrer Basis lässt sich rekonstruieren, dass es nicht strahlend sonniges Wetter war, sondern bedeckt, dass nicht 650 Offiziere auf der Wiese standen, wie Guisan – wohl in Anlehnung an den bevorstehenden 650. Jahrestag der eidgenössischen Gründung – selbst behauptete, sondern zwischen 420 und 485. Theo Frey lichtete die Versammlung auf der Wiese in verschiedenen Aufnahmen ab. Auf seinen Fotografien ist zum einen die aufgezogene Schweizerfahne auf der Rütliwiese gut erkennbar, zum anderen flankiert das Banner des Urner Bataillons 87 die Versammlung.[136] Weiter sind die Offiziere auf der Wiese so gruppiert, dass sie während der Ansprache des Generals auf den See und die am anderen Ufer verlaufende Gotthard-Eisenbahnstrecke sahen. Damit hatten sie insgesamt sowohl die Begründung als auch das Vorgehen für die Verteidigung stets vor Augen – eine symbolische Inszenierung der Réduit-Strategie.[137] Der Rapport liess sich so als Reminiszenz deuten, als Neuauflage des Befreiungsdramas, in dem Offiziere als Darsteller oder Statisten eines historischen Ereignisses fungierten.[138]
Wie wurde der Rapport von Zeitgenossen wahrgenommen? Rasch und vor allem negativ reagierten die diplomatischen Vertreter von Deutschland und Italien, so Streit, der deutsche Staatssekretär von Weizsäcker drohte mit ernsthaften Konsequenzen, der Aussenminister Ribbentrop richtete eine Protestnote an die Schweizer Regierung.[139] Fuhrer und vor allem auch Gautschi dagegen beurteilen die deutsche Reaktion als moderat.[140] Ein Indiz dafür sehen sie in den zwei Wochen, die Ribbentrop verstreichen liess, bis er dem Bundesrat die Protestnote überreichen liess.[141] Der Bundesrat reagierte beschwichtigend und zog einer schriftlichen eine mündliche Stellungnahme vor. Die britische und amerikanische Presse hingegen begrüsste die Positionierung Guisans. Der Nachhall in der Schweizer Bevölkerung war, gemäss Streit, gross gewesen sein, nachdem der Militärstab erst drei Tage später informiert hatte.[142] Diesem nur punktuell und individuell belegten Eindruck steht die nachweisbare mediale Publizität gegenüber, die Guisans Aktion ausgelöst hatte. Nur die Hälfte der grösseren Zeitungen berichteten auf der Titelseite über den Rapport, die NZZ, die Basler Nachrichten und die Gazette de Lausanne platzierten den entsprechenden Beitrag weiter hinten im Blatt.[143] Nach Streit war es vor allem die persönliche Weitergabe durch die Offiziere und deren Truppen, welche die Botschaft des Generals in die breite Bevölkerung trug – was wohl der Absicht des Generals entsprach. Aus Sicht der Meinungsforscher der Armee erwies sich diese Inszenierung Guisans als genauso wirkungsvoll wie seine Ansprache zum 1. August in Morgarten: «Ihre Wirkung auf Elite und Volk war ausserordentlich und tief. Das unbedingte Bekenntnis zur Landesverteidung hat eine neue Welle des Zutrauens und des Verteidigungswillens geschaffen. An Stelle von Unsicherheit ist wieder Sicherheit getreten.»[144] Unklar bleiben in diesem Bericht die Kriterien, anhand derer diese Wirkung hätte gemessen werden konnte.
Die Mythenbildung setzte kurz nach Ende des Kriegs ein. Denn dass die Schweiz praktisch ganz vom verlustreichen Kriegstreiben verschont geblieben war, bedurfte der Erklärung. Und diese Erklärung wurde im Bild des Réduits als «erfolgreichem Selbstbehauptungskonzept eines dauernd neutralen Staates» gefunden, eine Monokausalität, die dank ihrer Einfach- und Eindeutigkeit rasch geschichtskulturellen Niederschlag fand, beispielsweise in Geschichtslehrmitteln.[145] Komplexere Begründungszusammenhänge, die das Beziehungsgeflecht von Wirtschaft und Politik aufzeigten, blieben undiskutiert.[146] Speziell die Visualisierungen, die Aufnahmen von Theo Frey, wurden zu ikonischen Bildern dieser offiziellen Sicht auf die Zeit während dem Zweiten Weltkrieg. Während die unmittelbare Nachkriegszeit beide Mythen hochhielt, begann Ende der 1960er-Jahre deren Dekonstruktion. Die Infragestellung der mittelalterlichen Gründungsgeschichte hatte bereits im 18. Jahrhundert eingesetzt, verdeutlicht und präzisiert durch den Luzerner Historiker Eutych Kopp in dessen nach 1830 erschienenen Publikationen, die jedoch auf wenig Echo stiessen. Erst Otto Marchis «Schweizer Geschichte für Ketzer» von 1969 stiess Tell vom Sockel und kritisierte die idealisierte Demokratievorstellungen zum Rütlischwur, ohne dessen Historizität anzuzweifeln.[147] Ähnlich gewichtete auch Max Frisch seine Kritik in «Wilhelm Tell für die Schule», wo er den Nationalmythos ebenfalls von Tell aus dekonstruierte.[148] In der Wendezeit um 1990 sah sich die wohlstandsverwöhnte und deshalb auf Kontinuität bedachte Schweiz mit aussen- und innenpolitischen Altlasten des beendeten Kalten Kriegs konfrontiert.[149] Die Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum, eröffnet auf dem Rütli, fielen in diesem Kontext zweispältig aus. Gegen Ende des Jahrhunderts schliesslich prägten rechtsextreme Gruppierungen die Bundesfeier auf dem Rütli und prägten dessen kollektive Wahrnehmung stark.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Ende des 15. Jahrhunderts die Überlieferung der Gründungs- und Befreiungssage einsetzte und im darauffolgenden Jahrhundert ihre kanonische Ausgestaltung erhielt. Von Beginn an fundierte die Gründungsgeschichte – der Ort hingegen kaum – die innenpolitische Legitimation und das Selbstverständnis bei gleichzeitiger aussenpolitischer Abgrenzung. Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert führten aufklärerischer Patriotismus und nationalromantische Strömungen zu einer ideellen Aufladung des Rütli, auf das sich gleichermassen progressive und konservative Kräfte bezogen. Auch deshalb griff der neue, liberal geformte Bundesstaat von 1848 auf die mittelalterliche Gründungs- und Heldengeschichte zurück, ein Rückgriff, der als Legitimationsanspruch und Versöhnungsgeste dienen konnte. Eine weitere mythische Aufladung der Landschaft rund um den Vierwaldstättersee hatte bereits Schillers Theaterstück «Wilhelm Tell» besorgt, eine Wirkung, die durch die politische und touristische Entwicklung verstärkt und in mehreren Denkmälern objektiviert wurde. 1891 schliesslich erklärte der bürgerliche Bundesrat den 1. August 1291 zum Gründungsdatum der Schweiz, ein Datum, das sich rasch mit dem Schwur resp. dessen angeblichen Ort verband. In der Zwischenkriegszeit verstärkte sich die Bedeutung des Gründungsmythos, denn zentrale Ideen der von bürgerlicher Seite getragenen «Geistigen Landesverteidigung» bezogen sich auf die mittelalterliche Befreiungstradition, die aufgrund der äusseren Bedrohung als Unabhängigkeitstradition gedeutet wurde und im Rütli-Rapport ihren symbolträchtigen Ausdruck fand. Dessen Wirksamkeit entfaltete sich nach dem Zweiten Weltkrieg und stand emblematisch für die kollektive Überzeugung, dass die Schweiz dank ihrer militärischen Stärke vom Krieg verschont geblieben war – ein Mythos, den Historiker seit den 1960er dekonstruierten und der durch das Ende des Kalten Kriegs erst recht in Frage gestellt wurde. Seit Ende des Jahrhunderts prägten rechtsextreme Gruppierungen die Bundesfeier auf dem Rütli und damit wesentlich dessen kollektive Wahrnehmung.
Читать дальше