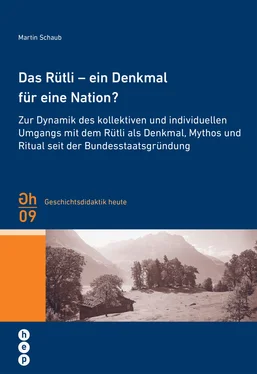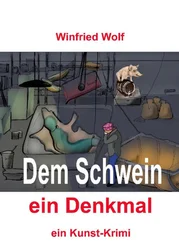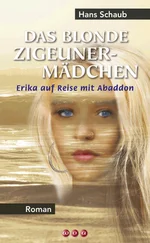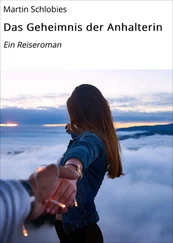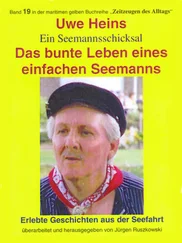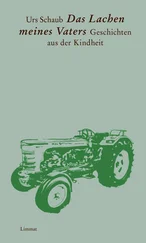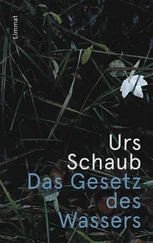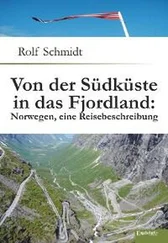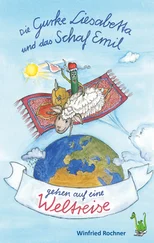1 ...8 9 10 12 13 14 ...27 Die steigende Popularität des idyllischen Rütlimotivs in der Restaurations- und Regenerationszeit dürfte der nationalromantischen Strömung geschuldet sein, die ihren Ausdruck nicht nur in einer grösseren Zahl von Stichen und Gemälden fand, sondern auch im Rütlilied, das 1820 seine Uraufführung erlebte. Wie in der Revolutionszeit reklamierten die einander gegenüberstehenden politischen Kräfte den Schwur und seinen Ort für sich. Die Rütli-Bezugnahmen der schweizweit entstehenden Vereinsgründungen, die zum wichtigen Motor wurden für die nationale Idee, waren ebenso zahlreich wie die Indienstnahmen der Wiese durch konservative Kräfte, die sich auf diese Weise gegen liberale Bestrebungen wehrten. Noch nicht auf dem Rütli, aber in dessen Nähe entstanden aus diesem politischen Gegensatz zwei Denkmäler. Das glanzvolle «Aristokratenfest», in dessen Rahmen 1821 das aussergewöhnliche Löwendenkmal in Luzern, errichtet für die gefallenen Schweizer Söldner im revolutionären Paris 1792, enthüllt wurde, stellte «die machtvollste kulturpolitische Veranstaltung der Restauration in der Schweiz»[117] dar – mit dem Winkelrieddenkmal dagegen entstand in Stans in den Jahren 1853 bis 1865 nach einem national durchgeführten Wettbewerb das erste Nationaldenkmal des 1848 gegründeten liberalen Bundesstaats.[118] Das schweizerische Nationalbewusstsein wurde mit diesem Denkmal genauso befördert wie wenig später mit dem Rütli und weiteren Symbolträgern. Der Rückgriff auf das Mittelalter sollte historische Legitimation verschaffen und gleichzeitig als Versöhnungsgeste den 1847 im Sonderbundskrieg unterlegenen, mehrheitlich Innerschweizer Kantonen eine zentrale, wenn auch symbolische Funktion bei der Staatsbildung zuweisen.[119] Damit wurde die Schweiz gleichermassen vom «Mythisierungsschub des 19. Jahrhunderts»[120] erfasst wie die anderen europäischen Nationen.[121] Wie schon das Winkelried-Denkmal entsprang auch der Rütli-Kauf einer Zürcher Initiative. War es beim Ersteren der freisinnige Politiker Jakob Dubs, lancierte bei Letzterem die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft die Idee. Dieser 1810 in Zürich gegründete Verein verfolgte aufklärerisch-patriotische, gemeinnützige Ziele, indem er sich für die Förderung von Bildung und Erziehung sowie wirtschaftlichen Fortschritt engagierte. Er galt als Diskussionforum reformorientierter Eliten und wirkte dadurch national integrierend und staatstragend.[122]
Die Uraufführung von Schillers Tell-Drama 1804 in Weimar wurde in der Schweiz zunächst kaum rezipiert, dennoch markiert sie einen für die Mythenformung und -wirkung zentralen Schritt: Das Theaterstück verlieh dem sich formenden schweizerischen Nationalstaat eine literarisch gefasste Meistererzählung, die zum stärksten und wirkungsmächtigsten Multiplikator des Mythos wurde. Schillers Freiheitsdrama trug wesentlich bei zur mythischen Aufladung und Möblierung der Innerschweizer Landschaft mit Denkmälern (Bild 1), einer Landschaft, die zudem Kristallisationspunkt einer neuen Naturbegeisterung wurde in Kombination mit der Gründungsgeschichte, welche die Bewohner als einfaches, aber freies und glückliches Volk erscheinen liess.[123] Praktisch zum gleichen Zeitpunkt, wie die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft den Rütli-Kauf organisierte, weihten die Innerschweizer Kantone den Schillerstein ein, eine natürliche, beim Eingang zum Urnersee an markanter Lage stehende Steinpyramide, die in ein Denkmal zu Ehren Schillers umgestaltet worden war. Gut zwei Jahrzehnte später schuf der Historienmaler Ernst Stückelberg in der Tellskapelle einen neuen Freskenzyklus, der zentrale Szenen aus Schiller darstellte. Ursprünglich geplant als Beitrag des Kantons Uri zur 600-Jahr-Jubliäumsfeier der Eidgenossenschaft, konnte das Telldenkmal in Altdorf erst 1895 eingeweiht werden.[124] Durch diese Figurengruppe, die bald – genauso wie die Stückelberg-Fresken – zur nationalen Ikonografie zählte, erhielt die Urschweizer Befreiungstradition endgültig eine nationale Überhöhung und zugleich – durch ein Schiller-Verszitat am Sockel – eine weitere explizite Schiller-Reminiszenz. 1899 kam als weitere Attraktion das Altdorfer Tellspielhaus dazu, wo bis heute Schillers Drama regelmässig aufgeführt wird. Ab 1906 verkehrte auf dem Vierwaldstättersee das neue Dampfschiff «Schiller», und mit etwas Abstand folgte in den 1930er-Jahren die Restaurierung der sogenannten Hohlen Gasse; sie liegt indessen nicht am Urnersee, sondern in der Nähe des Küssnachter Beckens.[125]
Eine weitere, geradezu objektivierte Aufwertung des Gründungsmythos initiierte der Bundesrat 1889.[126] Angeregt durch die auf 1891 festgesetzte Berner 700-Jahr-Gründungsfeier, aber auch durch den seit 1890 von der Arbeiterschaft regelmässig begangenen 1. Mai liess er eine im 18. Jahrhundert entdeckte, aber seither wenig beachtete Urkunde, datiert auf 1291, wissenschaftlich untersuchen und deuten, und zwar vom radikal-liberalen Jurist Carl Hilty und Wilhelm Oechsli, Geschichtsprofessor der ETH Zürich. Die als neues Gründungsdokument uminterpretierte Urkunde von 1291, der sogenannte «Bundesbrief» und zugleich «Nationalreliquie»[127], ersetzte nicht nur das von Tschudi imaginierte Datum von 1307, sondern auch die Vorstellung einer Verschwörung, die der Nationswerdung zugrunde gelegen haben soll. Vielmehr schien sie auf einem schriftlich fixierten Rechtsdokument zu basieren, das indes weder Eigennamen von Beteiligten, ein Ereignis noch einen Ort enthielt, geschweige denn den Schwur, Tells Heldentat oder den Burgenbruch erwähnte. Diese wissenschaftlich überformte Verschmelzung, wonach der Schwur am 1.8.1291 auf dem Rütli stattgefunden und die Schweiz begründet habe, ist bis heute wirksam.[128] Abgesehen von der fälschlichen Gleichsetzung trifft auch die Begrifflichkeit der Gründung nicht zu. Denn die Urkunde, der «Bundesbrief», bildet nur eines von vielen Bündnissen, die in ihrer unvorhersehbaren und alles andere als linearen Entwicklung schliesslich zur Gründung des Bundesstaats führten.
Gerade in den 1930er-Jahren, im Kontext der «Geistigen Landesverteidigung», gewannen das Rütli und der Schwur erneut an Gewicht. Die frontistischen Bewegungen sahen in den drei Rütli-Verschworenen heilbringende Volksführer. Diesem frontistischen Verlangen nach Erneuerung wurde die generationsübergreifende Tradierung, wie sie in den drei Rütli-Eidgenossen verkörpert waren, entgegengehalten. Die Historiografie ihrerseits bemühte sich, die historische Authentizität der Gründung zu belegen. Als Höhepunkt der «Geistigen Landesverteidigung» kann neben der «Landi», der grossen Landesausstellung in Zürich von 1939, die 650-Jahr-Feier in Schwyz und auf dem Rütli (Bilder 60 und 61) und der Rütli-Rapport von 1940 (Bild 2) auf dem Rütli gelten. General Henri Guisan versuchte damit, das Offizierskorps der Armee auf Widerstandsbereitschaft einzuschwören, und knüpfte durch die Wahl des Ortes an dessen mythischem Symbolwert an in der Hoffnung, ein neues, identitätsstiftendes Bild zu kreieren. Die militärische Lage der Schweiz war nämlich zu Kriegsbeginn äusserst prekär. Nachdem Frankreich im Frühjahr 1940 wenige Wochen nach dem deutschen Angriff kapituliert hatte, fand sich die Schweiz nunmehr umgeben von den Achsenmächten und deren besetzten Gebieten. In dieser Lage höchster Unsicherheit und Bedrohung entschied sich Guisan, die bereits im Vorfeld des Kriegs beschlossene Verteidigungsstrategie weiterzuführen. Die Idee des Réduits beinhaltete, dass bei einem deutschen Angriff die militärische Abwehrkraft in den zentralen und wirksam zu verteidigenden Alpen konzentriert würde – bei gleichzeitiger Preisgabe der wirtschaftlich und kulturell essenziellen Gebiete im vorgelagerten Mittelland.[129] Mit der zu diesem Zeitpunkt fast ausschliesslich aus Infanterietruppen bestehenden Schweizer Armee schien diese dissuasive Strategie eine realistische Verteidigungsoption darzustellen. Ab Juli 1940 verschob die Armee erste Truppenteile, mit dem sogenannten Réduitbefehl kurz vor Ende des Monats verlagerte sich ein grosser Teil der Armee in den zentralen Alpenraum.[130]
Читать дальше