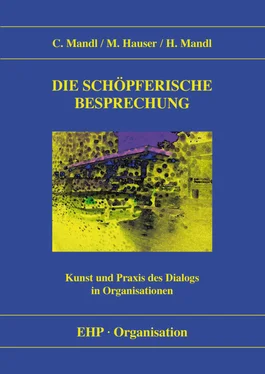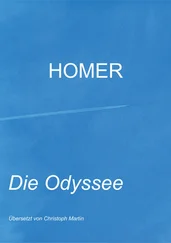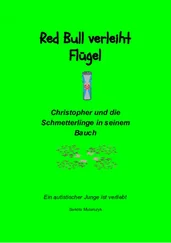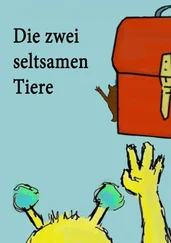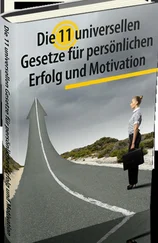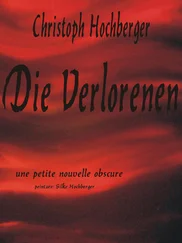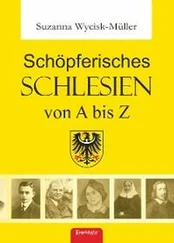Organisationsentwicklung für die Zukunft ist eine breite Darstellung der Grundlagen der lernenden Organisation von Peter Senge und zahlreichen Kollegen wie Bill Isaacs, Ed Schein und machte mit den ersten deutschsprachigen Texten von Chris Argyris zur »eingeübten Inkompetenz« und zu »defensiven Routinen« diesen wichtigen Vordenker überhaupt zum ersten Mal in Europa bekannt.
Ed Scheins Klassiker Prozessberatung für die Organisation der Zukunft ist einer der erfolgreichsten Bände der Reihe, wobei der Referenzcharakter von Scheins Büchern auch im provozierenden Buch Organisationskultur (› The Ed Schein Corporate Culture Survival Guide ‹) unter Beweis gestellt wird. Seine überaus lesbare Art zu schreiben macht auch die Lerngeschichte von Digital Equipment Corporation zu einem Genuss ( Aufstieg und Fall von Digital Equipment Corporation. DEC ist tot, lang lebe DEC ).
Neben internationalen Autoren publizieren wichtige deutschsprachige Autorinnen und Autoren sowie Newcomer im Feld in der Reihe wie zum Beispiel der Aufsehen erregende Band einer Gruppe um die VW-Coaching-Abteilung ( Der Beginn von Coachingprozessen. Vom Fall zum Konzept ), dessen Autorinnen und Autoren Billmeier, Kaul, Kramer, Krapoth, Lauterbach und Rappe-Giesecke aus der sorgfältigen gemeinsamen Analyse von Coachingfällen Qualitätsstandards für das Coaching entwickeln.
Zum ersten Mal stellte Wolfgang Loos kritische Fragen an den Coaching-Begriff, als der große Hype um den Begriff im deutschsprachigen Raum noch gar nicht richtig gestartet war: Zusammen mit K. Rappe-Giesecke und G. Fatzer untersuchte W. Looss in dem Band Qualität und Leistung von Beratung die drei Beratungsmethoden Supervision, Organisationsentwicklung und Coaching.
Loos’ Klassiker Unter vier Augen: Coaching für Manager ist immer noch unerreicht in seiner Fähigkeit, hinter die Oberfläche des Modebegriffs zu blicken und kritisch zu fragen, was Einzelberatung von Führungskräften zu leisten vermag.
Im Anliegen, das Verständnis von Menschen, Teams und Organisationen zu fördern, wird EHP-Organisation unterstützt durch die Zeitschrift Profile. Internationale Zeitschrift für Veränderung, Lernen, Dialog / International Journal for Change, Learning, Dialogue.
Die Reihe ist ganz bewusst unmodisch, und dort, wo die Professional Community der Berater, Coaches und Supervisoren ihre eigenen Grundlagen und Methoden nicht ausreichend berücksichtigt, sehen wir ein Ziel von EHP-Organisation darin, Einbahnstraßen der Wahrnehmung und kulturelle Ignoranz zu unterlaufen. Es kommen die Autorinnen und Autoren zu Wort, die diesen interkulturellen Dialog praktizieren und konzeptionell untermauern. Als Beispiele möchte ich verweisen auf die Monographie von Albert Koopman ( Transcultural Management ), die als erste ein erfolgreiches interkulturelles OE-Projekt in Südafrika dokumentierte und daraus ein breit anwendbares Modell der interkulturellen Beratung entwickelte, und auf das Buch von Barbara Heimannsberg und Christoph Schmidt-Lellek ( Interkulturelle Beratung und Mediation ), in dem die Grundlagen der Mediation auf den interkulturellen Bereich und auf die Organisationsentwicklung angewendet werden. Zuletzt erschien dazu ein Buch, das dem Lebenswerk von Burkard Sievers gewidmet ist: Ahlers-Niemann / Beumer / Redding Mersky / Sievers: Organisationslandschaft , mit seiner breiten internationalen und multiprofessionellen Perspektive auf das wichtige Thema der destruktiven Prozesse in Organisationen.
Der vorliegende Band schließt an einen Klassiker der Dialogliteratur an, den EHP-Organisation zum ersten Mal im deutschen Sprachraum bekannt machte: William Isaacs’ grundlegende Darstellung der Dialog-Methode (Dialog als Kunst gemeinsam zu denken) .
Der theoretische Hintergrund von Christoph Mandl, Markus Hauser und Hanna Mandl ist von Chris Argyris und Gergory Bateson geprägt, und mit Peter Garrett erreichen sie die beraterische Praxis. Sie führen die dialogischen Methoden zu einer Praxis der schöpferischen Besprechung in Organisationen, die nicht nur in der theoretischen Fundierung, sondern auch bei Lesbarkeit und Praktikabilität einen neuen Standard setzen wird.
Herausgeber, Autoren und Verlag möchten mit diesem neuen Band wie mit den bereits vorliegenden Titeln den Dialog mit den Lesern innerhalb der globalen Professional Community ermöglichen – seien Sie herzlich dazu eingeladen.
Gerhard Fatzer

1. Einleitung
Ich hoffe, dass vielleicht dieses Buch irgendwo für irgendwen, der in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort mit seinen eigenen Problemen ringt, nützlich sei. Falls jedoch jemand versucht, es als Handbuch zu nutzen, muss ich ihn warnen: Es gibt keine Formeln und keine Methoden. Ich kann eine Übung oder eine Technik beschreiben, aber jeder, der versucht, sie von meiner Beschreibung zu reproduzieren, wird sicherlich enttäuscht sein. Ich wäre bereit, jeden in wenigen Stunden alles zu lehren, was ich über Theaterregeln und -techniken weiß. Der Rest ist Praxis – und die kann nicht alleine getan werden. 1
– Peter Brook –
Besprechungen, Klausuren, Meetings, Sitzungen und Konferenzen sind aus unserem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Deren Bedeutung steht in unserer Gesellschaft außer Frage. Kaum eine wesentliche Entscheidung wird heute getroffen, ohne das Für und Wider zu erörtern, sei es in politischen Gremien, in Aufsichtsratssitzungen, in Vorstandsklausuren, in Geschäftsleitungsmeetings, in Projektbesprechungen oder im Rahmen des Jour fixe einer Abteilung. Kaum eine Lösung für ein schwerwiegendes Problem wird gesucht, ohne dieses in Besprechungen zu diskutieren.
All das ist nicht neu – und war doch in diesem Ausmaß vor hundert Jahren unvorstellbar. Arbeit, das war in der Blütezeit der Industriegesellschaft physische Arbeit. Da bedurfte es klarer Befehle und präziser Ausführung. Entscheidungen hatten Politiker und Unternehmer am besten alleine zu treffen. Längere Besprechungen waren Zeitverschwendung und ein Zeichen von Entscheidungsschwäche.
In dem Maße jedoch, in dem wirtschaftliche Gegebenheiten immer schwieriger zu durchschauen waren und die Wissensgesellschaft begann, die Industriegesellschaft zu überlagern, veränderte sich die Bedeutung von Besprechungen radikal: Besprechungen wurden immer notwendiger. Aber war die Art und Weise einer Besprechung auch immer passend zu ihrem Sinn und Zweck? Eine seltsame Ambivalenz entstand gegenüber Besprechungen. Sie wurden als unabdingbar, aber auch als unbefriedigend erlebt. Sie wurden immer schwieriger und anstrengender. Die Gesprächsleitung überstieg zunehmend die Fähigkeiten der Vorgesetzten und die neue Rolle des Moderators entstand. Eine neue Technik entwickelte sich: die Moderationstechnik. Gesprächsleitung wurde zur Aufgabe von Menschen mit hoher sozialer und methodischer Kompetenz. Aber auch Moderatoren waren, das wurde nach und nach deutlich, kein Allheilmittel für nicht funktionierende Besprechungen. Auch konnte nicht zu jeder Besprechung ein Moderator herangezogen werden: Eine Ministerratssitzung mit Moderator – schwer vorstellbar; eine Aufsichtsratssitzung mit Moderatorin – aus Vertraulichkeitsgründen undenkbar; ein Jour fixe mit Moderatorin zu teuer.
Die Zeit war somit reif für die Wiederentdeckung des Dialogs als adäquate Besprechungsform der Wissensgesellschaft. Diese Wiederentdeckung kündigte sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts an.
1.1 Ideengeschichte
Anfang des 20. Jahrhunderts war die Welt der Unternehmen noch vom Bild der Maschine geprägt. 2Und so wie eine Maschine am besten funktionierte, wenn sie zentral gesteuert wurde, so musste auch ein Unternehmen zentral gesteuert werden. Besprechungen dienten daher der Weitergabe zentral festgelegter Anweisungen zum Wohle der Firma. Da musste nicht viel diskutiert werden, sondern die Anweisungen waren zur Kenntnis zu nehmen und auszuführen. 3
Читать дальше