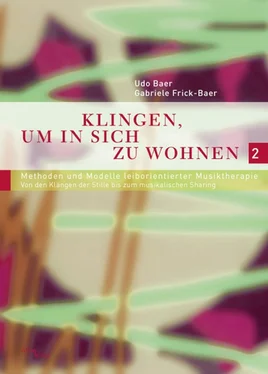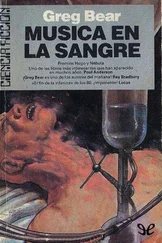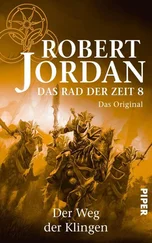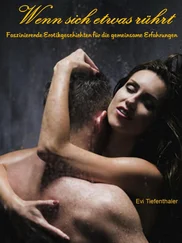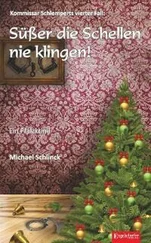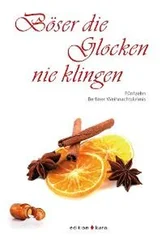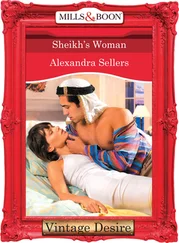Udo Baer - Klingen, um in sich zu wohnen 2
Здесь есть возможность читать онлайн «Udo Baer - Klingen, um in sich zu wohnen 2» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Klingen, um in sich zu wohnen 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Klingen, um in sich zu wohnen 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Klingen, um in sich zu wohnen 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Klingen, um in sich zu wohnen 2 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Klingen, um in sich zu wohnen 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die letzte wichtige und häufige Form sind Reinigungsgesänge. Sie sind in der Musiktherapie besonders dann notwendig, wenn Menschen sich z. B. durch Erfahrungen des Missbraucht-Werdens (nicht nur körperlich, sondern auch emotional oder geistig) und der sexuellen Gewalt, des Ausgeliefertseins und der Fremdbestimmung verunreinigt, beschmutzt oder vergiftet fühlen. „Singe für dich und vor dich hin und reinige und wasche dich mit deinem Gesang.“, oder: „Dusche dich mit deiner Stimme.“, sind Aufforderungen, die vielleicht zunächst etwas absurd oder verrückt klingen, aber die erstaunlichsten Klänge und Wirkungen der Selbsthilfe hervorrufen.Wenn die Not nicht so groß ist und eher die Lust am Sich-Reinigen im Vordergrund steht oder KlientInnen etwas Altes abstreifen, sich wie eine Schlange „häuten“ wollen, damit etwas Neues entstehen kann, dann birgt die folgende Variante des Reinigungsrituals und -gesangs gute Chancen:Man kann sich selbst oder die Körperperipherie abstreifen, abrubbeln, abkribbeln, abreiben oder andere TeilnehmerInnen einer Gruppe – so wenig oder so viel, wie man möchte – bitten, das zu tun. Entscheidend ist, dass die andere Person oder die anderen Personen währenddessen singen.
14
Wort und Klang
14.1 Der Klang der Sprache
Nehmen Sie, wenn Sie mögen, Ihr Lieblingsgedicht und lesen Sie es sich laut vor. Lauschen Sie dem Klang der Sprache. Ihnen wird vermutlich auffallen, dass diesem Text ein eigener Klang, vielleicht eine Melodie, ein Rhythmus innewohnt. Lyrik ist in unseren Ohren klingende Sprache. Lyrik spielt mit den Wortbedeutungen, mit grammatikalischen Sinnzusammenhängen, spielt aber auch mit den klanglichen Qualitäten der Wörter und Wortzusammenhänge – kurz: Lyrik komponiert Sprache.
Wer dies überprüfen möchte, kann für sich selbst oder mit TeilnehmerInnen einer Gruppe folgendes Experiment durchführen:
„Suchen Sie ein Gedicht oder eine Gedichtzeile aus, die Ihnen etwas Besonderes bedeutet. Vielleicht weist dieses Gedicht auf ein Gefühl hin, das für Sie gerade wichtig ist, oder auf eine Lebenserfahrung, die in Ihnen nachhallt.
Lesen Sie dieses Gedicht mehrmals laut vor und lauschen Sie dem Klang des Vorgelesenen …
Und begleiten Sie jetzt den Text mit einem Rhythmusinstrument …
Nun versuchen Sie, diesen Text zu singen, ihm eine Melodie zu geben …
Spielen Sie mit diesem Text musikalisch, versuchen Sie ihn musikalisch auszudrücken, ganz gleich, ob sie dabei die Worte begleiten oder mittlerweile den Text hinter sich lassen und nur das Klangbild, die klangliche Essenz des Gedichtes oder der Gedichtzeile vertonen.“
In der Therapie bilden weniger Gedichtzeilen oder andere lyrische Texte den Ausgangspunkt eines ähnlichen Experimentes, sondern eher ein eigener Text bzw. Bedeutungssätze einer Klientin oder eines Klienten. Unter Bedeutungssätzen verstehen wir, wie die Bezeichnung sagt, Sätze, die im Gespräch eines Klienten oder einer Klientin als bedeutungsvoll hervorstechen. Häufig sind das das Leben grundsätzlich bestimmende Sätze wie z. B.: „Immer komme ich zu kurz.“, „Ich habe ja nie eine Chance.“, oder „Immer ich. Ich bin immer schuld.“ Oder es handelt sich um Sätze der Selbstabwertung wie: „Immer mache ich alles falsch“, „Ich bin im Grunde ein Versager.“, oder „… eine Mogelpackung“ oder „… eine Zumutung“ oder „wäre besser gar nicht geboren“. Diese Sätze zu verklanglichen und damit hervorzuheben, herauszuheben aus ihrer selbstverständlichen und unüberprüften Existenz, ist oft ein Anfang, ihnen an Bedeutungskraft zu nehmen oder sie zumindest zu relativieren. Oft reicht es nicht, wenn KlientInnen bestimmte Aussagen für sich als falsch erkennen, es braucht das Gegenteil, die Gegenformulierung. Deshalb arbeiten wir häufig damit, dass wir die KlientInnen bitten, zu solchen Sätzen Gegen-Sätze zu bilden, individuelle Sätze, die auf diese negativen Bedeutungssätze antworten. Solche Gegenteilsätze können z. B. sein: „Ich habe das Recht geliebt zu werden.“, „Ich bin daran schuld, dass …, aber ich bin nicht daran schuld, dass …“ oder „Ich habe Mut.“ Einen solchen Gegenteilsatz zu formulieren, fällt vielen KlientInnen schwer. Noch schwerer fällt es ihnen, diesen Satz auch laut auszusprechen. Ist diese Hürde erst einmal genommen, hilft es häufig, diesen Satz auch durchzukauen, ihn zu singen, ihn zu rhythmisieren, ihn in verschiedenen Tonhöhen und Lautstärken auszusprechen etc. Dadurch wird der Satz angeeignet, erhält er eine eigene Färbung.
Der Klang der Sprache kann von großer Bedeutung für den therapeutischen Prozess sein, auch ohne dass Sätze oder Textbestandteile Ausgangspunkt sind. „Jede Stimme ist einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Nutzung der musikalischen Bausteine:
Der Rhythmus, in dem eine Stimme spricht, das Pausieren oder Fließen der Stimme, ihre Abruptheit und ihre großen Bögen.
Die Dynamik, mit der eine Stimme spricht, die Zurückgenommenheit oder Vordergründigkeit der Stimme, ihr Poltern, Bellen, Lärmen oder ihr Wispern, ihre Verhaltenheit, ihre Zärtlichkeit.
Der Klang, die Fülle oder Enge, Dichte oder Dünnheit, mit der eine Stimme immer auch Nähe oder Distanziertheit ausdrückt, ihre Dumpfheit oder Helligkeit, ihre Belegtheit oder Klarheit.
Ihre Melodie, zwischen monotoner Rezitationsstimme oder in großen, dramatischen Melodiebögen sich entwickelnd, zwischen winzigen Ausschlägen nach oben und unten, in Höhen und Tiefen schwankend, zwischen Schlichtheit oder verzierender Überladenheit, dem ‚Pathos’ einer Stimme.“ (Decker-Voigt 1999, S.159)
Wenn wir KlientInnen zuhören, vernehmen wir nicht nur die Worte, sondern lauschen auch dem Klang ihrer Sprache und lassen ihn auf uns wirken. Die Unterschiede der Sprachklänge können frappierend sein. Auffallen kann z. B.:
Ein Klient erzählt monoton im immer gleich bleibenden Rhythmus, ganz gleich ob es sich um eher belanglose Ereignisse handelt oder aufregende Dinge – im Klangbild der Sprache wird keine Gewichtung vorgenommen.
Manche KlientInnen singen ihr gesprochenes Wort. Wenn man ihnen mit geschlossenen Augen lauscht, hört man Melodien unterschiedlichen Charakters, die differenzierte Reaktionen hervorrufen.
Ein Klient nutzte die Lautstärke seiner Stimme als Barometer seines inneren Erlebens. Je aufregender es wurde, je mehr seine Erregung in die Höhe stieg, je mehr sein Herz betroffen wurde, desto leiser wurde er.
Eine Klientin erzählte und erzählte, die Therapeutin vernahm vor allen Dingen die Kraftlosigkeit im Klang ihrer Sprache. Diese rief stärkere Resonanzen in ihr hervor als die Wortaussagen. Als sie ihre Resonanz mitteilte und fragte: „Kann es sein, dass Sie keine Kraft mehr haben?“, stimmte die Klientin zu. Ihre Hauptaussage bestand nicht in den Worten, sondern im Klang ihres Erzählens.
Häufig fallen Diskrepanzen zwischen einem dramatischen Inhalt und einem monotonen, sachlichen Klangbild auf oder umgekehrt zwischen relativ beiläufigen Geschehnissen, von denen erzählt wird, und einem Klangbild des Erzählens, das einer dramatischen Verdi-Oper entspricht.
Solche und viele andere Wahrnehmungen lassen nie konkrete Schlüsse in Bezug auf die KlientInnen zu, sie gehören aber zu den leiblichen Phänomenen, die seitens der MusiktherapeutInnen Beachtung finden sollten. Musiktherapie beginnt nicht erst, wenn Instrumente erklingen oder gesungen wird. Musiktherapie beginnt, wenn einer Sprache und ihren Klängen gelauscht wird und gleichzeitig den Resonanzen, die sich aus diesem Lauschen ergeben, Respekt erwiesen wird.
14.2 Vom Gespräch zum Musizieren
Bestandteil der Musiktherapie ist auch das Sprechen. Musiktherapie ist besonders geeignet, das Unsagbare hörbar werden zu lassen und das Unerhörte zu hören. Musiktherapie kann insbesondere Menschen erreichen, die sich sprachlich nicht oder nur beschränkt ausdrücken können. Und gleichzeitig ist es für die meisten KlientInnen wichtig, für das musizierend Erlebte auch Worte zu finden. Rosemarie Tüpker sagt deshalb zu Sprache und Musik: „Die musiktherapeutische Behandlung bedarf des Austausches von Musik und Sprache. (…) Musiktherapie ist daher kein ‚non-verbales Verfahren’.“ (Tüpker 1996, S.228f) Und sie fügt hinzu, dass dies natürlich nur für die Arbeit mit den Menschen gilt, die nicht auf sprachliche Artikulation verzichten müssen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Klingen, um in sich zu wohnen 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Klingen, um in sich zu wohnen 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Klingen, um in sich zu wohnen 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.