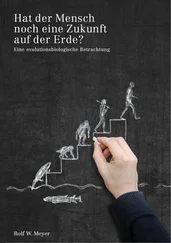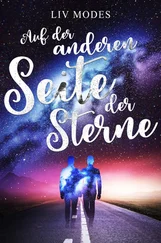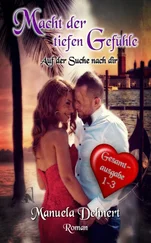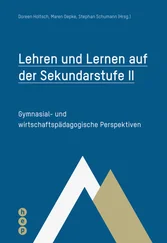Den emanzipatorischen Aspekt betont eine Studie zu Kompetenz als neuem Paradigma des Lernens in Schule und Arbeitswelt, die hauptsächlich auf die französischsprachigen Debatten rekurriert. Der Begriff wird hier als «mehr» als nur ein Modewort beschrieben, da er Ausdruck einer gesellschaftlichen Veränderung mit dem Ziel einer kritischen und selbstreflexiven Autonomie sei, was nicht ohne Auswirkungen auf die Struktur und das Verständnis von Unterricht bleibe, aber auch das Selbstverständnis der Lehrenden nicht unberührt lasse (Max 1999, 469–471). Der «Kompetenzdiskurs» scheint ein sprachgrenzenübergreifendes Phänomen zu sein, das hier wie dort ähnlich diskutiert wird.
Ein Blick in die weitere Forschungsliteratur zeigt, dass der Kompetenzbegriff sich aus mehreren und vor allem auch theoretisch, historisch und konzeptionell ganz unterschiedlichen Wurzeln nährt. Darauf haben nicht nur schon die beiden im Duden angegebenen Begriffsverwendungen hingewiesen, sondern auch begriffsgeschichtlich orientierte Studien. Das historische Wörterbuch der Philosophie beispielsweise listet unter dem Stichwort «Kompetenz» sechs Einträge auf, die sich aus römisch-rechtlicher, militärischer, öffentlich-rechtlicher, biologischer, motivationspsychologischer und sprachtheoretisch-kommunikationswissenschaftlicher Perspektive mit dem Begriff beschäftigen (Ritter u. Gründer 1976, 918–920). Vor diesem Hintergrund erstaunt nicht, dass der Eintrag «Kompetenz» aus sechs Einzelbeiträgen besteht, die jeweils zu ganz unterschiedlichen Begriffsbestimmungen gelangen.
In einem Artikel zu «Kompetenzkonzepten» werden die «Wurzeln des Kompetenzbegriffs und der darauf aufbauende Diskurs in der Erziehungswissenschaft» rekonstruiert (Klieme u. Hartig 2007, 11) und die Ursprünge in der Soziologie Max Webers, der Linguistik Noam Chomskys und in einer «pragmatisch-funktionalen» Tradition der amerikanischen Psychologie gefunden. Damit ziehen die beiden Autoren eine Traditionslinie, der in der neueren Literatur oft gefolgt wird und auf die sich die erziehungswissenschaftlich-psychologische Literatur bezieht, die sich ihrer begrifflichen Herkunft versichern möchte.
Die verschiedenen Ansätze machen deutlich, dass die Bedeutungen, die dem Kompetenzbegriff in der Forschungsliteratur und in der zeitgenössischen Schul- und Unterrichtsdiskussion zugeschrieben werden, nicht neu sind und von einem gesellschaftskritischen und die Selbstreflexion und Selbstbestimmung fördernden Potenzial bis hin zu einem empirisch messbaren Konstrukt reichen. Die Analyse der verschiedenen und eher disparaten Diskussionsbeiträge verweist indes auf einen in den pädagogischen Debatten durchaus weitverbreiteten Umgang mit Begriffen. Diese Begriffe werden relativ unabhängig von ihrer inhaltlichen Bestimmung zu einer Chiffre für ein Phänomen, das nicht klar zu definieren und zu bestimmen ist und das aus durchaus unterschiedlichen Gründen Attraktivität besitzt. In dieser begrifflichen Unschärfe können jeweils mehr oder weniger diffuse Erwartungen und Anforderungen zusammengefasst werden, die Bedeutung versprechen, auch wenn oder vielleicht gerade weil nicht präzis formuliert werden kann, was genau damit gemeint ist.[6] Allerdings können solch unscharf konzeptualisierte Begriffe durchaus definiert und die daraus entstandenen Definitionen als «wahr» oder «real» angesehen werden, ohne dass der Begriff als historisches Konglomerat von vielen verschiedenen Anforderungen, Ansprüchen und Wünschen verstanden wird, das – vielleicht nur zufällig – Diskursdominanz erhalten und in dieser Dominanz ein Eigenleben entwickelt hat, das nur noch eine sehr bedingte Verbindung zu den eigentlichen oder ursprünglichen Absichten hat.[7]
Der amerikanische Wissenschafts- und Erziehungsphilosoph Israel Scheffler (1923–2014) bezeichnete das eben beschriebene Phänomen 1960 als «pädagogischen Slogan», der im Gegensatz zu einer Definition unsystematisch sei (Scheffler 1971, 55). Ein solcher Slogan beherrsche durch seine emotionale Konnotationsfähigkeit die Diskussionen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit und gebe vor, «‹Forschungsresultate› der Pädagogik» zu bezeichnen (Reichenbach 2007, 190): «Einigermassen naiv dürfte die Annahme sein, dass der Gebrauch und die Akzeptanz von solchen Vokabularien keinen Einfluss auf pädagogisches Handeln und Denken hätte», wobei sie «auch entlastende Funktion» haben. Begriffe sind damit nicht nur Bezeichnungen für empirische Phänomene, sondern bestimmen durch ihre Begrifflichkeit auch empirische Phänomene. Oder noch pointierter formuliert: «Hinter verfänglichen Proklamationen und pathetischen Phrasen offenbaren sich immer wieder bloss die uniformierten Meinungen der tatsächlichen oder vermeintlichen Vertreter der Disziplin, die sich von den eigenen Selbstwirksamkeitsgefühlen und -wünschen haben verführen lassen» (ebd., 191).
Kompetenz wird in diesem Beitrag als ein ebensolcher «pädagogischer Slogan» verstanden, was anhand einiger Wegmarken der pädagogischen und psychologischen Verwendung dargestellt wird. Dabei geht es nicht darum, umfängliche Entwicklungslinien des Begriffs zu rekonstruieren, sondern an bestimmten Punkten der Geschichte schlaglichtartig ausgewählte Debatten in ihrem Kontext zu beleuchten, um die Vielschichtigkeit des Kompetenzbegriffs beispielhaft aufzuzeigen. Durch diese historische Kontextualisierung kann der Begriff der Kompetenz entmythologisiert und können dessen Grenzen und theoretische Verstrickungen aufgezeigt werden. Ziel ist kein wie auch immer ausformulierter «richtiger» Begriff von Kompetenz im Gegensatz zu einem «falschen» Begriff, um damit eine gültige Lesart zu bestimmen. Vielmehr geht es darum, die verschiedenen historischen Herkünfte und Wurzeln so herauszuarbeiten, dass die damit verbundenen Erwartungen oder gar «Erlösungshoffnungen» (Geissler u. Orthey 2002, 73) sichtbar werden. Die gängige Unterscheidung von Kompetenz und «totem Wissen» wird dabei als heuristisches Mittel verstanden, das heisst als eine intellektuell konstruierte Hilfe, um einen Sachverhalt deutlicher zu erfassen. Diese Unterscheidung hat sich allerdings längst zu einer empirischen Realität entwickelt, die sowohl die öffentliche als auch die wissenschaftliche Diskussion bestimmt und dazu führt, dass einigermassen «geschichtsvergessen» immer wieder neue Konzepte und Begriffe als «pädagogische Erlösung» zuerst erfreut rezipiert werden, bevor sie später enttäuscht durch neue ersetzt werden.
2 Kompetenz in der amerikanischen Curriculumreform der 1960er-Jahre
Ende der 1950er-Jahre führte der amerikanische Psychologe Robert W. White (1904–2001) den Begriff competence in die Motivationspsychologie ein. White ging davon aus, das die bis dahin dominanten psychologischen Konzepte des Behaviorismus und der Psychoanalyse an die Grenzen ihres Erklärungspotenzials gelangt seien, da Motivation allein durch Triebe nicht erklärt werden könne (White 1959, 297). Er schlug deshalb vor, diese Leerstelle in den traditionellen Triebtheorien mit dem Begriff competence zu füllen, wobei competence sich auf die Fähigkeit eines Organismus bezog, «to interact effectively with its environment» (ebd.). Mit competence wollte sich White explizit nicht an eine bestimmte Theorietradition anlehnen; er begründete die Begriffswahl vielmehr damit, dass Kompetenz in ihren alltäglichen Bedeutungen geeignet sei, «to promote an effective – a competent – interaction with the environment» (ebd., 318), was hauptsächlich anhand von Beispielen aus der Entwicklungspsychologie Jean Piagets gezeigt wurde (ebd., 317–319).
Zwei Jahre später taucht der Begriff in einer Publikation der Educational Policies Commission[8] in Verbindung mit beruflichen Fähigkeiten auf. In dieser kurzen Schrift mit dem Titel «The Central Purpose of American Education» legte die Kommission dar, was die wichtigsten Ziele der amerikanischen Erziehung und Schule seien und wie diese am besten erreicht werden könnten. Angesichts einer sich stark verändernden Arbeitswelt, die immer mehr ausgebildete Fachkräfte brauche und immer weniger Arbeitsplätze für Ungelernte biete, sei die Steigerung der vocational competences eine dringende Aufgabe der Schule, wobei diese berufliche Kompetenz durchaus auch auf developed rational capacities angewiesen sei (Educational Policies Commission 1961, 6). Kompetenz baute also auf intellektuelle Stärken und war nicht als ihr Gegenkonzept gedacht. Allerdings war zum Bedauern der Kommission die konkrete Entwicklung der rational capacities bzw. der rational powers in der bisherigen Forschung noch kaum Thema gewesen: «The psychology of thinking itself is not well understood» (ebd., 13), weshalb es auch keine spezifischen Programme gebe, «to develop intellectual power» (ebd., 16).
Читать дальше