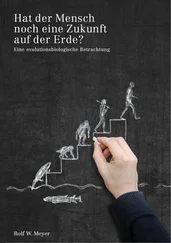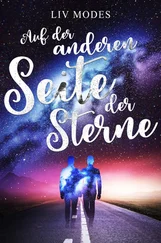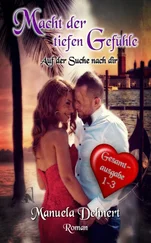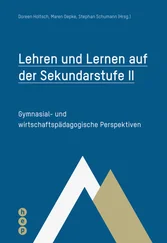Geplant war ein Studienbuch für angehende Sekundarlehrpersonen, das als Teil eines Projekts der Abteilung Sekundarstufe I an der Pädagogischen Hochschule Zürich die Absicht verfolgte, das Thema «Kompetenzorientierter Unterricht» in Modulen der Ausbildung zur Lehrperson zu verankern. Entstanden ist – auch dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Luzern – ein Werk von Autorinnen und Autoren beider Hochschulen, das in dieser Form aber auch weitere an Bildung beteiligte Kreise erreichen kann und soll. Das Buch richtet sich somit an Studierende in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Lehrpersonen, Schulleitende, aber auch an Interessierte aus Bildungspolitik, Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik und ist – trotz Orientierung am schweizerischen Bildungssystem – sicher auch in anderen deutschsprachigen Ländern gewinnbringend zu lesen.
Dank
Eine solche Publikation wäre nicht möglich ohne finanzielle und zeitliche Ressourcen, wofür ich mich bei den Verantwortlichen der Pädagogischen Hochschulen Zürich und Luzern – namentlich bei Esther Kamm und Werner Hürlimann, die sich massgebend für das Projekt eingesetzt haben – herzlich bedanke. Für die inhaltliche Qualität gilt es dann aber in erster Linie den beteiligten Autorinnen und Autoren zu danken, die ihr grosses fachliches Wissen – auf Kompetenzorientierung fokussiert – zu Papier gebracht haben und ein Reviewing durch ausgewiesene Expertinnen und Experten (auch diesen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!) nicht scheuten. Für die Illustrationen (auf dem Titelblatt und den Kapitelöffnerseiten) danke ich Donat Bräm, der in den Schulhäusern der Oberstufen Stadel und Pfäffikon ZH fotografieren durfte, weshalb deren Schulleitenden ebenfalls ein herzlicher Dank gebührt. Robert Fuchs bin ich für das Begleiten der vertraglichen Verhandlungen ebenso zu Dank verpflichtet wie den Mitarbeitenden des hep-Verlags für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Nun wünsche ich dem Werk viel Erfolg und hoffe, es möge den Lesenden kompetenzorientierten Unterricht näherbringen und zur fundierten Diskussion darüber anregen, aber auch – und darum muss es schliesslich gehen – guten Unterricht bewirken und so die Schülerinnen und Schüler erreichen!
Zürich, im Frühling 2016
Marcel Naas (Herausgeber)
TEIL 1 – ERZIEHUNGS WISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN
Teil 1
Erziehungswissenschaftliche Perspektiven

HISTORISCHE PERSPEKTIVE | Rebekka Horlacher
Historische Perspektive
Der Beitrag beschäftigt sich in einer historischen Perspektive mit dem Begriff der Kompetenz und widmet sich zuerst den verschiedenen Verwendungen von Kompetenz in der aktuellen Diskussion. Damit verbunden wird die Frage, ob Kompetenz ein pädagogischer Slogan sei. Anschliessend werden drei Wegmarken der pädagogischen oder psychologischen Verwendung des Kompetenzbegriffs in ihrem Kontext dargestellt: die Debatte um die amerikanische Curriculumreform der 1960er-Jahre, die erziehungswissenschaftliche Unterscheidung von Selbstkompetenz, Sachkompetenz und Sozialkompetenz in den 1970er-Jahren sowie die Diskussion um die Frage, ob der Begriff der Kompetenz den oft kritisierten Bildungsbegriff ablösen könne. Das abschliessende Kapitel diskutiert die in den verschiedenen Debatten sichtbar gewordene Unterscheidung von Kompetenz und «totem Wissen» und fragt nach deren Bedeutung für die bildungspolitische und wissenschaftliche Diskussion.
Kompetenz wider das «tote Wissen» oder: Ein Kampf gegen Windmühlen?
Rebekka Horlacher
Es ist eine bemerkenswerte Eigenheit pädagogischer Diskussionen, dass darin immer wieder neue Begriffe auftauchen, die breite Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zu eigentlichen Modebegriffen werden. Diese Begriffe versprechen in der Regel, etwas Neues und noch nie Dagewesenes, aber dennoch Wichtiges und Essenzielles zu bezeichnen und die pädagogische Theorie oder Praxis (besser noch beide) entweder zu revolutionieren oder doch zumindest entscheidend neu zu gestalten und zu verbessern.
Die hier beschriebene Funktion eines Modebegriffs hat seit einiger Zeit der Begriff der «Kompetenz» übernommen, der nicht nur in der Bildungspolitik und in der Lehrerbildung in aller Munde ist, sondern auch in allen möglichen Verbindungen gebraucht wird, von der Sozialkompetenz in Stellenausschreibungen über das Schweizer Kompetenz Centrum für Gesundheit und Prävention (SKC) mit dem Ex-Fussballer Alain Sutter als «stolzem Mitglied des SKC Netzwerks»[3] bis hin zur transkulturellen Kompetenz als Weiterbildungsangebot des Roten Kreuzes. Damit hat sich «Kompetenz» zu einem eigentlichen Zauberwort des Unterrichts, der Schule, der Berufsbildung und der bildungspolitischen Debatte entwickelt. Der Begriff hat aber auch eine vielstimmige Opposition hervorgerufen, die ihm auf unterschiedlichen Ebenen skeptisch bis ablehnend gegenübersteht. «Kompetenz» wird dabei als Verkörperung eines eher sinnlosen Reformeifers verstanden, als Anfang vom Untergang der abendländischen (Bildungs-)Tradition, als Kniefall vor der Dominanz der Leistungsmessung und der Output-Steuerung im Bildungswesen, ja sogar als Trojanisches Pferd im Kampf um die Vereinheitlichung des Schweizerischen Bildungswesens, was den Verlust der kantonalen Souveränität in Bildungsfragen zur Folge hätte.
Die Verfechter des Kompetenzbegriffs setzen in ihrer Anwaltschaft der Kompetenz oft den Begriff des «toten Wissens» entgegen, wobei dieser eine Art von Wissen bezeichnet, das keine praktischen Konsequenzen habe bzw. in praktischen Situationen nicht angewendet werden könne. Es werde also nur für Prüfungen oder für die Schule gelernt, so der oft formulierte Vorwurf, weshalb Gelerntes, sobald die Prüfungs- oder Schulsituation vorüber sei, sofort wieder vergessen werde. Kompetenz dagegen verweise auf ein tätiges oder aktives Wissen, mit dem in konkreten Situationen aktiv gehandelt werden könne und das deshalb praxisrelevant und bedeutungsvoll sei und für diejenigen, die darüber verfügten, einen tatsächlichen Mehrwert biete.[4]
Gemäss der aktuellen Ausgabe des Dudens hat der Begriff «Kompetenz» zwei Hauptbedeutungen. Er bezeichnet einen bestimmten Sachverstand oder eine Fähigkeit und knüpft damit an die Verwendung innerhalb der römischen Rechtslehre im Sinne von kompetent als «zuständig», «befugt», «rechtmässig» oder «ordentlich» an (Grunert 2012, 39). Zudem beschreibt Kompetenz in den Sprachwissenschaften die Summe aller sprachlichen Fähigkeiten, die eine muttersprachliche Person besitzt. Von einer explizit pädagogischen oder psychologischen Verwendung ist im Duden nicht die Rede.
Ein – gemäss Eigenwerbung – «Standardwerk» der Psychologie, das «seit vielen Studentengenerationen […] eine umfassende Orientierung über Grundlagen, Konzepte und Begriffe der Psychologie ermöglicht»,[5] der «Dorsch», definiert «Kompetenz» als kontextspezifische «Leistungsdisposition» bzw. als «Leistungspotenzial», das stärker als das Konzept der Intelligenz den Handlungsaspekt betone und damit den Kontext berücksichtige (Wirtz 2015). Während der Kompetenzbegriff in der psychologischen Forschung noch als einigermassen klar definiert gelten könne, so ist weiter zu lesen, treffe das für eine pädagogische Verwendung nicht mehr unbedingt zu. Kompetenz werde im pädagogischen Feld zum Teil auch als «Persönlichkeitsdimension verstanden, die sich umfassend auf die ‹fühlenden, denkenden, wollenden und handelnden Individuen› während ihrer lebensbegleitenden Lern- und Entwicklungsprozesse bezieht», was «ein lebenslanges und zunehmend selbstgesteuertes» Lernen ermögliche, wobei der Lernende selbstverantwortlich in pädagogisch gestalteten Lernumgebungen agieren soll. Ein «solch umfassender Definitionsansatz» könne nur dann empirisch nutzbar gemacht werden, wenn er in analytisch zugängliche Konstrukte aufgeteilt werde (ebd.). Der Begriff der Kompetenz ist – das muss aus diesem Lexikoneintrag geschlossen werden – im pädagogischen Kontext ein Konglomerat unterschiedlicher Versatzstücke mit höchst bedingter empirischer Nutzbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit, dafür aber mit hohen Erwartungen verbunden.
Читать дальше