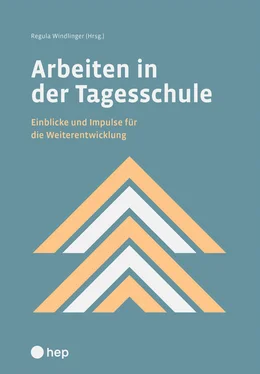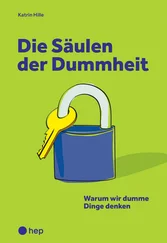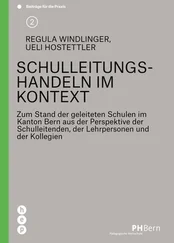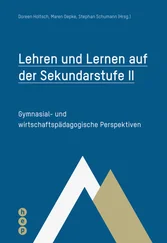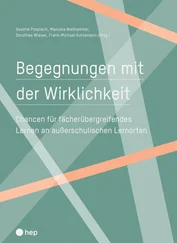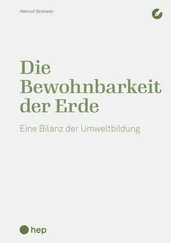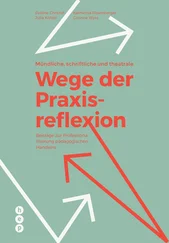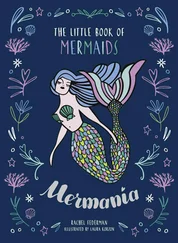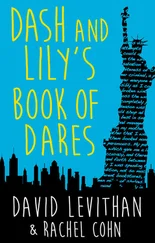So zeigt sich schon an der einfachen Frage der Mittagstischbetreuung deutlich, dass es bei der Frage der Kooperation nicht nur um unterschiedliche fachliche Kulturen geht, sondern um handfeste Anstellungsfragen, die es zu lösen gilt.
Handlungsbedarf in Bezug auf Arbeits- und Anstellungsbedingungen besteht in einer Optimierung der Kooperation. Empfehlenswert wäre die Verteilung der vorhandenen Pensen beim nichtschulischen Personal auf weniger Personen mit höheren Anstellungsprozenten. Mittelfristig sollten zwingend, wie oben ausgeführt, Vollzeitstellen geschaffen werden. Ausserdem muss das Personal zur Verbesserung der Kooperation qualifiziert sein oder entsprechend fortgebildet werden. Ferner sollten die Lohnstrukturen in der Betreuung angepasst werden. Die Löhne müssen in einem begründeten Verhältnis zu den Löhnen der Lehrpersonen stehen.
Im Kontext der Tagesschulentwicklung stehen auch die Lehrkräfte und Schulen vor neuen Anforderungen. Dabei geht es um die grundlegende Frage, wie das Arbeitszeitmodell der Lehrkräfte zu gestalten ist. Eine Tagesschule mit pädagogischem Mehrwert (also eine Schule, die mehr sein will als die bisherige Schule mit anschliessendem Betreuungsangebot) führt zwangsläufig zu neuen Arbeits- und Präsenzzeiten der Lehrpersonen. Für die Einbindung der Lehrpersonen in die Betreuung müssen daher neue Arbeits- und Anstellungsmodelle entwickelt werden, die auch in die Ausbildung einfliessen.12 Die Aufgaben der Lehrpersonen in der Betreuung müssen zeitlich und inhaltlich klar definiert und diskutiert werden. Wenn es über konkrete Betreuungsaufgaben hinaus eine Präsenzpflicht für Lehrpersonen im Schulhaus gibt, braucht es zudem ruhige Arbeitsplätze für die Lehrpersonen in Räumlichkeiten, die für die Kinder nicht zugänglich sind.
2.4 Professionalität, Berufsauftrag und Anerkennung
In der Einleitung zum vorherigen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, dass es für die Betreuung keinen präzise definierten Berufsauftrag gibt. Aus Perspektive der Schule wird die Betreuung mehrheitlich als eine Art Reparaturbetrieb angesehen. Sie soll auffangen, was in der Schule aus institutionellen Gründen zu kurz kommt und von den Familien nicht (mehr) geleistet wird. Sprachförderung, Hausaufgabenhilfe und Integration oder Unterstützung von «schwierigen» Kindern sind die Anforderungen, die in diesem Kontext häufig genannt werden. Betreuung wird in dieser Sichtweise als Verlängerung der Schule in unterrichtsfreie Randstunden interpretiert.
Aus Perspektive einer sozialpädagogisch fundierten Betreuung sind die genannten Aufgaben Teil eines viel umfassenderen Auftrags. Während der Schwerpunkt der Schule bei der formalen (und gesetzlich stark geregelten) Bildung liegt, stehen in der Betreuung die nonformalen Bildungsprozesse und -ziele im Vordergrund. Kinder sollen lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und Gemeinschaftsfähigkeit zu erlangen. Dazu müssen sie persönliche und soziale Kompetenzen kennenlernen und anwenden können.
Der Alltag in der schulergänzenden Betreuung soll die Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Kinder fördern. Die Kinder sollen an der Alltagsgestaltung beteiligt werden und Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Die SEBB sorgt für adäquate Rahmenbedingungen, um den Entwicklungsaufgaben des Kindes- und frühen Jugendalters gerecht zu werden. Das Austragen von Konflikten ohne Eingreifen von Erwachsenen und das Sich-Zurechtfinden in der Gemeinschaft sind zwei der Kompetenzen, die es sich anzueignen gilt.
Aus dieser relativ knappen Zusammenfassung lässt sich der sozialpädagogische Auftrag der Fachpersonen in der Betreuung ableiten. Sie sollen Schutz bieten, die Persönlichkeitsentwicklung fördern, Beteiligung ermöglichen, mit den Kindern Konfliktfähigkeit und Kommunikationsformen einüben, Kulturtechniken lehren und den Umgang mit den modernen Medien erarbeiten, Freizeitgestaltung einüben und die Kinder darin unterstützen, Verantwortung für sich und ihre Lebensgestaltung zu übernehmen (vgl. Flitner, 2017).
Um diese vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, sind einerseits materielle, infrastrukturelle und personelle Ressourcen notwendig. Anderseits sind Selbstreflexion, professionelles Handeln und Know-how über die Entwicklung und Bedürfnisse der Kinder essenziell. Die Arbeits- und Anstellungsbedingungen weisen darauf hin, dass die Vielfalt und Wichtigkeit dieser Aufgaben im öffentlichen Diskurs und in der Politik aktuell nicht ausreichend anerkannt werden, wodurch die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht hergestellt werden (Räumlichkeiten, pädagogisch begründete Stellenschlüssel, Vor- und Nachbereitungszeit, ausreichend qualifiziertes Personal, Weiterbildung, Supervision).
Dem Beruf der Erzieherinnen in der schulergänzenden Betreuung wird die Professionalität nur teilweise zuerkannt. Dazu tragen die scheinbare Nähe zur Familienarbeit, der hohe Frauenanteil und die unklaren Zugangsvoraussetzungen bei, ebenso die Tatsache, dass es keinen Branchenverband gibt und auch keine einheitlich festgelegten Berufswerte und Verhaltensnormen (vgl. Rudow, 2017, S. 70).
Bis zur vollständigen beruflichen Anerkennung als ernst zu nehmende Profession auf der Grundlage von spezifischen Fachkenntnissen muss sich noch einiges tun. Eine Reihe von Voraussetzungen muss hierbei erfüllt sein. Unter anderem braucht es exakte Funktionsbeschreibungen, die Bewertung der Erziehungsarbeit als gesellschaftlich wertvolle und vielschichtige Tätigkeit, klare Anforderungs- und Ausbildungsprofile, wissenschaftlich begründetes Fachwissen, anerkannte Qualitätskriterien und die Definition von Berufswerten, also eine Art Berufskodex (vgl. Rudow, 2017, S. 71ff). Die Formierung eines Branchenverbands, der sich für die Definition und Verbreitung seiner Grundlagen und Zielsetzungen einsetzt, um die Diskrepanz zwischen beruflichen Anforderungen und öffentlicher Anerkennung zu verringern, wäre ein Meilenstein in der Entwicklung der SEBB.
Am Beispiel der vier Themen «Rahmenbedingungen», «Arbeitsorganisation», «Kooperation» und «Anerkennung» ist deutlich geworden, welche Auswirkungen die heterogenen, teilweise prekären Arbeits- und Anstellungsbedingungen des Betreuungspersonals und die ungenügende Anerkennung der Arbeit auf die Entwicklung der Tagesschulen haben. Während sich bei einigen Punkten problemlos auf der Ebene der einzelnen Einrichtungen Lösungen entwickeln lassen, braucht es bei der Mehrheit der Fragen eine grundsätzliche Überprüfung, welche Ziele mit der schulergänzenden Betreuung verfolgt werden sollen. Die öffentliche Hand als wichtige Auftraggeberin und Investorin nimmt die Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung, die in den Anstellungs- und Arbeitsbedingungen stecken, ungenügend wahr. Es ist offensichtlich, dass das Potenzial der Ganztagsbildung bisher bei Weitem nicht ausgeschöpft wird. Ob es jemals dahin kommt, ist in erster Linie eine Frage des politischen Willens. Konkret stellt sich die Frage, ob und wann die Schule den Schritt in Richtung auf eine ganztätige Bildungseinrichtung gehen wird und ob die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, die den Raum dafür schaffen, dass das Personal gute Arbeit leisten kann. Dafür würde es in der Schweiz eine Gesamtstrategie zur systematischen Entwicklung von Ganztagsschulen brauchen.
Der erste notwendige Schritt wäre eine klare Entscheidung und ein deutlicher politischer Auftrag der zuständigen Erziehungsdirektorenkonferenz sowie des Bundes, dass die Entwicklung der Tagesschulen als Form der Ganztagsbildung vorangetrieben werden soll.
Blöchliger, O.R. & Bauer, G.F. (2014). Arbeitsbedingungen und Gesundheit des Kindertagesstätten-Personals in der Stadt Zürich. Eine repräsentative, quantitative und qualitative Befragung des Personals in Kitas in der Stadt Zürich durch das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) der Universität Zürich. Zürich: Sozialdepartement der Stadt Zürich.
Читать дальше