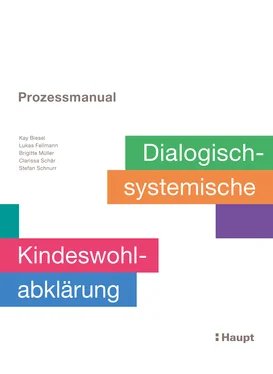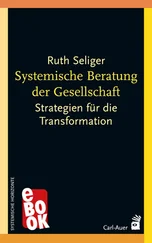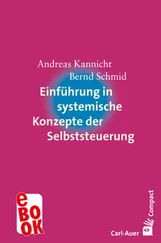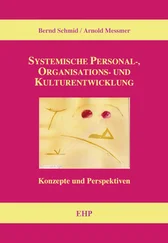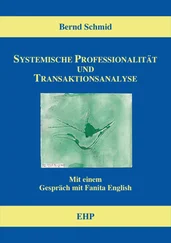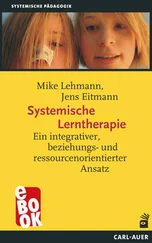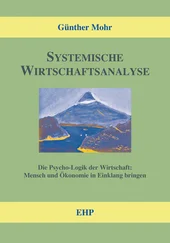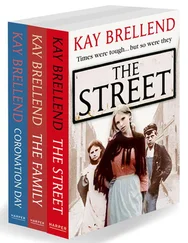systematisch Informationen über einen Fall von Kindeswohlabklärung zu sammeln und zu ordnen,
mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Fall zu blicken und
Hypothesen über den Fall zu formulieren, zu prüfen und gegebenenfalls wieder zu verwerfen und durch plausiblere zu ersetzen (vgl. Schrapper 2012).
Die vier Standards diagnostischen Fallverstehens
Das Prozessmanual orientiert sich dabei an vier grundlegenden Standards diagnostischen Fallverstehens, die für das gleichrangige Zusammenspiel rekonstruktiver und klassifikatorischer Vorgehensweisen von Heiner (2011, S. 246f.) entwickelt wurden. Die (1) Partizipative Orientierung will Fachpersonen dazu anleiten, «dialogisch, aushandlungsorientiert und beteiligungsfördernd» (Heiner 2011, S. 246) vorzugehen und auch divergierende Ansichten offen anzusprechen; die (2) Sozialökologische Orientierung will gewährleisten, dass Fachpersonen das soziale Umfeld, die relevanten Infrastrukturen und Institutionen (inklusive Rolle und Auftrag der Fachpersonen), die materiellen Lebensbedingungen wie auch die situative Einbettung der Handlungsweisen der Klient/innen systematisch einbeziehen; die (3) Multiperspektivische Orientierung soll dazu dienen, eine möglichst komplexe Sicht von Problemlagen und Ressourcen zu erarbeiten, wobei biografische Dimensionen ebenso bedeutsam sein können wie beispielsweise die Wechselwirkungen von Handlungen verschiedener Familienmitglieder; die (4) Reflexive Orientierung bezieht sich auf das Vorgehen der Fachpersonen im Prozess des diagnostischen Fallverstehens; sie soll gewährleisten, dass Einschätzungen und Befunde systematisch überprüft und wenn nötig korrigiert werden. Die reflexive Orientierung umfasst darüber hinaus die fortlaufende, selbstkritische Reflexion des Vorgehens im diagnostischen Prozess.
Fachpersonen, die Kindeswohlabklärungen nach dem «Prozessmanual. Dialogisch-systemische Kindeswohlabklärung» durchführen, gehen achtsam und fehleroffen vor. Sie gestalten Abklärungsprozesse respektvoll, aushandlungsorientiert und beteiligungsfördernd. Sie haben ein multifaktorielles, mehrgenerationales und interaktionsbezogenes Problemverständnis. Ihre Arbeitsweise ist partizipativ, multiperspektivisch und reflexiv. Ihr Anliegen ist es, in der Begegnung und im Austausch mit Eltern und Kindern sowie weiteren Fachpersonen vor dem Hintergrund eines dialogisch-systemischen Erkenntnis- und Interventionsmodells herauszufinden, was das Problem bzw. der Fall ist. Ihr Anliegen ist es, mit Eltern und Kindern sowie weiteren Fachpersonen wahrzunehmen, zu erkunden und zu verstehen, was Ursachen und Folgen von kindeswohlgefährdenden Situationen sind oder waren, um auf dieser Basis einen gemeinsamen Plan zur Förderung und Sicherung des Kindeswohls zu entwickeln und zu realisieren. Für sie sind Einschätzdimensionen von Relevanz, denen sie in verschiedenen Schlüsselprozessen dialogisch-systemischer Kindeswohlabklärung unter Verwendung von Verfahren und Instrumenten der Risiko- und Kindeswohleinschätzung sowie Methoden des Fallverstehens und der sozialen Diagnostik Aufmerksamkeit schenken:
2.2 Schlüsselprozesse dialogisch-systemischer Kindeswohlabklärung im Überblick
Schlüsselprozess Ersteinschätzung
Hinweise auf Gefährdungen des Kindeswohls entgegennehmen und einschätzen. Klären, welche weiteren Informationen erforderlich sind. Klären, ob und in welcher Frist eine Kontaktaufnahme erforderlich ist, um eine Kindeswohlgefährdung auszuschliessen.
Gegenstand der Beurteilung
Glaubhaftigkeit und Dringlichkeit von Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung
Einschätzdimensionen
• Informationsgehalt der Meldung
• Schweregrad der vermuteten, geschilderten, beobachteten Gefährdung des Kindeswohls
• Glaubhaftigkeit und Kooperationsbereitschaft der meldenden Person
Methoden
• Erkundungsgespräche
• Recherche: Weitere Informationen zum Fall einholen und bewerten (Gespräche, Akten usw.)
• Kollegiale Beratung
Instrumente
• Meldebogen (DJI)
Schlüsselprozess Kindeswohleinschätzung
Bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung klären, ob Sicherheit und Grundversorgung des Kindes gewährleistet sind. Falls nicht, ob Sofortmassnahmen zum Schutz des Kindes erforderlich sind.
Gegenstand der Beurteilung
Grad der Gewährleistung der Grundversorgung und Sicherheit des Kindes
Einschätzdimensionen
• Erscheinungsbild und Entwicklungsstand des Kindes (und seiner Geschwister)
• Erscheinungsbild, Personenmerkmale, Lebenssituation und Erziehungspraxis der Eltern (Alter, Gesundheit, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Aufenthalt; Haltung der Eltern zum Kind, Sichtweisen der Eltern in Bezug auf das Kind, Aufsicht, Versorgung und Entwicklungsförderung)
• Lebensumstände des Kindes und seiner Familie (materielle Absicherung; Unterkunft; Wohnverhältnisse, Nachbarschaft, soziale Integration; Betreuungssituation in der Familie; Integration und Sicherheit in ausser-familiärer Kinderbetreuung, Kindergarten, Schule)
Methoden
• Einzelgespräche mit Eltern, Verwandten und Bekannten
• Gespräche mit Kindern und Jugendlichen
• Elterngespräche
• Gespräche mit Fachpersonen
• Familiengespräche
• Das Drei-Häuser-Modell
• Das Feen-Zauberer-Tool
• Hausbesuche
• Mapping (Falllandkarte)
• Recherche: weitere Informationen zum Fall einholen und bewerten (Gespräche, Akten usw.)
• Kollegiale Beratung
Instrumente
• Überprüfung des sofortigen Handlungsbedarfs (Berner und Luzerner Abklärungsinstrument zum Kindesschutz)
• Prüfbogen «Sofortreaktion bei Meldung einer Kindeswohlgefährdung» (DJI)
• Prüfbogen «Einschätzung der Sicherheit des Kindes» (DJI)
Schlüsselprozess Sofortmassnahmen
Art, Umfang und rechtlichen Rahmen von Sofortmassnahmen zum Schutz des Kindes klären und diese einleiten.
Gegenstand der Beurteilung
Art und Umsetzung einer Sofortmassnahme
Einschätzdimensionen
• Notwendigkeit und Geeignetheit einer Sofortmassnahme
• Voraussichtlicher Zeitrahmen der Sofortmassnahme
• Kooperationsbereitschaft der Eltern während und nach der Einleitung von Sofortmassnahmen
Methoden
• Gespräche mit Fachpersonen
• Einzelgespräche mit Eltern, Verwandten und Bekannten
• Gespräche mit Kindern und Jugendlichen
• Elterngespräche
• Familiengespräche
• Kollegiale Beratung
• Notfallkonferenz
Schlüsselprozess Kernabklärung
Im Kontakt mit Kind und Eltern Status und Umstände der Gewährleistung des Kindeswohls differenziert beschreiben, allfällige Gefährdungslagen sowie gefährdende Zustände, Ereignisse und Praxen identifizieren und deren Hintergründe, Kontextbedingungen und (wahrscheinliche) Wirkungen klären.
Gegenstand der Beurteilung
Grad der Gewährleistung der Grundbedürfnisse und Rechte des Kindes
Einschätzdimensionen
• Bedürfnisse und Belastungen des Kindes
• Bedürfnisse und Belastungen der Eltern
• Qualität elterlichen Erziehungshandelns
• Qualität der elterlichen Paarbeziehung
• Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen
• Entwicklungsgeschichte und Funktionsweise der Familie
• Ressourcen und Stärken des Kindes
• Ressourcen und Stärken der Eltern
• Mitwirkungsbereitschaft der Eltern
Methoden
• Krisen- und Ereignisweg der Familie
• Zeitstrahl
• Genogrammarbeit
• Familienlandkarte
• Netzwerk-/Umweltkarte
• Kinder-Ressourcenkarte
• Eltern-Ressourcenkarte
• Kinderfotoanalyse
• Familien-Helfer-Map
• Familienfotoanalyse
Читать дальше