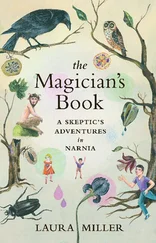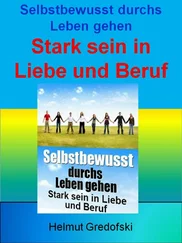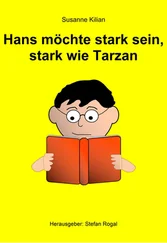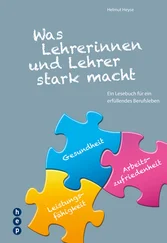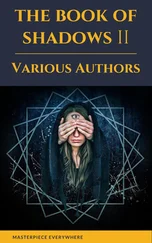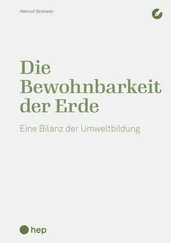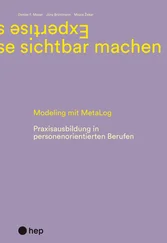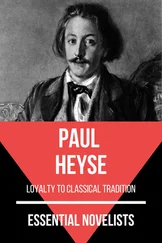•Mitglieder von Schulleitungen tun sich zusammen, um ihre Führungskompetenz zu verbessern, z. B. in Sachen Partizipation, Kooperation.
Viele Entwicklungsanliegen können engagierte Kolleginnen und Kollegen in Eigenregie bewältigen; manchmal braucht es externe Spezialisten für besondere Diagnosen und unterstützende Maßnahmen. Beginnen Sie mit dem, was Ihnen für Ihre Schule sinnvoll, notwendig und erfolgversprechend erscheint. Das ein oder andere kann man auch gleichzeitig und unabhängig voneinander in Angriff nehmen.
Darüber hinaus steht es selbstverständlich jedem frei, sich mithilfe unserer Anregungen selbstgesteuert weiterzuentwickeln (→ Kapitel 9; siehe dazu auch Sieland & Heyse, 2010; Heyse, 2011, 2016).
| Hinweis: Lassen Sie sich Zeit beim Lesen!In den Kapiteln streuen wir immer wieder themenbezogene Denkanstöße ein, mit denen man auch im Kollegium nach praktikablen Verbesserungsmöglichkeiten suchen kann. Wir regen die Leserinnen und Leser an, jede/n einzelne/n und als Kollegium, die Gedanken in diesem Buch immer wieder unter der Perspektive zu reflektieren, wie die jeweiligen Themen an ihrer Schule gehandhabt werden und welche Erfahrungen sie damit machen. Sie könnten sich bei jedem Kapitel fragen: «Was davon sollten wir nutzen, um unsere Schule qualitativ auf einem guten Stand zu halten und um gesundheitsfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen?» – «Wo stehen wir schon gut da, wo sollten wir nacharbeiten?» – «Wie können wir davon profitieren, um unsere internen Ressourcen zu stärken, unsere Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit zu fördern und unnötige Belastung für uns und die Schülerschaft zu reduzieren?» |
Die Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über die Kapitel des Buches.

Abbildung 1: Kapitelübersicht
| Hinweis: Kapitelübersicht und Arbeitshilfen |
| In den ersten beiden Kapiteln geht es darum, wie Schulen auf die Herausforderungen antworten, die der Wandel in der Gesellschaft und im Umfeld von Schulen mit sich bringt, und unter welchen Bedingungen ihnen das mithilfe von Projekten und dgl. gut gelingen könnte. |
| In weiteren Kapiteln widmen wir uns acht Themenfeldern bzw. schulinternen Ressourcen, die wir für eine erfolgreiche und gesundheitsfreundliche Erledigung der Tagespflichten und der Mitarbeit an Veränderungsprojekten für bedeutsam erachten. Anstelle einer inhaltlichen Beschreibung formulieren wir dazu jeweils einige thematische Fragen. Damit können Sie herausfinden, ob das Kapitel für Sie selbst und Ihr Kollegium interessant sein könnte. |
| In Abbildung 2 am Ende dieses Kapitels können Sie eintragen, wie wichtig Ihnen Verbesserungen in dem Bereich sind, der in dem jeweiligen Kapitel angesprochen wird. |
| Wir haben uns bemüht, die Kapitel so zu schreiben, dass sie weitgehend voneinander unabhängig gelesen werden können. Sie als Leserinnen und Leser sollen selbst entscheiden, womit Sie sich beschäftigen wollen. Das ermöglicht Ihnen zwar auszuwählen, aber dadurch lassen sich Redundanzen im Text nicht ganz vermeiden. Wir waren jedoch bestrebt, durch Querverweise Bezüge zu anderen Kapiteln herzustellen.2 |
| Am Ende der Kapitel bieten wir Ihnen jeweils zusammenfassend einige Fragen, die Sie vielleicht im Kollegium, mit Schülerinnen und Schülern und in Elternbeiräten ansprechen könnten. |
| Wir verweisen im Text an passender Stelle auf Arbeitshilfen, die Sie von der Internetseite des hep-Verlags herunterladen können ( http://mehr.hep-verlag.com/kollegien_stark_machen). Auch Abbildung 2 können Sie von dort herunterladen und ausdrucken. Es steht Ihnen frei, diese Arbeitshilfen für Mitglieder Ihres Kollegiums, die nicht über das Buch verfügen, auszudrucken und sich zu dem jeweiligen Thema auszutauschen. |
| Darüber hinaus bieten wir Ihnen dort auch eine Liste mit den Links, die in diesem Buch genannt werden, sowie eine Sammlung von Webadressen zum Thema dieses Buches. |
1. Auf den Wandel antworten[2]
Gesellschaftliche, politische, regionale und schulinterne Entwicklungen und Umbrüche verlangen von der Schule Antworten. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich fragen, wie sie es schaffen können, sich immer wieder veränderten Bedingungen anzupassen und ihre Schule auf dem Stand der fachlichen Diskussion und der gesellschaftlichen Herausforderungen zu halten. Es werden drei Ansatzpunkte diskutiert. Wie steht Ihre Schule diesbezüglich da? (→ Abbildung 2)
2. Gelingensbedingungen für Entwicklungsarbeit
Die Anpassung an den Wandel verlangt Entwicklungsarbeit und professionelles Problemlösen. Dem stehen zahlreiche Risiken, Hindernisse und Erschwernisse entgegen, wie sie jedwede Veränderung des Status quo mit sich bringt. Es müssen bestimmte Gelingensbedingungen beachtet werden. Wir machen Vorschläge, wie man mit Änderungsresistenz konstruktiv umgehen kann, und erläutern Strategien zur Förderung der Änderungsbereitschaft/-motivation im Kollegium. Die Ausführungen sollen das Kollegium und die Schulleitung für diesbezügliche Stärken und Schwächen sensibilisieren – auch in ihrer Alltagspraxis. Das Konzept der Salutogenese kann dabei helfen. Wie steht Ihre Schule diesbezüglich da? (→ Abbildung 2)
3. Leitbilder und Schulethos
Haben wir Leitbilder für unsere pädagogische Arbeit, die uns persönlich, aber auch gemeinsam motivieren, an denen wir unser Tun orientieren können und die bei aller alltäglichen Mühe und Routine Sinnerfahrungen ermöglichen? Sind diese Leitbilder handlungsrelevant formuliert?
Kennen die Schülerschaft, das Schulpersonal und die Schüler-Eltern ihre Rollenpflichten? Ist gut geklärt, was sie von sich selbst und ihren Interaktionspartnern erwarten? Sind die Erwartungen leistbar? Sehen wir diesbezüglich Verbesserungsbedarf bei der Schülerschaft, im Kollegium, bei der Schulleitung, bei der Akzeptanz seitens der Eltern?
Haben wir uns auf ein Schulethos einigen können, hinter dem alle Mitglieder der Schulgemeinde stehen? Wird es in Ritualen und Regeln gelebt? Wird es evaluiert? (→ Abbildung 2)
4. Interaktion und Kommunikation
Wie gehen wir miteinander um? Pflegen wir eine aufbauende Interaktion und wertschätzende Kommunikation?
Reden wir offen miteinander? Kennen wir die Fallstricke in unserem täglichen Miteinander? Wissen wir, wie wir unsere Interaktion und Kommunikation zufriedenstellend und gesundheitsfreundlich verbessern können? Nutzen wir professionelle Feedback-Formen wie Blitzlicht und Metakommunikation, wenn die Kommunikation schwierig wird? Leisten wir gegenseitig Unterstützung in schwierigen Situationen? Welche Wünsche haben wir zur Verbesserung unseres Miteinanders in der Klasse und im Kollegium? Ist uns bewusst, dass Schule auch ein Lern-Ort für Interaktion und Kommunikation ist? (→ Abbildung 2)
5. Feedback als kollegiale Ressource
Sind wir darin geübt, wertschätzend (auch kritisches) Feedback zu geben und interaktionsfreundlich zu verarbeiten? Halten wir uns an die Grundprinzipien konstruktiver Kritik? Sind wir den emotionalen Herausforderungen von Kritik gewachsen? Bemühen wir uns um eine aufrichtige Anerkennungs- und Wertschätzungskultur – untereinander, mit der Schülerschaft und den Eltern? Können wir Dankbarkeit für Alltägliches empfinden und zum Ausdruck bringen? Wie steht es mit unserem Umgang mit Fehlern? Haben wir ein funktionierendes Fehlermanagement? Wie können wir die Fehlerrisiken in unseren Arbeitsbedingungen reduzieren? (→ Abbildung 2)
Читать дальше