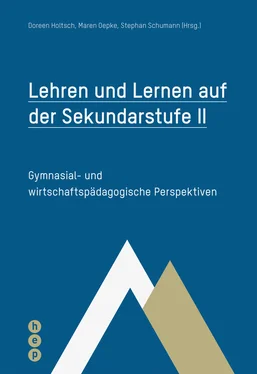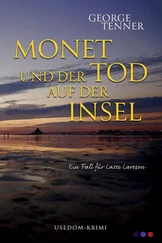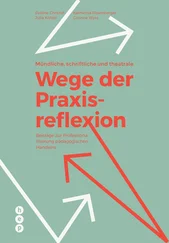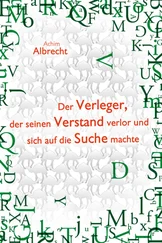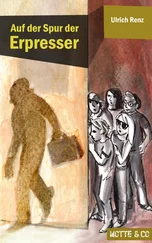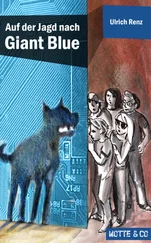2Neuregelungen in den 1870er und 1880er Jahren
Alle diese Regelungen waren kompliziert und aufwendig. Vor allem drei Entwicklungen begünstigten nun nach der Revision der Bundesverfassung 1874 eine generelle Regelung der Schnittstelle zwischen Gymnasium und Universität (vgl. Criblez, 2012): Erstens waren die radikalen und zentralistisch eingestellten politischen Kräfte bis zur «Schulvogt»-Abstimmung 1882 im Bundesstaat dominierend (vgl. Criblez & Huber, 2008). Zweitens näherten sich die Vorstellungen über die Zulassung zu den Universitäten und zum Polytechnikum einander an: Die Gymnasien mussten ihre bislang stark neuhumanistisch ausgerichteten Programme den Entwicklungen in den Naturwissenschaften anpassen, und das Polytechnikum setzte zunehmend auf allgemeine Bildung statt wie bisher auf technische und naturwissenschaftliche Vorbildung. Drittens sollte die Ausbildung in den Medizinalberufen im Kontext des starken Aufschwungs der Naturwissenschaften neu geregelt und vereinheitlicht sowie die Mobilität des Medizinalpersonals zwischen den Kantonen gewährleistet werden.
Schon 1867 hatten sich verschiedene Kantone auf ein Konkordat über Freizügigkeit der Medizinalpersonen geeinigt und mit den Reglementen für die Medizinalprüfungen 1867, 1870 und 1873 die Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen eingeleitet (Fischer, 1927, S. 7ff.; Lattmann, 1978, S. 20). Die neue Bundesverfassung von 1874 ermöglichte es dem Bund nun, die Freizügigkeit in den wissenschaftlichen Berufen für die ganze Schweiz zu regeln:
«Den Kantonen bleibt es anheimgestellt, die Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten von einem Ausweise der Befähigung abhängig zu machen. Auf dem Wege der Bundesgesetzgebung ist dafür zu sorgen, dass derartige Ausweise für die ganze Eidgenossenschaft gültig erworben werden können.» (BV, 1874, Art. 33)
Auf der Grundlage eines Bundesgesetzes betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals von 1877 (BG Medizinalpersonal, 1877) erließ der Bundesrat 1880 eine Verordnung für die eidgenössischen Medizinalprüfungen (Medizinalverordnung, 1880). In dieser Verordnung wurden aber nicht nur die Medizinalprüfungen geregelt, sondern sie enthielt auch Vorgaben zur Vorbildung:
«Um den Zutritt zur propädeutischen Prüfung zu erlangen, hat der Kandidat folgende Nachweise beizubringen: a. über vollständig und befriedigend absolvierte Gymnasialstudien durch ein als Ergebniss einer Prüfung ausgestelltes Abgangs- resp. Reifezeugnis (vgl. die Bestimmungen des Maturitätsprogramms für Mediziner im Anhang). […]» (Verordnung Medizinalprüfungen, 1880, Art. 10)
Im Anhang der Verordnung wurden die Maturitätsprogramme für Mediziner, Pharmazeuten und Kandidaten der «Thierarzneikunde» geregelt.
De jure verfügte der Bund auch mit der Bundesverfassung von 1874 nicht über die Kompetenz, die Zulassung zu den kantonalen Universitäten einheitlich zu regeln. Er konnte auf der Grundlage des Artikels 33 lediglich die Zulassung zu den Medizinalstudien definieren – und natürlich diejenige zur eigenen Hochschule, also zum Polytechnikum. Mit der Revision der Verordnung über die Medizinalprüfung (Verordnung Medizinalprüfungen, 1888) wurden dennoch zwei weitere Schritte in Richtung Generalisierung der Bundesvorgaben für die Maturitätsprüfungen eingeleitet. Erstens setzte der Bund eine eidgenössische Maturitätskommission ein. Sie sollte prüfen, ob die Maturitätsprogramme der Kantone den Vorgaben der Verordnung über die Medizinalprüfungen entsprachen. Und sie organisierte nun neu auch individuelle eidgenössische Maturitätsprüfungen – zunächst allerdings ausschließlich für Studierende der Medizinalberufe.
3Von der ersten Anerkennungsverordnung 1906 zur Maturitätsrevision 1972
Die gymnasiale Maturität veränderte sich im 20. Jahrhundert in mehreren Schritten sehr weitreichend. Als eher kleiner Reformschritt gilt die Revision von 1906 (Fischer, 1927, S. 164ff.; Maturitätsverordnung, 1906; Vonlanthen & Lattmann, 1978). Erstmals war die Verordnung nun explizit auf die Maturitätsausweise bezogen, wenn auch nach wie vor auf diejenigen der Kandidatinnen und Kandidaten der medizinischen Berufsarten. Allerdings hatte sich die 1897 gegründete EDK nun stark in die Verhandlungen eingemischt. Hauptsächlicher Konfliktpunkt war die mögliche Anerkennung eines realistischen Gymnasialprogramms neben dem klassisch-neuhumanistischen. Es kam aber lediglich zur Akzeptanz eines Maturitätsprogramms ohne Griechisch. Mit «status quo» fasste Fischer (1927, S. 225) das Ergebnis der Verhandlungen zusammen. Deshalb wurden die Diskussionen um das neuhumanistische und das realistische Ausbildungsprogramm auch nach 1906 fortgesetzt. Sie mündeten auf der Grundlage einer viel diskutierten Expertise des Basler Rektors Albert Barth (1919) in der Schaffung der Typenmaturität 1925 (MAV, 1925). Zugleich wurde nun die Generalisierung der Bundesvorgaben über die Medizinalberufe hinaus deutlich, denn erstmals zielten die Regelungen auf die Anerkennung kantonaler Maturitäten unabhängig von den gewählten Studienrichtungen. Maturitäten der kantonalen Gymnasien konnten nun anerkannt werden, wenn sie einem der drei Maturitätstypen entsprachen: A (neuhumanistisch, altsprachlich), B (mit Latein und einer modernen Fremdsprache) oder C (ohne Griechisch und Latein, mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt). Allerdings blieb das Nacharbeiten des Lateins für Studierende mit C-Matur, die ein Medizinstudium aufnehmen wollten, obligatorisch, und die Universitäten hielten auch für viele andere Studienfächer am Latein als obligatorischer Vorbildung fest.
Zwischen 1880 und 1925 wurde das ursprünglich nur für die Medizinalberufe geltende Maturitätsprogramm Schritt für Schritt zur generellen Norm für die Maturität. Allerdings ließ sich die «Einheit» der Matur im Sinne eines neuhumanistischen Gymnasialprogramms vor dem Hintergrund des Aufstiegs der Naturwissenschaften nicht aufrechterhalten. Die Typenmatur, die bis Ende des 20. Jahrhunderts Bestand hatte, war die Lösung des Streits um die Ausrichtung der gymnasialen Maturitätsprogramme.
Eine eidgenössisch anerkannte, aber nach kantonalen und vielfach einzelschulischen Normen definierte Typenmatur war damit zum «Königsweg» in die Universität geworden. Die Verträge zwischen den Gymnasien und den Universitäten wurden so Schritt für Schritt obsolet. Die ehemals lose Koppelung, die Weick (1976) für die Organisation von Bildungssystemen als typisch bezeichnet hatte, war an der Schnittstelle zwischen Gymnasium und Universität über die Anerkennungsbedingungen für die kantonalen Maturitätsausweise enger geworden. Die eidgenössische Anerkennung kantonaler Maturitätsausweise war zugleich eine einfache Lösung für ein komplexes Problem im föderalistischen Bildungssystem. Im Effekt regelte aber spätestens seit der Revision von 1925 (MAV, 1925) der Bund die kantonalen Maturitäten im Sinne von Rahmenvorgaben (Dauer, Fächer, Anteile von Fachbereichen, formale Prüfungsvorgaben, Maturanoten und Bestehensnormen, Maturitätsausweis) und damit weitreichend auch die Zulassung zu den kantonalen Universitäten.
Während der Bildungsexpansionsphase der 1950er bis Mitte der 70er Jahre sollte aufgrund des Nachwuchsmangels und der Forderung nach besseren Zugangschancen für bislang benachteiligte Gruppen die höhere Bildung geöffnet werden (vgl. Criblez, 2001). Die Maturitäts-Anerkennungsverordnung wurde deshalb in kurzer Zeit zweimal revidiert (vgl. Egger, 1987; Meylan, 1996): 1968 wurde der Maturitätstyp C den andern Maturitätstypen gleichgestellt und die Lateinauflage für das Medizinstudium aufgehoben (MAV, 1968). Zudem wurde der «gebrochene» Bildungsweg (Kurzgymnasium im Anschluss an eine Sekundar- oder Bezirksschule) aufgewertet. Vier Jahre später (MAV, 1972) wurden zwei neue Maturitätstypen geschaffen, um sogenannte «Begabungsreserven» besser fürs Gymnasium mobilisieren zu können. Insgesamt blieben aber Funktion und Konstruktion der Matur weitgehend erhalten.
Читать дальше