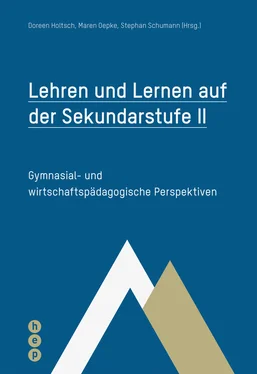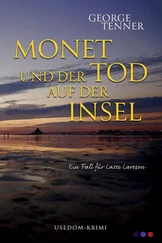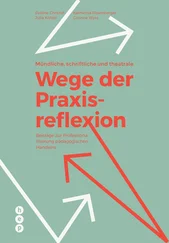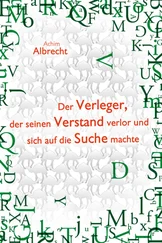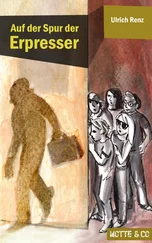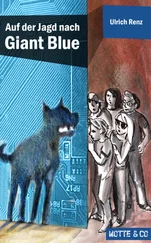Die Medienmitteilung der Zürcher Bildungsdirektion weist auf ein Projekt der EDK hin, das 2016 mit entsprechenden Empfehlungen (EDK, 2016) abgeschlossen wurde. Mit unterschiedlichen Maßnahmen soll gesichert werden, dass das eidgenössisch anerkannte Maturitätszeugnis der Gymnasien auch in Zukunft als allgemeiner Hochschulzulassungsausweis 39erhalten bleibt. Dass solche Maßnahmen notwendig sind, hängt einerseits mit der stark angestiegenen Maturitätsquote, andererseits mit wiederkehrenden Klagen über die mangelnde Leistungsfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden durch die Abnehmerinstitutionen, allen voran durch die ETH Zürich, zusammen. Dass die Leistungen vieler Maturandinnen und Maturanden in einzelnen Gymnasialfächern, die für viele Studiengänge als wichtige Vorbildung gelten, nur teilweise den Erwartungen genügen, hat der zweite Teil der Evaluation zur Maturitätsreform 1995 (EVAMAR II; vgl. Eberle et al., 2008) deutlich gezeigt, insbesondere weil hohe gymnasiale Maturitätsquoten einzelner Kantone mit geringeren Schulleistungen korrelierten.
Die gymnasiale Maturitätsquote liegt in der Schweiz bei rund 20 Prozent eines Schülerjahrganges und ist seit einigen Jahren relativ konstant. Allerdings erlangten in der Schweiz in der Mitte des 20. Jahrhunderts nur 2 bis 3 Prozent eines Schülerjahrgangs eine Matur im herkömmlichen Sinn der Hochschulreife. Die meisten waren männlich, stammten aus bildungsbürgerlichen Milieus, absolvierten ein neuhumanistisches, seltener ein mathematisch-naturwissenschaftliches Programm; noch seltener erwarben sie sich eine kantonal anerkannte Hochschulzulassungsberechtigung über eine Handels- oder eine Lehramtsmatur. Meist setzten sie ihre Ausbildung nach der Matur direkt an der Universität fort (vgl. Criblez, 2003).
Die Situation hat sich inzwischen also grundlegend verändert: Seit 1993 erlangen mehr junge Frauen als junge Männer einen gymnasialen Maturitätsausweis, und die Maturitätsquote nähert sich allmählich der 40-Prozent-Grenze, wenn man alle drei Maturitätstypen zusammenzählt, also auch die Berufs- und die Fachmatur. 40Wesentlich zur Veränderung beigetragen haben denn auch die beiden neuen Maturitätstypen, die je mit einer – unterschiedlichen – Hochschulzulassungsberechtigung verknüpft sind. Die in der Mitte der 1990er Jahre eingeführte Berufsmatur ist quantitativ ein Erfolgsmodell, und nach politischem Willen soll die Absolvierendenquote weiter zunehmen. 41Die 2003 geschaffene Fachmatur (vgl. EDK 2003) zeigt ein deutliches Wachstum, wenn auch auf tiefem Niveau. Allerdings bestehen bei allen drei Maturitätstypen große kantonale und zum Teil geschlechterspezifische Differenzen.
Wenn über die Maturität als Hochschulzulassungsausweis debattiert wird, müssen heute also immer alle Maturitätstypen einbezogen werden – was gerade in öffentlichen Diskussion oft nicht der Fall ist; da wird häufig nur die gymnasiale Maturitätsquote berücksichtigt. Wenn man diese Debatten verstehen will, gilt es, sich kurz mit der Geschichte der Maturität auseinanderzusetzen. Dazu wird im folgenden Text erstens auf die Situation vor 1880, zweitens auf die Schaffung der Maturitätsanerkennung hingewiesen, drittens werden die Entwicklungen im 20. Jahrhundert nachgezeichnet, und abschließend werden einige Entwicklungen seit Mitte der 1990er Jahre skizziert, die erst das eingangs erwähnte EDK-Projekt als notwendig erscheinen ließen.
1Zur Situation vor 1880
Vorformen heutiger Gymnasien existierten bereits in der frühen Neuzeit. Grundsätzlich waren zunächst drei Modelle für die Vorbereitung auf ein Universitätsstudium bekannt: durch wie auch immer gearteten Privatunterricht, durch eine Vorbildungsinstitution im Sinne von Vorformen heutiger Gymnasien und durch entsprechende Institutionen an den Universitäten selbst: Die Ausbildung in den sogenannten septem artes liberales war an vielen Universitäten dem Studium an den Berufsfakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin) zunächst vorgelagert. Erst die neuhumanistische Bildungskonzeption trennte Gymnasium und Universität und erhob die septem artes liberales zur eigenständigen (Philosophischen) Fakultät (vgl. Criblez, im Druck).
Die Zulassung zum Studium an den kantonalen Universitäten war vor 1880 durch den ausgeprägten Bildungsföderalismus geprägt: Die Kantone waren sowohl für die Gymnasien als auch für die Universitäten zuständig. Die Regelung der Schnittstelle zwischen Gymnasien und Universität war damit bei den drei ältesten Universitäten (Basel, Gründungsjahr 1460, Zürich, 1833, und Bern, 1834) eine staatshoheitlich-kantonale Aufgabe, der Bund regelte die Zulassung zum 1855 eröffneten Polytechnikum (heute: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).
Die im 19. Jahrhundert noch sehr kleinen Universitäten hatten ein Interesse an Studierenden, was für eine großzügige Zulassung sprach. Gleichzeitig sollte im Sinne einer allmählichen Demokratisierung der Gesellschaft der Zugang zur höheren Bildung nicht mehr durch Geburt, Stand oder finanzielle Möglichkeiten definiert sein. Als Alternative dazu etablierte sich für die Zulassung zur Universität deshalb immer deutlicher das Leistungsprinzip. Eine hinreichende Vorbildung für das Studium wurde zur Zulassungsbedingung – der Maßstab für diese Vorbildung wurde die Maturität. Aber auch diesen neuen Leistungsausweis «Matur» regelten die Universitätskantone hoheitlich, jedoch der bildungsföderalistischen Logik folgend immer nur für ihr Kantonsgebiet und ihre Universität. Deshalb stellte sich das grundsätzliche Problem, wie die Zulassung von Studierenden aus andern Kantonen (oder aus dem Ausland) geregelt werden sollte. Eine Lösung dieses Problems waren bis in die 1880er Jahre Verträge zwischen den Gymnasien der Nicht-Hochschulkantone und den Universitäten bzw. dem Polytechnikum. Die Universitäten konnten so Einfluss auf die Maturitätsprogramme der Nicht-Hochschulkantone nehmen und eine Art Minimalstandards durchsetzen. Auch wenn die Anzahl der Gymnasien in der Schweiz zunächst relativ klein blieb, 42hatte diese Problemlösung eine Schwäche: Sie setzte auf je individuelle Verhandlungen zwischen den Gymnasien und den Universitäten und ließ keine einfache, allgemeine und institutionalisierte Lösung zu. Am Beispiel des Kantons Zürich lässt sich der Regelungsbedarf idealtypisch wie folgt beschreiben; der Kanton musste definieren:
(1)ein gymnasiales Programm und Bestehensnormen für die Maturität an der Zürcher Kantonsschule (Gymnasium und Industrieschule Zürich, später auch Winterthur);
(2)die Zulassung von Zürcher Maturanden und später auch Maturandinnen an die Universität Zürich;
(3)Absprachen über die Zulassung von Zürcher Maturanden und Maturandinnen an außerkantonale Universitäten (zunächst v. a. Basel, Bern);
(4)Absprachen über die Zulassung von Zürcher Maturandinnen und Maturanden ans Polytechnikum bzw. an die ETH;
(5)(vertragliche) Regelung der Bedingungen für die Zulassung von außerkantonalen Maturanden und Maturandinnen an die Universität Zürich;
(6)Zulassung von ausländischen Studierenden an die Universität Zürich.
Die Regelungen konnten nur in den Fällen 1, 2 und 6 kantonshoheitlich getroffen werden, was in den 1830er Jahren auch erfolgte. Alle andern Regelungen waren von Verhandlungen mit andern Kantonen, außerkantonalen Gymnasien oder dem Polytechnikum abhängig. Dabei kamen drei unterschiedliche Regelungen zur Anwendung, die auch miteinander kombiniert wurden: a) Die Universitäten schlossen mit Gymnasien Verträge ab, welche die Zulassung regelten; b) die Hochschulen führten Zulassungsprüfungen ein, wie sie etwa für die Zulassung zum Eidg. Polytechnikum üblich waren; c) die Zulassung erfolgte «sur dossier», dies insbesondere bei ausländischen Studierenden. Auf diesem Weg erfolgte 1864 auch die Zulassung der ersten Frau an eine Schweizer Universität, einer Russin an die Universität Zürich (vgl. Rogger & Bankowski, 2010). Sie verfügte selbstredend nicht über einen Maturitätsausweis aus der Schweiz.
Читать дальше