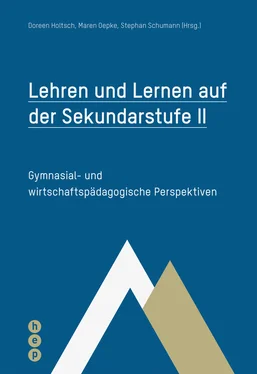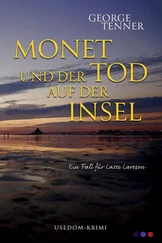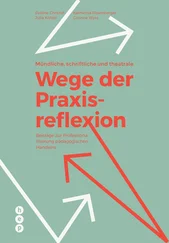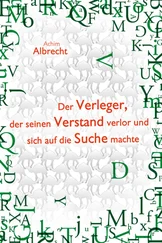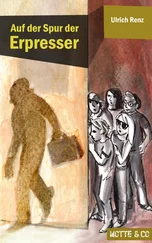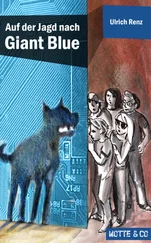Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)
Здесь есть возможность читать онлайн «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Beiträge in dieser Festschrift anlässlich der Emeritierung von Franz Eberle widmen sich aus gymnasial- und wirtschaftspädagogischer Perspektive dem Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II. Spektrenreich werden aktuelle und zukünftige Herausforderungen an das Schweizer Bildungssystem analysiert. Weiter kommen multiple Aspekte der Studierfähigkeit von Maturandinnen und Maturanden und aktuelle Fragen der Wirtschaftsbildung und der Ausbildung von Lehrpersonen zur Sprache. Die Beiträge sind in der Gesamtschau sowohl durch thematische Vielfalt als auch durch verschiedene Blickwinkel geprägt und widerspiegeln damit umfänglich die Wirkungsbereiche und Interessen von Franz Eberle.
Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
«Brauchen Renaissance des Leistungsprinzips» (2018, 30.7.). Veranstaltungsbericht (zu Josef Kraus. Straubinger Tagblatt, S. 13.
Brezinka, W. (1976). Erziehungsziele, Erziehungsmittel, Erziehungserfolg. München: Reinhardt.
Diederich, J. (1994). Was lernt man, wenn man nicht lernt? Zeitschrift für Pädagogik, 40(3), 345–353.
Ekholm, M. (1999). Schüler machen Schulprogramm und was man von Schweden lernen kann. Pädagogik, 51(11), 16–23.
Heid, H. (1994). Das Subjekt als Objekt erziehungswissenschaftlicher Forschung? In G. Pollak & H. Heid (Hrsg.), Von der Erziehungswissenschaft zur Pädagogik? (S. 171–181). Weinheim: Studienverlag.
Heid, H. (1996). Was ist offen am offenen Unterricht? In A. Leschinsky (Hrsg.), Die Institutionalisierung von Lehren und Lernen (S. 159–172). Weinheim: Beltz.
Heid, H. (2003). Bildung im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Qualifikationsanforderungen und individuellen Entwicklungsbedürfnissen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 99(1), 10–25.
Klein, S. (2018, 13.8.). «Studium Generale für alle». Interview mit HR-Präsident Peter-André Alt. Süddeutsche Zeitung, Nr. 185, S. 12.
Klingberger, L. (1990). Lehrende und Lernende im Unterricht. Berlin: Volk und Wissen.
Kraus, J. (1998). Spaßpädagogik: Sackgassen deutscher Schulpolitik. München: Universitas.
Meumann, E. (1911). Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen, Bd. 1 (2. Aufl.). Leipzig: Engelmann.
Meumann, E. (1913). Intelligenz und Wille (2. Aufl.). Leipzig: Quelle & Meyer.
Prim, R. (2001). Schülersubjekt und Schulorganisation. In T. Rihm (Hrsg.), Schulentwicklung. Vom Subjektstandpunkt ausgehen … (S. 41–68). Bad Heibrunn: Klinkhardt.
Rousseau, J.-J. (1762/1965). Emile oder Über die Erziehung. Stuttgart: Reclam.
Stegmüller, W. (1964). Erkenntnis und Erfahrung. Typoskript der Funkuniversität Berlin vom 4.3.1964.
Stegmüller, W. (1966). Erklärung, Voraussage, wissenschaftliche Systematisierung und nicht-erklärende Informationen. In: Ratio, 8(1), 1–22.
Spranger, E. (1959). Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein. In Probleme einer Schulreform. Eine Vortragsreihe (S. 181–195). Stuttgart: Kröner.
Vogel, P. (1990). Kausalität und Freiheit in der Pädagogik. Frankfurt am Main: Lang.
Vollmer, G. (1995). Biophilosophie. Stuttgart: Reclam.
Weber, M. (1919). Politik als Beruf. In ders., Gesammelte Politische Schriften. Hrsg. v. J. Winckelmann (S. 493–548). Tübingen: Mohr-Siebeck.
Zheng, L., & Meyer, M. A. (2018). Didaktik und Unterrichtsreform im Zeitalter der Globalisierung. In D. Benner, H. Meyer, Z. Peng & Z. Li (Hrsg.), Beiträge zum chinesisch-deutschen Didaktik-Dialog (S. 198–216). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Claude Müller und Fabienne Javet
Flexibles Lernen als Lernform der Zukunft?
1Einführung
Unsere Gesellschaft ist einem ständigen Transformationsprozess unterworfen, und Flexibilität nimmt eine zunehmend wichtigere Rolle in verschiedenen Lebensbereichen ein. Beispiele dafür sind flexible Arbeitszeiten und hohe zeitliche Verfügbarkeit im Beruf, neue Familienmodelle sowie insbesondere im Tertiärbereich hochgradig mobile und globalisierte Lernende. In diesem Zusammenhang wird auch von den Bildungsinstitutionen mehr Flexibilität und Individualisierung gefordert, und in den letzten Jahren ist flexibles Lernen in den Fokus der pädagogischen Qualitätsentwicklung gerückt. Das flexible Lernen wurde in den 1970er Jahren in den USA begründet, seither hat sich das Interesse daran ständig entwickelt, was sich auch in einer steigenden Zahl an Publikationen in diesem Themenfeld ausdrückt (Li & Wong, 2018). Auch die aktuelle Diskussion zur Digitalisierung der Bildung ist stark vom Begriff des flexiblen Lernens geprägt; flexibles Lernen, digitales Lernen, Blended oder Distance Learning werden denn auch häufig sinngleich verwendet. In diesem Beitrag wird der Begriff des flexiblen Lernens geklärt, es werden exemplarisch Umsetzungen an Bildungsinstitutionen vorgestellt sowie Herausforderungen und Grenzen von flexiblem Lernen als Lernform der Zukunft diskutiert.
2Konzepte und Dimensionen des flexiblen Lernens
Flexibles Lernen oder Flexible Learning ist ein breiter Begriff mit unterschiedlichen Interpretationen (De Boer & Collis, 2005; Li & Wong, 2018). Ganz allgemein formuliert, sollen flexible Lernangebote den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden entsprechen und es ihnen ermöglichen, mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen (Wade, 1994). Im Zentrum von flexiblem Lernen stehen die Lernenden mit ihren Bedürfnissen; die Bildungsangebote sollen ihnen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, was, wann, wie und wo gelernt wird. Die British Higher Education Academy beschreibt dieses Konzept wie folgt: «Flexible learning is about empowering students by offering them choices in how, what, when and where they learn: the pace, place and mode of delivery» (HEA, 2015, S. 1).
Beim flexiblen Lernen müssen zwei Perspektiven adressiert werden. Die institutionelle Perspektive stellt die Frage, wie die Lernorganisation und die didaktische Ausgestaltung aussehen müssen, um beispielsweise den zeitlich und räumlich unabhängigen Zugriff auf Lernressourcen zu gewährleisten. Aus Sicht der Lernenden muss beachtet werden, dass flexibles Lernen Lernende in die Lage versetzt, einen selbstbestimmten Lernweg zu wählen und das Lernen entsprechend selbst zu regulieren; sie sind stärker als zuvor für den eigenen Lernprozess verantwortlich. Dies stellt auch höhere Anforderungen an das persönliche Zeitmanagement und die Selbstregulation der Lernenden. Die HEA (2015) schlägt folgende Möglichkeiten zur Flexibilisierung des Lernens vor:
–Wie: Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lernformaten wie Präsenzlernen, Online Learning oder Blended Learning anbieten.
–Was: Bereitstellung von personalisierten Lernumgebungen mit einem vielfältigen Angebot an Optionen, die es den Lernenden ermöglichen, die Lerninhalte nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zu wählen.
–Wann: Anbieten einer Ausbildungsstruktur mit der Möglichkeit, die Lernzeiten selbst zu wählen, die Lernzeiten an das Arbeits- und Privatleben anzupassen sowie die Intensität und das Lerntempo zu bestimmen; von Vollzeit und beschleunigt bis hin zu Teilzeit und zeitlich gestreckt.
–Wo: Gestaltung einer Lernumgebung, die es ermöglicht, an verschiedenen Orten zu lernen, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder im Ausland.
Das von der HEA (2015) entwickelte Framework versucht, flexibles Lernen für die Hochschulbildung umfassend abzubilden, und umfasst auch die Rolle der Institution beim Bildungszugang oder die organisatorischen und administrativen Bildungsaspekte. Beispielsweise sollen durch institutionelle Agilität eine hohe Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungsstufen und offene Bildungszugänge für Lernende mit verschiedenen Lernbiografien und unterschiedlichem sozialem Hintergrund ermöglicht werden. Eine wichtige Frage ist dabei, wie non-formal (z. B. in betriebsinternen Kursen) und informell (z. B. durch berufliche, private Aktivitäten) erworbene Kompetenzen anerkannt werden können. Dieser Aspekt steht in Europa auf der Tertiärstufe momentan im Fokus (Cedefop, 2015), die Umsetzung stellt aber hohe Anforderungen sowohl an ein Bildungssystem als auch an die jeweiligen Bildungsanbieter. Der Ansatz des «Recognition of prior Learning» wurde darum in vielen europäischen Ländern nur teilweise respektive noch gar nicht umgesetzt (European Commission, EACEA & Eurydice, 2018).
Aus pädagogischer Sicht können verschiedene Dimensionen von flexiblem Lernen identifiziert werden. Gemäß dem vielzitierten Artikel von Chen (2003) muss für flexibles Lernen in mindestens einer der folgenden Lerndimensionen Flexibilität vorhanden sein: Zeit, Ort, Geschwindigkeit, Lernstil, Inhalt, Assessment oder Lernpfad. Li und Wong (2018) haben die bisherigen Publikationen analysiert und sind zu ähnlichen Komponenten von flexiblem Lernen gekommen: Zeit (time), Inhalt (content), Zugangsvoraussetzungen (entry requirement), Bereitstellung (delivery), didaktische Gestaltung (instructional approach), Beurteilung und Bewertung (assessment), Lernressourcen und Support (resources and support) sowie Orientierung und Ziele (orientation and goal). Über die Flexibilisierung dieser Aspekte durch die Bildungsorganisation respektive die Lehrenden können den Bedürfnissen der Studierenden angepasste Lernumgebungen angeboten werden. Die Zeitdimension bezieht sich nicht nur auf das Datum und die Uhrzeit eines Kurses oder eines Moduls (z. B. Abendunterricht), sondern auch auf das Lerntempo innerhalb eines Kurses. Die Inhalte umfassen die Studienthemen – z. B. flexible Curricula, deren Reihenfolge und Schwierigkeitsgrad variiert werden kann, ohne die Bildungsziele insgesamt zu beeinträchtigen. Der Aspekt der Zugangsvoraussetzungen fragt nach den Voraussetzungen für die Teilnahme an Bildungsangeboten. Die Bereitstellung bezieht sich auf den Verteilungsmodus der Lernressourcen. Mit Webtechnologie und Breitbandinfrastruktur lassen sich heute vielfältige Online-Lernumgebungen mittels Lernvideos, Vorlesungsstreaming oder Webkommunikations- und Kollaborationstools gestalten, womit der Zugriff auf die benötigten Lernressourcen und Kommunikationstools heute fast überall möglich ist. Viele Projekte zu flexiblem Lernen beziehen sich auf diese Dimension, mit der das Lernen zeitlich und örtlich flexibilisiert wird. Auch die didaktische Gestaltung kann in Bezug auf Umfang, Sprache, soziale Organisation, Zeitpunkt und Art und Dauer der Lernaktivitäten vielfältig und flexibel gestaltet werden. Bei der Beurteilung und Bewertung kann mittels unterschiedlicher Prüfungsmodi (z. B. schriftlich vs. mündlich, eine große Prüfung vs. mehrere kleinere Prüfungen) sowie alternativer Möglichkeiten, ein Zertifikat zu erhalten (z. B. Prüfung, Präsentation, Gruppen- vs. Einzelarbeit), auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Lernenden eingegangen werden. Andere Formen der Flexibilität bei der Beurteilung und Bewertung beziehen sich auf die Gewichtung der verschiedenen Leistungsnachweise und auf die Anforderungen bezüglich Terminen und Fristen von Leistungsnachweisen. Flexibles Lernen ist kein autonomes Lernen, sondern erfordert vielfältige Lernressourcen mit verschiedenen Zugängen sowie zeitlich und örtlich flexible Unterstützung und Beratung. Die Festlegung der Lernziele kann als weiterer wichtiger Faktor für die Lernflexibilität angesehen werden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.