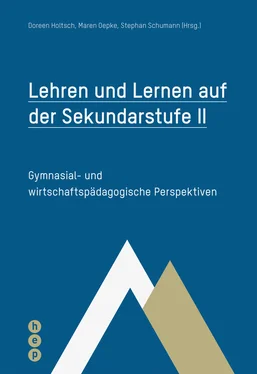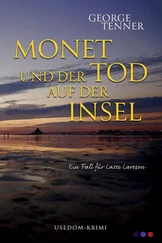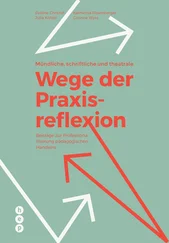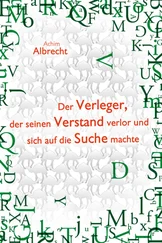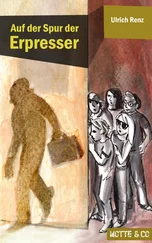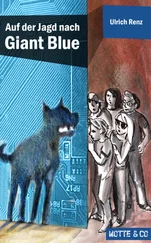Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)
Здесь есть возможность читать онлайн «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Beiträge in dieser Festschrift anlässlich der Emeritierung von Franz Eberle widmen sich aus gymnasial- und wirtschaftspädagogischer Perspektive dem Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II. Spektrenreich werden aktuelle und zukünftige Herausforderungen an das Schweizer Bildungssystem analysiert. Weiter kommen multiple Aspekte der Studierfähigkeit von Maturandinnen und Maturanden und aktuelle Fragen der Wirtschaftsbildung und der Ausbildung von Lehrpersonen zur Sprache. Die Beiträge sind in der Gesamtschau sowohl durch thematische Vielfalt als auch durch verschiedene Blickwinkel geprägt und widerspiegeln damit umfänglich die Wirkungsbereiche und Interessen von Franz Eberle.
Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es bildet sich derzeit ein neues institutionelles Medien- und Kommunikationssystem aus. Ein soziales Teilsystem, das sowohl den Anforderungen der funktional wie auch der segmentär differenzierten modernen Gesellschaft entsprechen muss. Ob und welche Rolle wissenschaftliche Einrichtungen wie Universitäten darin spielen werden, das ist derzeit noch offen. Ein Ausbau allein der kommunikativen Instrumente wie eine Ausweitung der kommunikativen Aktivitäten reichen aber nicht aus, weil es sich nur um eine Reaktion auf einen Veränderungsprozess handeln würde, der sich allein oder dominant auf Fragen der Kommunikation konzentriert. Die Veränderungen aber sind institutionell wie auch organisational und somit elementar, und das weist über instrumentelle Kommunikationsmodelle weit hinaus. Wir befinden uns in einem fundamentalen Neuinstitutionalisierungsprozess.
Danksagung
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Unterstützung bei der Literaturrecherche und für die Lektoratsarbeit bei Frau Daniela Mahl, BA.
Literatur
Fähnrich, B., Metag, J., Post, S., & Schäfer, M. S. (Hrsg.) (2018). Forschungsfeld Hochschulkommunikation. Ein Handbuch. Wiesbaden: Springer VS.
Kersten, J. (2017). Schwarmdemokratie. Der digitale Wandel des liberalen Verfassungsstaats. Tübingen: Mohr Siebeck.
Loprieno, A. (2016). Die entzauberte Universität. Europäische Hochschulen zwischen lokaler Trägerschaft und globaler Wissenschaft. Wien: Passagen.
Marcinkowski, F., Friedrichmeier, A., & Geils, M. (2014). Transparenz oder PR? Die Koinzidenz von Managementmodell und Medialisierung an deutschen Hochschulen. In R. Krempkow, A. Lottmann & T. Möller (Hrsg.), Völlig losgelöst? Governance der Wissenschaft (S. 127–140). Berlin: Institut für Forschungsinformationen und Qualitätssicherung. Online: www.forschungsinfo.de/Publikationen/Download/working_paper_15_2014.pdf. [24.11.2017].
Reckwitz, A. (2017). Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schimank, U. (2017). Universitätsreformen als Balanceakt: Warum und wie die Universitätsleitungen Double Talk praktizieren müssen. Beiträge zur Hochschulforschung, 39(1), 50–60.
Weick, K. E. (1976). Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative Science Quarterly, 21(1), 1–19.
Helmut Heid
Warum zwischen Lehren und Lernen unterschieden werden muss
Beitrag zur Differenzierung dessen, was Bildungspraxis genannt zu werden pflegt
Wenn Personen, die als pädagogisch sachverständig angesehen werden, sagen, dass «Eltern ihren Kindern etwas lernen müssen» oder dass die «Lust am Selberlernen» geweckt werden müsse, so als ob es ein anderes Lernen geben könne 24, oder wenn für Bildung hochrangig Zuständige die «Beteiligung Lernender am Lernen» als Errungenschaft modernen Bildungsdenkens preisen, dann ist das nicht nur eine womöglich regional auftretende Sprachverwirrung; dann besteht Klärungsbedarf.
Ich hole etwas aus:
(1)Im Alltags-wie im Fachsprachgebrauch ist von bildungspraktischem Handeln die Rede, wenn mindestens zwei Personen(-gruppen) bildungs-zielorientiert interagieren: beispielsweise Lehrende einerseits und Lernende andererseits. Lehrende und Lernende sowie Lehren und Lernen lassen sich, anders, als das bei Bildung oder Erziehung 25der Fall ist, sprachlich klar unterscheiden. Jedoch die Tatsache, dass Lehren und Lernen nie außerhalb konkreter Personen «existieren», die lehrend versus lernend aktiv sind, macht die Sache komplizierter. Es ist nämlich davon auszugehen, dass Lehrpersonen, während sie lehren, auch lernen, und dass Schülerinnen und Schüler, während sie lernen, auch lehren (z. B. in Kontexten kooperativen Lernens). Wenn im Folgenden von Lehrenden und Lernenden die Rede ist, dann wird damit nicht ausgeschlossen, dass Lehrende auch lernen und Lernende auch lehren (können); wohl aber: dass es nicht auf das Lernen Lehrender ankommt, wenn von Lehrenden gesprochen wird, und dass das Lehren Lernender irrelevant ist, wenn von Lernenden die Rede ist. 26
(2)In der Rede von Bildungspraxis ist es schon sprachlich und vor allem sachlich komplizierter. Hier könnte man zwischen denen unterscheiden, die für die Organisation der Bedingungen zuständig sind, die Bildung ermöglichen und beeinflussen, und denen, deren Bildung dadurch beeinflusst werden soll. Aber für diese Unterscheidung fehlen die Begriffe. Dafür gibt es einen Grund. Nur der Adressat bildungspraktischen Handelns ist Subjekt der Bildung, 27und außerhalb der Persönlichkeitsentwicklung dieses Adressaten existiert Bildung nicht. Was Lehrende zur Bildung der Adressaten ihrer Praxis beitragen, ist nicht Bildung, sondern günstigenfalls die Ermöglichung und Unterstützung von Bildung. Lehrende werden Bildungspraktiker genannt, weil vor allem sie für die Organisation der Bedingungen Erfolg versprechenden Lernens zuständig sind. Das klingt nach begrifflicher Spitzfindigkeit, ist aber für die Beantwortung der Frage wichtig, wie in einer bildungspraktischen Interaktion die Zuständigkeiten verteilt sind. Die Tatsache, dass Lehren und Lernen sprachlich klar unterschieden werden, besagt nicht, dass sie im bildungstheoretischen Denken und im bildungspraktischen Handeln ebenso klar modelliert werden. Kennzeichnend dafür ist das als besonders fortschrittlich angesehene Postulat eines für Bildung zuständigen Amts- und Würdenträgers: «shift from teaching to learning», das auch unter Bildungswissenschaftlern irritierende Zustimmung erfährt; so, als ob Lehren ohne Lernen (schon sprachlich) Sinn ergäbe – und so, als ob es ein Lernen ohne Lerngelegenheit geben könne, für deren kompetente Gestaltung sich eine wohl begründete und traditionsreiche Zuständigkeit etabliert hat. 28
(3)In dieser angeblich neuen «Sicht» bildungspraktischen Handelns spielen Wertungen eine Rolle: Lernende sollen nicht (länger) als Objekte bildungspraktischer «Bearbeitung» bzw. der Belehrung gesehen, sondern als Subjekte des Lernens begriffen und respektiert werden (aktuell z. B. Bohnsack, 2015). Richtig ist, dass Bildung, gleich welchen Verständnisses, durch bewusst darauf zielende Tätigkeiten eines Bildungspraktikers bzw. eines Lehrenden nicht hergestellt, sondern allenfalls ermöglicht werden kann. So richtig und trivial es also ist, dass keine noch so geniale Lehrperson das Selberlernen Lernender erzwingen oder erübrigen kann; dass Lernende also immer nur selbst lernen, was sie lernen, so wichtig ist andererseits, dass es kein Lernen ohne Lerngelegenheit gibt und dass im organisierten Bildungswesen Lehrende für die zielgerichtete Gestaltung externaler Bedingungen Erfolg versprechenden Lernens Lernender (professionell) kompetent – im Sinn von fähig, zuständig und verantwortlich – sind.
(4)Lehren und Lernen hängen also funktional zusammen, obwohl und weil sie sich in Wesen und Funktion unterscheiden. Einerseits gilt: Lehren bezweckt die Ermöglichung und Optimierung erfolgreichen Lernens. Im Bildungssystem lernen Lernende in der lernenden Auseinandersetzung mit bereitgestellten und (didaktisch) aufbereiteten externalen Lerngelegenheiten. Andererseits gilt aber auch: Der von Aktivität Lernender abhängige Lernerfolg Lernender kann aus der Perspektive Lehrender auch als eine von Lehren abhängige Variable und insofern eben auch als Lehrerfolg gedacht und modelliert werden, soweit sich diese Abhängigkeit (kausalanalytisch) nachweisen lässt. 29Wird dadurch der Lernende (zumindest aus der Perspektive Lehrender) nicht doch zum («bloßen») Objekt bildungspraktischer Einwirkung (vgl. z. B. Vogel, 1990; Heid, 1994) und der Lehrende zum «Verursacher» des Lernerfolgs Lernender? Es mag Bildungspraktiker geben, 30die die Adressaten ihrer Arbeit als (passive) Einwirkungsobjekte betrachten und zu «behandeln» meinen. Und das dürfte für die Betroffenen auch keineswegs belanglos sein. Dennoch ist diese Praxis nicht geeignet, die Tatsache außer Kraft zu setzen, dass das, was auch immer als Bildung oder als Lernerfolg bezeichnet wird, niemals von Aktivitäten des Bildungssubjekts bzw. des Lernenden unabhängig ist. Das gilt auch für implizites Lernen (dazu Diederich, 1994). Und es gilt für alle Versuche einer psychischen Überwältigung, beispielsweise um Lernende zu veranlassen, etwas zu denken, zu tun oder zu wollen, was sie selbst gerade nicht wollen. Auch das kann nur über die (oft schmerzhafte) Einwilligung des Gezwungenen in das Erzwungene «gelingen». Dass die Domestizierung des Willens Lernender nicht ohne deren Einwilligung gelingen kann, zeigen ausgeklügelte Vorschläge und Versuche, die die Verwandlung fremdbestimmten Sollens in selbstbestimmtes Wollen bezwecken. So schreibt, um ein erstes von zwei besonders prominenten Beispielen herauszugreifen, Rousseau (1762/1965, S. 265f.): «Lasst ihn [den Zögling] immer im Glauben, er sei der Meister, seid es in Wirklichkeit aber selbst. Es gibt keine vollkommenere Unterwerfung als die, der man den Schein der Freiheit zugesteht. So bezwingt man sogar seinen Willen. […] Zweifellos darf es [das Kind] tun, was es will, aber es darf nur das wollen, von dem ihr wünscht, dass es es tut.» In einem ausgefeilteren Vorschlag bezieht Spranger (1959) sich auf die Eigenliebe der Person (des Einwirkungsadressaten) und empfiehlt die «Verwandlung individuellen Geltungsstrebens in die Bereitschaft zur […] Pflichterfüllung». Dabei geht es um Pflichten, von deren Inhaltsbestimmung der Einwirkungsadressat nicht nur ausgeschlossen ist, sondern deren Fremdbestimmung überdies gegen den aktuellen Willen des Interventionsadressaten durchgesetzt werden soll; sonst bedürfte es nicht jener permanenten Erfüllungskontrolle, die Spranger folgendermaßen konkretisiert: «Es wird jeweils ein bestimmter Auftrag erteilt, und der Zögling wird zur Verantwortung gezogen, wenn er ihn nicht erfüllt. So entsteht ein Katalog von kleinen Pflichten auf der einen, ständiger Erfüllungskontrolle auf der anderen Seite» (Spranger, 1959, S. 191). «Von da ist noch der entscheidende Schritt zu tun bis zur freiwilligen [?] Übernahme von Aufgaben, die kein Vorgesetzter gestellt hat und deren Erfüllung niemand überwacht. Damit» – sagt Spranger allen Ernstes – «wäre dann das Ethos der Freiheit erreicht …». Wohl gemerkt: Spranger sagt nicht, dass nach dem Erfolg dieser penetranten Erfüllungskontrolle der Zwang vollendet sei. Nein: Er sagt: Jetzt ist das Ethos der Freiheit vollendet. Derjenige «Drang zur Freiheit», der sich dieser als Erziehung moralisierten Disziplinierung widersetzt, dieser Drang – so Spranger – müsse dadurch gewendet werden, «dass man dem Aufsässigen [!] Leistungen überträgt, die ihm das Gefühl [!] geben, dass man ihn braucht» (ebd., S. 190f., Hervorhebung H.H.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.