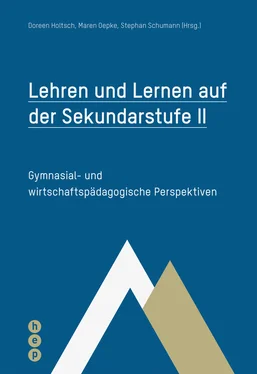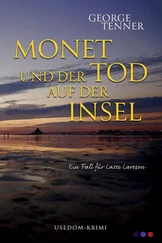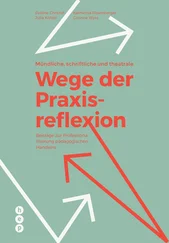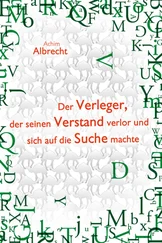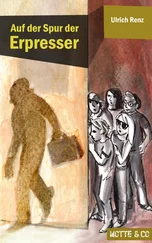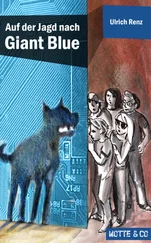Die genannten Dimensionen geben einen Orientierungsrahmen zu den Aspekten von flexiblem Lernen und bieten zudem eine Möglichkeit, den Grad der Flexibilität eines Bildungsangebotes zu bewerten. Heutzutage wird flexibles Lernen vor allem durch den Einsatz neuer Technologien realisiert (Tucker & Morris, 2012). Die oben genannten Dimensionen zeigen jedoch, dass flexibles Lernen weit mehr ist als nur der Einsatz von neuen Technologien (Li & Wong, 2018). Diese dienen aber als wichtige Enabler, mit denen flexible Lernumgebungen gestaltet werden können. Im Kern geht es beim Konzept des flexiblen Lernens darum, dass Lernende durch verschiedene Optionen beim Lernangebot die Möglichkeit haben, ihre Aus- und Weiterbildung und damit ihren Lernprozess bestmöglich an die eigenen Bedürfnisse und damit ihrem spezifischen Lebenskontext anzupassen.
3Implementation von flexiblem Lernen
Bisher wurde flexibles Lernen hauptsächlich auf der Tertiärstufe implementiert, weil die Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf immer mehr in den Vordergrund rückt und einen wichtigen Anspruch der Studierenden an die Hochschule darstellt. Traditionell wurde die Vereinbarkeit von Studium und Beruf mittels Teilzeitstudien ermöglicht, die in vielen europäischen Ländern existieren; teilweise stehen diese aber nur Studierenden mit einer nachgewiesenen Beschäftigung in einem bestimmten Umfang offen (Eurydice, 2014). Dass das Bedürfnis nach flexiblen Studienangeboten besteht, zeigt der Erfolg von meist privaten Fernfachhochschulen, welche sich im Vergleich mit staatlichen Hochschulen trotz höherer Studiengebühren durch besonders flexible Studienangebote im Hochschulmarkt behaupten können. Unterdessen setzen aber auch staatliche Hochschulen auf flexibles Lernen. So erproben deutsche Hochschulen flexible Studienformate, um auf die zunehmende studentische Diversität zu reagieren (Zervakis & Mooraj, 2014). Die FH Südwestfalen hat beispielsweise ein «Studium flexibel» für ihre Studiengänge der Ingenieurwissenschaften eingeführt, bei welchem die beiden ersten Semester in vier Semestern durchlaufen werden können und das Studium mit verpflichtenden Gesprächen zur Studiensituation und unterstützenden Angeboten ergänzt wird. Mit diesem Studienformat möchte die Hochschule die in den MINT-Fächern hohe Abbrecher- und Durchfallquote reduzieren sowie gleichzeitig das selbstverantwortliche Handeln der Studienanfänger fördern (FH Südwestfalen, 2018). Ähnliche Ansätze zur Flexibilisierung der Studiengangszeit und -organisation werden momentan auch in den Niederlanden verfolgt (Cinop, 2017).
In der Schweiz hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) einen FLEX-Studiengang entwickelt, bei dem die Präsenzzeit gegenüber dem Teilzeitstudium um mehr als die Hälfte reduziert und durch eine Online-Lernumgebung ersetzt wurde (Müller, Stahl, Lübcke & Alder, 2016). Die bisherigen Befunde zeigen, dass Studierende und Dozierende den Studiengang positiv aufgenommen haben und Studierende des FLEX-Studiengangs im Vergleich mit Studierenden des konventionellen Studienformats zumindest gleichwertige Leistungen erzielen (Müller, Lübcke & Alder, 2017). Ob flexibles Lernen allgemein zu äquivalenten Lernergebnissen im Vergleich mit traditionellen Lernansätzen führt, wurde bisher wenig untersucht. Am ehesten können dazu die Metaanalysen zu Blended Learning (z. B. Vo, Zhu & Diep 2017) herangezogen werden; diese unterscheiden aber bisher nicht, ob der klassische Unterricht zusätzlich durch E-Learning-Angebote angereichert wird oder ob dieser durch solche Angebote ersetzt und damit flexibles Lernen ermöglicht wird.
Auch in der beruflichen Bildung auf der Sekundarstufe II besteht wie auf der Tertiärstufe eine Doppelbelastung von Beruf (resp. privaten Verpflichtungen) und Ausbildung, und es sind flexible Lernformen gefragt, die zeit- und ortsungebundenes Lernen ermöglichen. Obwohl das schweizerische Berufsbildungssystem bezüglich horizontaler und vertikaler Durchlässigkeit bereits eine hohe Flexibilität aufweist, werden momentan Möglichkeiten zur weiteren Flexibilisierung diskutiert (Seufert, 2018), und es wurden verschiedene Projekte zur Flexibilisierung der beruflichen Grundbildung sowie der Berufsmaturitätsschule initiiert.
An Gymnasien steht beim flexiblen Lernen nicht primär die zeitliche und örtliche Flexibilisierung im Vordergrund, sondern das Angebot von personalisierten Lernumgebungen, mit denen die Schülerinnen und Schüler gemäß ihren Lernvoraussetzungen und -präferenzen selbstbestimmte Lernwege wählen können. Damit kann die Abhängigkeit von der Lehrperson reduziert und den Lernenden mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess übertragen werden. Ob und in welchem Ausmaß auch eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung mit einer entsprechenden Reduktion der Präsenzzeit sinnvoll ist, bleibt offen, weil die Schule nicht nur Bildungsraum, sondern auch Lebensraum ist und die Bildungsinstitution dementsprechend auch Funktionen der Betreuung und Aufsicht übernimmt. Die Präsenzpflicht könnte durch flexibles Lernen jedoch den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um außerschulische Aktivitäten (z. B. Sport, Kunst, gesellschaftliches Engagement) zu fördern. Dies gilt verstärkt auch für die vorgelagerten Bildungsstufen (Primarschule und Sekundarstufe I), bei denen eine zeitliche und örtliche Flexibilisierung inklusive Reduktion von Präsenzzeiten aus pädagogischen Gründen von Lehrpersonen wie auch Elternschaft kaum akzeptiert würde.
4Herausforderungen und Grenzen des flexiblen Lernens
Wie unsere bisherigen Ausführungen zeigen, haben Bildungsinstitutionen auf verschiedenen Bildungsstufen in den letzten Jahren versucht, flexibles Lernen zu implementieren, wobei es weder sinnvoll noch praktikabel ist, in allen Dimensionen Flexibilität anzubieten. Aktuelle Studien zeigen, dass sich Lernende dessen durchaus bewusst sind und keine maximale Flexibilität in allen Dimensionen wünschen (Li, 2014; Tucker & Morris, 2012). Auf negative Effekte von zu viel Flexibilität wird auch von Vertretern der Kognitionspsychologie verwiesen (Corbalan, Kester & van Merriënboer, 2009). Wie Erfahrungen mit sehr offenen Lernumgebungen wie Discovery Learning zeigen (Kirschner, Sweller & Clark, 2006), sind sich insbesondere jüngere und wenig erfahrene Lernende nicht immer bewusst, was für ihren Lernprozess am besten ist, und treffen dadurch suboptimale Entscheidungen. Viele Optionen in sehr flexiblen Lernumgebungen können diesen Effekt – auch als Problem der Untersteuerung des Lernprozesses bezeichnet – verstärken. Zusätzlich sind durch viele Optionen auch laufend Entscheidungen nötig, was kognitive Ressourcen beansprucht und zu einer hohen kognitiven Belastung durch die Selbststeuerung im Lernprozess führen kann (Sweller, 1994).
Die Einführung von flexiblem Lernen ist durch die Individualisierung und Personalisierung des Lernprozesses für eine Bildungsinstitution und die involvierten Personen häufig mit weitreichenden Veränderungen verbunden, die mit entsprechenden Maßnahmen begleitet werden müssen. Für Lehrende hat flexibles Lernen insbesondere an Hochschulen eine Rollenerweiterung Richtung «Facilitators des Lernens» zur Folge, indem sie elektronische Lernressourcen wie Lernvideos produzieren, Online-Lernumgebungen konzipieren sowie individuelle Lernprozesse ermöglichen, unterstützen und begleiten. Für diese neuen Aufgaben müssen Lehrende mit Kursen, Coaching und Support sorgfältig vorbereitet und begleitet werden, damit keine negativen Veränderungseffekte wie Konfusion, Angst, Frustration oder Widerstand auftreten. Weiter kann die Implementation von flexiblem Lernen durch die Individualisierung und Personalisierung des Lernprozesses für eine Bildungsinstitution und die involvierten Personen aufwendig sein und deren Ressourcen übersteigen. Beispielsweise zeigen die Erfahrungen an der ZHAW bei der Entwicklung des FLEX-Studienformates, dass für eine Veranstaltung von 3 ECTS mit einem Initialaufwand von über 100 Stunden zu rechnen ist.
Читать дальше