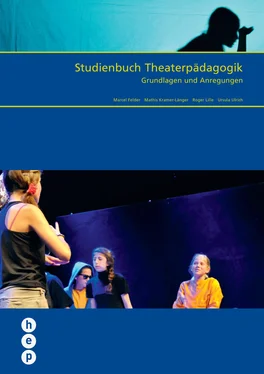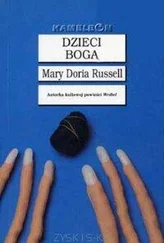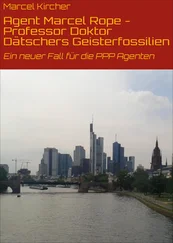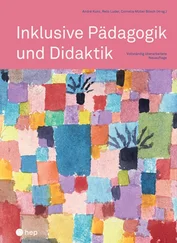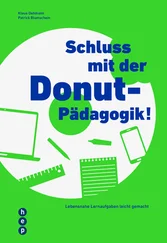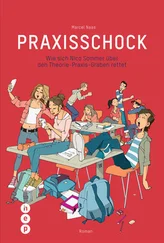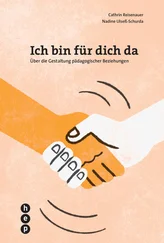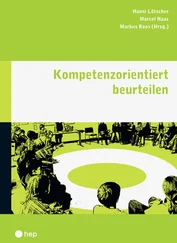Es war Wolfgang Nickel, der in den folgenden Jahren unermüdlich und schliesslich erfolgreich um Akzeptanz und einen eigenen Studiengang kämpfte: 1990 begann der erste Jahrgang mit dem ‹Zusatzstudium Spiel- und Theaterpädagogik›. Ausschlaggebend für den Erfolg war unter anderem der politische Umbruch in Deutschland, der grosses Interesse und neue Studierende brachte.
1993 übernahm Kristin Wardetzky, ehemalige Dramaturgin am Ostberliner ‹Theater der Freundschaft›, die Leitung des Studienganges. Sie brachte neue künstlerische Schwerpunkte wie das ‹Erzählen auf der Bühne› in die Ausbildung und regte erste Rezeptionsforschungen im Kindertheater an.
Seit der Jahrtausendwende leitet Ulrike Hentschel das Institut. Selber Abgängerin des Studiengangs, geht ihre wissenschaftliche und theatrale Suche in Richtung performative Ansätze. Ihre Publikationen sind in theaterpädagogischer Hinsicht profiliert und wegweisend. www.udk-berlin.de
sads (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Darstellende Spiel)
Parallel zu den ersten Ausbildungsgängen in Theaterpädagogik an der SAZ kam es zur Gründung der SADS, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Darstellende Spiel (einstmals noch mit dem Zusatz: ‹in der Schule›). Es war der erste lockere Zusammenschluss von Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen und an Schulspiel interessierten Lehrpersonen. Es wurden, zusammen mit der SAZ, Symposien und Weiterbildungen durchgeführt und 1981 erschien die erste ‹Spielpost›, die Wissenswertes, Tipps für den Unterricht, neue Strömungen thematisierte und sich für die Verbreitung theaterpädagogischen Arbeitens stark machte.
Nach Felix Rellstab als Gründungspräsident übernahm schon bald Marcel Gubler, damals Leiter der Beratungsstelle Theaterpädagogik am Pestalozzianum in Zürich, das Präsidium. Er engagierte sich für die Sache auf politischem Terrain, machte sich stark für das Theaterspiel in der Schule, vernetzte spielende Klassen und baute erste internationale Kontakte auf. Zu den Mitgliedern gehörten aber nicht nur Theaterpädagogen, sondern auch Schultheater-Grössen wie Josef Elias, der neue Formen und ästhetische Ansätze ins Schultheater einbrachte, oder Max Huwyler, bekannt für seine witzig-skurrilen sprachspielerischen Minidialoge.
Die SADS lancierte auch thematische Publikationen wie ‹Kleider-Klamotten-Kostüme› oder ‹Musik.Theater. Musik›. Für viele Theaterpädagogen und -pädagoginnen war die SADS erstes und lange Zeit einziges Gefäss des Austauschs, der Weiterentwicklung und der beruflichen Lobbyarbeit.
2004 erschien die letzte Nummer der ‹Spielpost› und die Arbeitsgemeinschaft löste sich auf, u. a. wegen mangelnder finanzieller Unterstützung durch den Bund, sicher aber auch infolge sich verändernder Arbeitsfelder, neuer Strukturen und einem höheren Anspruch an eine berufspolitische Ausrichtung: Gefragt war ein Berufsverband.
assitej (Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche)
Vor der Gründung des tps war die assitej, der Verband der professionellen Kinder- und Jugendtheaterschaffenden der Schweiz, für viele Theaterpädagoginnen und -pädagogen die berufliche Heimat, denn etliche arbeiteten sowohl als Schauspieler im Kinder- und Jugendtheaterbereich als auch als Theaterpädagogen.
Die assitej organisiert alle zwei Jahre das Theaterfestival ‹Spot›, dient als Job-Plattform und Austausch-Netz, lanciert Aktionen zum Tag des Kindes am 20. November und ist eine bewährte Anlaufstelle für gutes, altersadäquates, professionelles Theater für Kinder und Jugendliche. Mehr über ihre Aktivitäten unter: www.assitej.ch

1.2 ZIELE THEATERPÄDAGOGISCHER ARBEIT
Nicht nur die übergeordneten Zielsetzungen sind unterschiedlich und machen wohl auch die Unverwechselbarkeit jedes einzelnen Theaterpädagogen/jeder einzelnen Theaterpädagogin aus. Genauso unterschiedlich sind die ästhetischen Ansätze und theatralen Formen, die zum Tragen kommen. So vielfältig die inszenatorischen Zugänge auf der Profi-Bühne sind, so vielfältig sind sie auch im theaterpädagogischen Bereich: Vom Klassiker zum Zeitstück, von der selbstentwickelten Geschichte zur szenischen Collage, vom Stationenspiel über theatrale Installationen bis zu performativen Formen ist alles zu finden und erlaubt.
Theaterpädagoginnen und -pädagogen arbeiten in einem breiten Segment, mit einer breit gestreuten Klientel und mit unterschiedlichen Ziel- und Prioritätensetzungen. Grundsätzlich ist man sich aber einig, dass theaterpädagogische Arbeit aus pädagogischen und theatralen/künstlerischen Dimensionen besteht, wobei die Gewichtung der beiden Pole recht unterschiedlich sein kann und auch immer wieder Anlass zu Diskussionen und Abgrenzungen gibt. Es sind denn auch meist Behauptungen oder ‹Weltanschauungen›, die aufeinander prallen, denn auf fundiertes ‹Beweismaterial› ist kaum zurückzugreifen. Dazu trägt bei, dass Theaterpädagogik eine junge Disziplin ist, wenn es um Empirie und Forschungsresultate geht. Es gibt erst wenige Untersuchungen etwa zur Nachhaltigkeit oder Wirkung des Spielprozesses. Theaterpädagogik ist noch kaum wissenschaftlich aufbereitet und untersucht.
So basieren die ‹Erfolgsmeldungen› über die ‹Chance Theaterspiel› denn in der Regel auch auf Erfahrungen einzelner Macherinnen und Macher, auf mündlichen Rückmeldungen von Klassen und Lehrpersonen, auf Interviews und Kurzevaluationen mit Beteiligten.
Was Theaterspielen in der Schule bringt:
Auch wenn empirisch nicht belegt, ist sich die ‹Szene› trotzdem einig, dass Theaterpädagogik
–das soziale Gefüge einer Klasse oder Gruppe positiv beeinflussen kann;
–die Chance bietet, sich mit anderem und anderen, mit Fremdem und Fremden, auseinanderzusetzen;
–die Selbst- und Fremdwahrnehmung fördert;
–die Wahrnehmung sensibilisiert und Wachheit und Aufnahmebereitschaft unterstützt;
–teamfähiger macht;
–die Fantasie und die Kreativität anregt;
–Vertrauen in eigene Ideen geben kann und Selbstvertrauen fördert;
–die Auftrittskompetenz und die stimmliche und körperliche Präsenz stärkt;
–die Chance, sich von einer andern Seite zu zeigen, eröffnet;
–Gelegenheit ist, über sich selbst hinaus zu wachsen und Neues zu wagen;
–die Kritikfähigkeit – im Geben und im Nehmen – fördert;
–den sprachlichen Ausdruck schult;
–Empathie ermöglicht;
–Wege der Erprobung von Leben eröffnet;
–immer Spiel bleibt;
–Selbsterfahrung ermöglicht und die Chance birgt, sich auszuprobieren;
–das ästhetische Bewusstsein fördert;
–eine intensive Auseinandersetzung mit sich und der Welt, die einen umgibt, sein kann;
–Menschen an die Kunstform ‹Theater› heranführen kann;
–offener macht, sich dem Leben zu stellen und Courage zu beweisen;
–zu Standpunkten und zum Stellung beziehen herausfordert;
–dazu führt, sich – aktiv und passiv – mit zeitgenössischen Theaterformen auseinander zu setzen. Selbstverständlich soll dieser bunt gemischte Katalog nicht den Eindruck erwecken, als kämen alle aufgeführten Dimensionen der Wirkung stets gleichwertig und im selben Masse zum Tragen.
Die Gewichtung der unterschiedlichen Chancen, die sich mit der Theaterpädagogik verbinden, war und ist von der theaterpädagogischen ‹Epoche› und dem theaterpädagogischen Mainstream bzw. der Entwicklung abhängig. Ziele und Absichten haben sich in den vierzig Jahren, seit Theaterpädagogik ein Beruf ist, verändert und sind ein Stück weit auch Spiegelbild der Entwicklung von Pädagogik und Theater gemeinhin.
Читать дальше