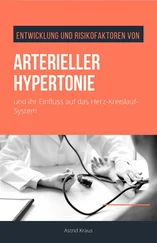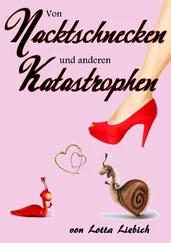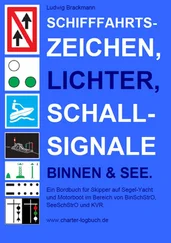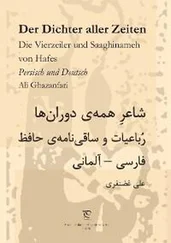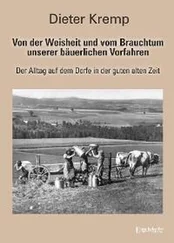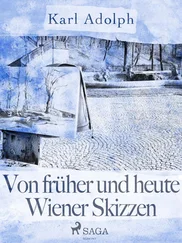Um das Jahr 15 v. Chr., während des Alpenfeldzugs von Kaiser Augustus, wurde Noricumschließlich römische Provinz.Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Übernahme friedlich verlief. Nach der römischen Okkupation wurden neun  Municipia gegründet, die unter lateinischem Recht und Territorium autonome Städte nach römischem Vorbild waren. Es waren dies Iuvavum (Salzburg), Aguntum (Lienz), Teurnia, Virunum, Flavia Solva(
Municipia gegründet, die unter lateinischem Recht und Territorium autonome Städte nach römischem Vorbild waren. Es waren dies Iuvavum (Salzburg), Aguntum (Lienz), Teurnia, Virunum, Flavia Solva(  S. 68), Celeia (Celje/dt. Cilli), Aelium Cetium (St. Pölten), Lauriacum (Lorch) und Ovilava (Wels). Meist befanden sich die römischen Städte schon auf älteren Ansiedlungen. Die Romanisierung ging an der Donau etwas langsamer vonstatten, dort erlangten die Städte erst im 2. Jh. n. Chr. den Status eines
S. 68), Celeia (Celje/dt. Cilli), Aelium Cetium (St. Pölten), Lauriacum (Lorch) und Ovilava (Wels). Meist befanden sich die römischen Städte schon auf älteren Ansiedlungen. Die Romanisierung ging an der Donau etwas langsamer vonstatten, dort erlangten die Städte erst im 2. Jh. n. Chr. den Status eines  Municipium. Spätestens ab Kaiser Claudius (41–54 n. Chr.) ist die Verwaltung der Provinz bekannt: Ein Prokurator aus dem Ritterstand hatte die gesamte zivile und militärische Verwaltung wie auch die Finanzverwaltung inne. In dieser Zeit war in Noricum im Übrigen keine Legion stationiert. Erst nach den Markomannenkriegen in der 2. Hälfte des 2. Jhs. wurde die Legio II Italica permanent nach Noricum, genauer nach Lauriacum (Lorch), verlegt. Dadurch änderte sich die Verwaltung. An der Spitze der Provinz stand nun ein Legionslegat aus dem Senatorenstand. Hauptsitz der Verwaltung dürfte Ovilava (Wels) gewesen sein, wobei das Finanzzentrum in Virunum blieb. Durch die Stationierung des Heeres wurde die Mannschaftsstärke fast verdoppelt, zu den 5500–7000 Auxiliarsoldaten (Hilfstruppen) kamen etwa 6500 Eliteinfanteristen dazu. Die Markomannenkriege richteten große Zerstörungen an, und vom römischen Heer aus östlichen Reichsteilen eingeschleppte Krankheiten führten zu weiteren großen Menschenverlusten.
Municipium. Spätestens ab Kaiser Claudius (41–54 n. Chr.) ist die Verwaltung der Provinz bekannt: Ein Prokurator aus dem Ritterstand hatte die gesamte zivile und militärische Verwaltung wie auch die Finanzverwaltung inne. In dieser Zeit war in Noricum im Übrigen keine Legion stationiert. Erst nach den Markomannenkriegen in der 2. Hälfte des 2. Jhs. wurde die Legio II Italica permanent nach Noricum, genauer nach Lauriacum (Lorch), verlegt. Dadurch änderte sich die Verwaltung. An der Spitze der Provinz stand nun ein Legionslegat aus dem Senatorenstand. Hauptsitz der Verwaltung dürfte Ovilava (Wels) gewesen sein, wobei das Finanzzentrum in Virunum blieb. Durch die Stationierung des Heeres wurde die Mannschaftsstärke fast verdoppelt, zu den 5500–7000 Auxiliarsoldaten (Hilfstruppen) kamen etwa 6500 Eliteinfanteristen dazu. Die Markomannenkriege richteten große Zerstörungen an, und vom römischen Heer aus östlichen Reichsteilen eingeschleppte Krankheiten führten zu weiteren großen Menschenverlusten.
193 n. Chr. wurde Septimius Severus in Carnuntum zum Kaiser ausgerufen. Da gleichzeitig zwei weitere Kaiser proklamiert wurden, folge ein Bürgerkrieg, der auch Noricum nicht verschonte. 197 konnte Septimius Severus schließlich seine Alleinherrschaft sichern, vor allem mithilfe der Donauarmeen. Auch das 3. Jh. verlief nicht ohne Probleme. An den Grenzen Obergermaniens und Raetiens drängten die Alemannen ins Reich, das erste Anzeichen der beginnenden Völkerwanderung. Vor allem an den Grenzen an Rhein und Donau kam es zu verheerenden Plünderungszügen. Auch im Römischen Reich waren die Zeiten unruhig: „Soldatenkaiser“ wurden vom Heer ausgerufen, regierten kurze Zeit und wurden (gewaltsam) wieder abgelöst. Es folgte im Weiteren eine Wirtschaftskrise, vermutlich mit einer Klimaverschlechterung einhergehend. Mit Blick auf die archäologische Forschung fällt auf, dass in unruhigen Zeiten häufig Wertgegenstände und Münzen verborgen wurden, die heute als Hort- oder Depotfund ans Tageslicht kommen. Auch der Brauch der Grab- und Weiheinschriften hörte in dieser Zeit plötzlich auf. Bereits in den ersten Jahren des 4. Jhs. unter Kaiser Diokletian wird Noricum in zwei Teile geteilt. Der nördliche Teil wurde zu Noricum ripense (Ufernoricum) und war wichtig als Grenzprovinz, der südliche Teil zu Noricum mediterraneum (Binnennoricum) ohne ständige militärische Besatzung. Das früher pannonische Municipium Poetovio (Ptuj/Pettau) wurde nun dem Noricum mediterraneum eingegliedert. Der Statthaltersitz blieb für das Ufernoricum in Ovilava (Wels) und Lauriacum (Lorch), für das Binnennoricum wurde er nach Virunum verlegt, im 5. Jh. n. Chr. schließlich nach Teurnia(  S. 136). Militärische und zivile Verwaltung waren von nun an personell getrennt.
S. 136). Militärische und zivile Verwaltung waren von nun an personell getrennt.

 Blick vom Frauenberg auf Schloß Seggau
Blick vom Frauenberg auf Schloß Seggau

 Reste der römischen Stadt Teurnia unweit von Spittal an der Drau: Blick in die frühchristliche Basilika
Reste der römischen Stadt Teurnia unweit von Spittal an der Drau: Blick in die frühchristliche Basilika
War man wenige Jahrhunderte zuvor von den Höhensiedlungen in die leichter erschließbaren Ebenen und Täler gesiedelt, so zog man sich nun wieder auf Anhöhen zurück und baute Stadtmauern. Auch innerhalb des Militärs und der Provinzbefestigungen fanden große Reformen statt. Besonders Mitte des 4. Jhs. wurde der Donaulimesdeutlich verstärkt. Doch schon zu Beginn des 5. Jhs. erfolgte der Niedergang des Römischen Reiches in Noricum. Das letzte Mal ist ein römisches Heer im Jahre 430 auf norischem Boden erwähnt. Im Osten drängten die Hunnen in das Reich und Aufstände aufgrund hoher Steuerlasten brachen aus. Kärnten wurde zwischen 493 und 536 Teil des Ostgotenreichs.Die letzte lateinische  Inschrift in Noricum datiert auf das Jahr 533. Das romanische Volk ging in den Slawen und Awaren auf.
Inschrift in Noricum datiert auf das Jahr 533. Das romanische Volk ging in den Slawen und Awaren auf.
Anfangs lebten die einheimischen Neo-Römer noch in Holzhäusern keltischer Tradition, doch ab dem 2. Jh. wurden die Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude nur noch aus Stein errichtet. Wer es sich leisten konnte, schmückte seine „vier Wände“ mit Mosaiken sowie Wandmalereien und die Möbel mit Elfenbeinschnitzereien. Auch Fensterglas war bereits in Verwendung. Städte von bisher unbekannten Ausmaßen entstanden und Thermen nach römischem Vorbild dienten nicht nur der Körperpflege, sondern auch der Entspannung und Muße. Händische Arbeit war für den echten Römer nichts, was Ansehen brachte. Große Landgüter,  Villae rusticae,versorgten die umliegende Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, ohne dabei die Repräsentation außen vor zu lassen. Die Bevölkerungszahl war so groß, dass Hochrechnungen davon ausgehen, dass sich in den dicht besiedelten und fruchtbaren Gebieten alle 2 km 2eine solche Landvilla befunden haben dürfte.
Villae rusticae,versorgten die umliegende Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, ohne dabei die Repräsentation außen vor zu lassen. Die Bevölkerungszahl war so groß, dass Hochrechnungen davon ausgehen, dass sich in den dicht besiedelten und fruchtbaren Gebieten alle 2 km 2eine solche Landvilla befunden haben dürfte.
Im 1. und 2. Jh. n. Chr. waren im Südosten von Noricum Hügelgräber mit Brandbestattung in Gebrauch, daher werden diese im Speziellen norisch-pannonische Hügelgräbergenannt. Der Verstorbene wurde auf einem Scheiterhaufen (ustrinum) verbrannt, danach die Asche auf dem Boden seines Grabes verstreut (Brandschüttung) oder in einer Urne aus Glas oder Ton beigesetzt. Ins Jenseits begleitet wurde er mit Grabbeigaben, die sich aus Gegenständen seines täglichen Lebens zusammensetzten: Essgeschirr, gefüllt mit Speisen und Getränken, manchmal für Frauen Schmuck und für Männer Waffen. Die Reichhaltigkeit der Gaben richtete sich nach dem Reichtum und Stand des Verstorbenen; nicht selten wurden zumindest Teile der Grabbeigaben auch mitverbrannt, etwa als Bestandteile der Kleidung des Verstorbenen.
Читать дальше
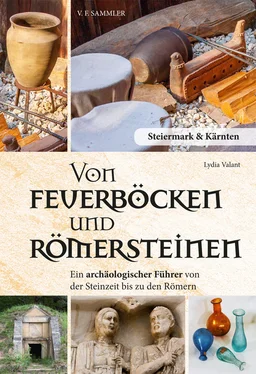
 Municipia gegründet, die unter lateinischem Recht und Territorium autonome Städte nach römischem Vorbild waren. Es waren dies Iuvavum (Salzburg), Aguntum (Lienz), Teurnia, Virunum, Flavia Solva(
Municipia gegründet, die unter lateinischem Recht und Territorium autonome Städte nach römischem Vorbild waren. Es waren dies Iuvavum (Salzburg), Aguntum (Lienz), Teurnia, Virunum, Flavia Solva( 
 Blick vom Frauenberg auf Schloß Seggau
Blick vom Frauenberg auf Schloß Seggau