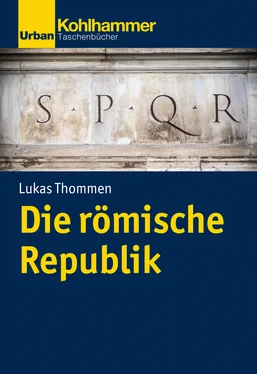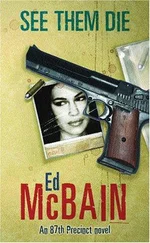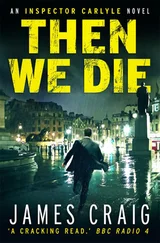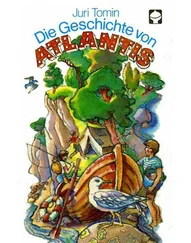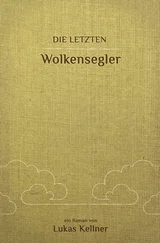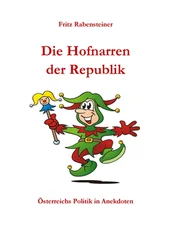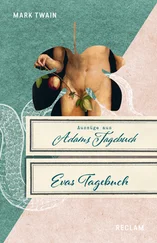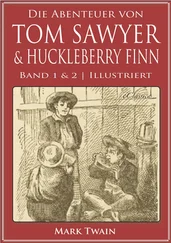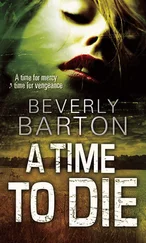1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Der römische Epiker Ennius schritt zu Beginn des 2. Jhs. v. Chr. in seinem fragmentarisch erhaltenen Gedicht Annales die sagenhafte römische »Geschichte« vom Fall Trojas bis zu Cato dem Censor (184 v. Chr.) ab. 4Mit Polybios aus Achaia erhalten wir kurz darauf zwar eine fundierte historische Darstellung, die sich aber einzig auf die Zeit von 264–146 v. Chr. bezog und nur zu einem Drittel erhalten ist. Seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. traten in Rom dann Lateinisch schreibende Annalisten auf. Ihre Bezeichnung leitet sich von annales ab, weil die Autoren die Ereignisse Jahr für Jahr berichteten. Dabei folgten sie ganz dem Schema des Fabius Pictor und hatten kaum ältere Überlieferungen zur Verfügung. 5
Livius lieferte in seiner Geschichte (Ab urbe condita libri CXLII) in augusteischer Zeit auch für die Frühzeit plausibel erscheinende, anschauliche Darstellungen und lässt ein eigenes Urteil, aber keine kritischen Analysen erkennen. Er übte nach wie vor die Methode der annalistischen Vorgänger aus, die aus dem Erfahrungshorizont ihrer eigenen Zeit rekonstruierten, und fand aufgrund seines besseren Stils Anerkennung. Der griechischsprachige Dionysios stellte die römische Geschichte von den Anfängen bis zum ersten Punischen Krieg dar und begründete Roms Aufstieg ebenfalls im Sinne der augusteischen Machtpolitik. Dennoch ist er gerade für die Zeit vom Galliersturm (387 v. Chr.) bis zum Ausbruch der Punischen Kriege eine wichtige Quelle, da insbesondere für das 3. Jh. v. Chr. Teile im Werk des Livius fehlen.
Am Anfang der Aufzeichnungen ist ein von den Priestern verfasster Festkalender (fasti) anzunehmen, der die Gerichtstage (fas) bezeichnete und im weiteren Verlauf möglicherweise die Namen der römischen Beamten umfasste. Zudem hielt der Pontifex Maximus angeblich von Anfang an auf öffentlichen Tafeln einzelne Ereignisse mit religiöser Bedeutung fest (annales), wie etwa Sonnen- und Mondfinsternisse oder Getreideteuerungen (Cic. de orat. 2,52; Gell. 2,28,4 = FRH 3 F 4,1). Der Ursprung der kalendarischen Aufstellungen ist jedoch unklar. Falls Verzeichnisse aus der Frühzeit vorlagen, dürften diese im Galliersturm untergegangen sein. Eine schriftliche Form des Kalenders ist erst am Ende des 4. Jhs. v. Chr. bezeugt, als die Plebejer ins Pontifikat eindrangen und die Aufzeichnungen für einen größeren Kreis bedeutend wurden (Cic. Mur. 25; Liv. 9,46,5; Plin. nat. 33,17). 6Die pontifikalen Annalen lassen sich konkret allerdings nicht weiter als bis ins mittlere 3. Jh. v. Chr. zurückverfolgen. Zudem wurden sie schon um 125/120 v. Chr. vom Pontifex Maximus P. Mucius Scaevola zum Abschluss gebracht (Cic. de orat. 2,52), wobei sie forthin in 80 »Büchern« (annales maximi) greifbar waren (Serv. Aen. 1,373). 7
Die weitere Verwendung von Pontifikalannalen und annales maximi für die Geschichtsschreibung bleibt grundsätzlich fraglich. Schon von Cato, der eine römische Geschichte von den Anfängen bis 149 v. Chr. in lateinischer Prosa verfasste, wurden die Verzeichnisse übergangen (Gell. 2,28,5 = FRH 3 F 4,1), da er darin für die »Ursprünge« Roms (origines) offenbar keine Aufschlüsse gefunden hatte. In der späten Republik trat eine Liste mit den eponymen Jahresbeamten (Konsulliste bzw. fasti) hinzu, die aber erst in augusteischer Zeit zu den fasti consulares und fasti triumphales vervollständigt wurde. Der Annalist C. Licinius Macer machte sich im 1. Jh. v. Chr. auf die Suche nach älteren Magistratsverzeichnissen, die er im Iuno-Moneta-Tempel auf Leinen gefunden haben soll (libri lintei). 8Falls diese tatsächlich existierten, dürften sie erst seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. geführt worden sein. Daher ergibt sich sogar der Verdacht, dass der Kalender in Form der fasti, also mit magistratischen Listen versehen, gar nicht von den Priestern verfasst wurde, sondern ein Produkt der Annalisten des 2. Jhs. v. Chr. darstellte. 9
Eine zuverlässige Überlieferung über die Frühzeit lag somit nirgends vor. Die Annalverzeichnisse können auf die Geschichtsschreibung jedenfalls nur eine beschränkte Wirkung ausgeübt haben. Vielmehr dürften die Erinnerungen der Senatoren als Quelle gedient haben. Diese folgten ganz den Gesetzmäßigkeiten der oral tradition, bei der die Verhältnisse der Anfangszeit so gestaltet wurden, wie sie in der eigenen Gegenwart als ideal galten. 10Es kam zu Dramatisierungen und Beschönigungen im Sinne der prominenten Familien, die ihre glorreiche Vergangenheit ins Zentrum rückten, sowie zur Verrechtlichung ursprünglicher Zustände aus dem Erfahrungshorizont der späteren Republik.
Sturz des Königtums und Übergang zur Republik
Schon die Beseitigung des letzten Königs, Tarquinius Superbus, wurde in der römischen Historiografie dramatisch ausgeschmückt (Liv. 1,57–60): Tarquinius Superbus aus Etrurien hatte die Herrschaft gewaltsam an sich gerissen und ohne Zustimmung von Senat und Volk regiert. Als sein Sohn Sextus die tugendhafte Lucretia, die Gattin eines Patriziers, vergewaltigte und diese sich entehrt den Tod gab, habe die Familie unter Führung des L. Iunius Brutus Rache genommen und den Tyrannen aus Rom vertrieben. Brutus ließ daraufhin das Volk schwören, niemals wieder einen König zu dulden. Zudem ließ er seine eigenen Söhne henken, da sich diese verschworen hatten, die Rückkehr der Königsfamilie aus dem Exil zu betreiben. Lars Porsenna aus Clusium, der Tarquinius zu Hilfe gekommen war, sowie sein Sohn Arruns konnten sich in Rom nur noch für kurze Zeit als Herrscher halten (Liv. 2,15).
Die mörderische Tat des Brutus wurde in späterer Zeit immer wieder gefeiert, wenn es darum ging, Bürger gänzlich in den Dienst des Staates zu stellen und den republikanischen Geist hochzuhalten. Insbesondere die Caesarmörder Brutus und Cassius konnten mit dem legendären Vorfahren parallelisiert werden. 11Dennoch dürfte es sich bei der Vertreibung des letzten Königs eher um einen Konflikt innerhalb der gens Tarquinia als um einen politischen Richtungsstreit gehandelt haben. Die Überwindung des Königtums erfolgte kaum durch eine einmalige Tat, sondern durch allmähliches Zurückdrängen des autokratischen Königtums im Verlauf der ersten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. Dabei ging der Adel dazu über, die Aufgaben unter sich aufzuteilen. 12
Das neue, jährlich wechselnde Führungsamt bleibt allerding schemenhaft. Gemäß einem »alten Gesetz« sollte der praetor maximus jährlich einen Nagel in den Iuppitertempel von 509/8 v. Chr einschlagen (Liv. 2,8,6; 7,3,5. 8; Plin. nat. 33,19 f.), sodass wohl noch keine »Konsuln« vorhanden waren. Naheliegend ist, neben dem praetor maximus noch mindestens zwei praetores minores anzunehmen, 13die alle vom Senat gewählt worden sein dürften. Für das Oberamt des Praetors kamen zunächst wohl nur Patrizier infrage. Prominente Vertreter der Plebs begannen aber, für den Zutritt zu den Ämtern zu kämpfen.
Was den alten königlichen Rat bzw. Adelsrat betrifft, so wurde dieser beibehalten, auch wenn die genaue Zusammensetzung unklar ist. Jedenfalls entstand kein neues, erweitertes Gremium, das der ganzen Bürgerschaft offenstand, wie das in Athen um 508/7 v. Chr. mit dem Rat der 500 (boule) der Fall war. Senatus leitet sich von senex/senes (»Greis/e«) ab und bezeichnet damit nach wie vor einen Ältestenrat. Mit der Einführung von jährlich wechselnden Oberbeamten, die den Senat leiteten, kamen auch gewesene Beamte in den Senat, sodass wohl eine gewisse Verjüngung stattfand. Zugleich wurde die Macht der führenden Familien im Senat gebündelt. Das Gremium erlangte in der Republik zentrale politische Bedeutung und wurde zum beratenden Organ für die Magistrate, die sich kaum über den Willen des Senats hinwegsetzen konnten. 14
Schon in der Königszeit war bei einem Interregnum die königliche Gewalt vorübergehend an den Senat gelangt, der sich um eine Nachfolge kümmern musste (Liv. 1,17,5 f.). In alten Zeiten war der Senat nach Festus (p. 290L s. v. Praeteriti senatores) ein consilium publicum, zunächst des Königs, dann der Konsuln, die die Mitglieder bestimmten. Dazu gehörten angeblich ihre engsten Freunde unter den Patriziern, dann auch unter den Plebejern. Die offizielle Bezeichnung für Senatoren war schon früh patres (et) conscripti: »Väter und Zugeschriebene« (Liv. 2,1,11). Dies deutet auf die Aufnahme von Plebejern in den Senat. 15Um diese mussten die Plebejer auch nie kämpfen, sondern nur um die Besetzung der Ämter.
Читать дальше