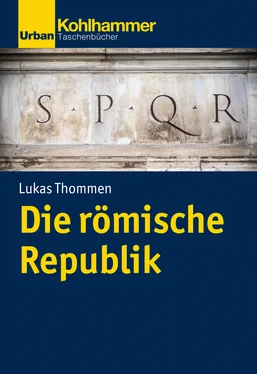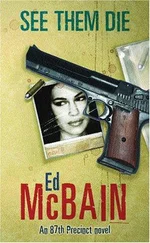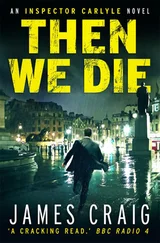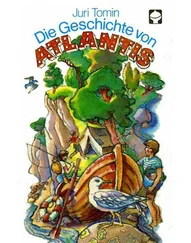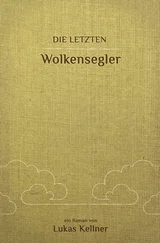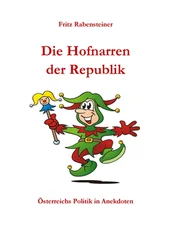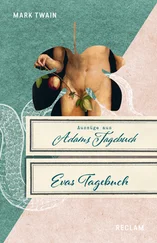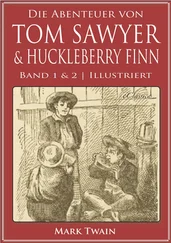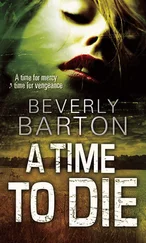Die Patrizier waren Grundbesitzer, stellten die Reiterei und formierten sich dementsprechend als Herrenschicht. Sie waren in gentes eingeteilt, für welche sich die Zahl der Klienten (clientes) als ausschlaggebend erwies. Die Bezeichnung clientes geht auf cluere, »auf jemanden hören«, zurück. Die Klienten bildeten die bäuerliche Unterschicht und standen in einem Treueverhältnis (fides) zu ihrem patronus. Während die Klienten zu Dienstleistungen für den patronus verpflichtet waren, garantierte dieser persönlichen Schutz und stellte seinen Getreuen bei Bedarf ein Stück Land zur Verfügung. 39Somit bestand eine wirtschaftliche und privatrechtliche Abhängigkeit, die um 450 v. Chr. auch durch das Zwölftafelgesetz geregelt wurde. Die gens Claudia hatte Anfang des 5. Jhs. v. Chr. angeblich 5000 Familien in ihrer Gefolgschaft (App. reg. 12; Plut. Publ. 21); ebenso viele Klienten sollen auch die Fabier besessen haben, was allerdings in beiden Fällen übertrieben erscheint. 40
Die Gruppe der Klienten ist grundsätzlich der Plebs zuzurechnen. Plebs bedeutet »Menge, Masse« und stammt von ple-/plenus: »voll, füllen«. Damit bildet sie einen Gegenpol zu den Familienclans der Patrizier. Zusammengesetzt war die Plebs aus Klienten, freien Bauern, Händlern und Gewerbetreibenden. 41Die Plebejer wurden wohl erst in der frühen Republik als eigene Gruppe rechtlich abgetrennt, als sich auch die Patrizier zu einem eigenen Stand formierten und gegenüber Neuzugängen abschlossen. Damit wurde zugleich ein Gegensatz heraufbeschworen, der erst in einem langwierigen Prozess ausgeglichen werden konnte, dem Geburtsadel aber weiterhin gewisse Privilegien zusicherte.
Die Patrizier kennzeichneten sich durch Standesabzeichen und übernahmen alle politischen und religiösen Funktionen. Ausschlaggebend dafür war eine existenzielle Bedrohung von außen, verursacht durch verschiedene Bergvölker, die in die Ebene drängten – aber auch durch das benachbarte Veji, das die selbstlos kämpfenden Fabier dezimiert haben soll (Liv. 2,50; Dion. Hal. 9,22; Ov. fast. 2,195–242). 42Dennoch förderten die Auseinandersetzungen weiterhin die Etablierung einer Elite, welche die militärische Abwehr organisierte. Die Plebejer als ihre Untergebenen waren daher ebenfalls gezwungen, sich zu einigen. Sie begannen am Anfang des 5. Jhs. v. Chr., sich selbst als politische Gemeinschaft zu formieren und den Patriziern Zugeständnisse abzuringen, sodass sich daraus ein »Ständekampf« entwickelte. Unglaubwürdig ist, dass anfänglich ein Eheverbot zwischen Patriziern und Plebejern bestand, gegen das sie sich zur Wehr setzen mussten (Zwölftafelgesetz 11,1; Liv. 4,1). 43
Die römische Gesellschaft kannte also einerseits eine einfache hierarchische Gliederung in eine Art Adel und Volk, das aber heterogen zusammengesetzt war. Gleichzeitig bestand eine starke horizontale Gliederung, aufbauend auf den Familien, die eine zentrale Rolle spielten, und in weitere Verbände (gentes, curiae,tribus) eingebunden waren. Die familia umfasste alle Hausgenossen, darunter auch die Sklaven. Sie bildete nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch eine ökonomische und kulturelle Einheit. Familienvorstand war der pater familias, der die auctoritas besaß, also unbeschränkte Macht über Ehefrau, Kinder, Sklaven und familiäre Güter (res familiaris). Bei ihm lagen demnach die Administration des Familienbesitzes (bonorum administratio), die Bewirtschaftung der Familiengüter und die Regelung der rechtlichen Geschäfte, darunter der Eintritt und Austritt aus der Familie im Falle von Heiraten. 44
Die Sklaven (servi), deren Zahl zunächst bescheiden gewesen sein dürfte, waren in den Familienverband eingegliedert, stellten aber auch Objekte (res) von Kauf und Verkauf dar. Im Falle von Verarmung konnte ein römischer Familienvater sogar seine eigenen Söhne verkaufen (Zwölftafelgesetz 4,2). Bei Zahlungsunfähigkeit drohte nämlich die Schuldknechtschaft bzw. die Haft mit dem eigenen Körper (nexum), was den Übergang in den Besitz des Gläubigers bedeutete (mancipium/mancipatio; Zwölftafelgesetz 3,2. 5). 45Später gelangten insbesondere Kriegsgefangene in die Sklaverei, sodass ein eigentlicher Sklavenmarkt entstand. 46
Die Familien wurden aufgrund von Blutsverwandtschaft zu Sippen (gentes) zusammengefasst. Die gentes hatten einen Gentilkult und einen Gentilnamen, der neben dem Individualnamen verwendet wurde, z. B. Q. Fabius Maximus aus der gens Fabia. Die Geschlechter waren in drei tribus und 30 curiae zusammengefasst (coviria = Männervereinigung; Liv. 1,13,6), die je einen Vorsteher (curio maximus) hatten. 47Die curia hatte sakrale Funktionen und war zugleich eine Organisationform für die Volksversammlung (comitia curiata). 48Diese bestätigte auch noch in der späteren Republik die höchsten Beamten in ihrer Amtsgewalt (lex curiata de imperio). Im Krieg bestand eine Kurienordnung, bei der jede curia zehn Reiter (decuria) und 100 Infanteristen (centuria) stellte (Liv. 1,13,8). In ihrer Gesamtheit bildeten die Kurien mit 300 Reitern und 3000 Infanteristen ursprünglich eine Legion. In der Königszeit waren die Kurien zudem in drei Personenverbände (tribus) vereint, wobei jede Tribus zehn Kurien hatte. In der frühen Republik waren diese Verbände durch die vier städtischen Tribus (Palatina, Collina, Esquilina, Suburana) ersetzt, zu denen in der näheren Umgebung 17 ländliche Tribus traten (Liv. 2,21,7). 49
3 Begründung der Republik
Das Ende der römischen Königszeit bzw. der »Sturz« des Königtums wird aufgrund von Livius (1,60,3 f.) auf das Jahr 509 v. Chr. datiert. Der Geschichtsschreiber setzt das Ereignis ins Jahr 244 seit der Stadtgründung (ab urbe condita), die seit Varro (1. Jh. v. Chr.) umgerechnet auf das Jahr 753 v. Chr. festgelegt war. Aus Plinius (nat. 33,19 f.) ergibt sich zudem, dass der Aedil Flavius im Jahre 304 oder 303 v. Chr. den Concordiatempel weihte und dies 204 Jahre nach der Weihung des Iuppitertempels auf dem Kapitol erfolgte, was laut Livius (2,8,6–8) wiederum unmittelbar nach Vertreibung des Tarquinius Superbus stattgefunden habe. Demnach käme man auf das Jahr 509 oder 508 v. Chr., wie das auch schon Polybios (3,22,1 f.) im 2. Jh. v. Chr. nahelegte. Hier dürfte allerdings zugleich eine Parallelisierung mit der Vertreibung der Peisistratiden (510 v. Chr.) und der Reform des Kleisthenes (508/7 v. Chr.) in Athen vorliegen, was das Datum des »Ereignisses« wiederum infrage stellt.
Grundlage für die weiteren Datierungen der antiken Autoren waren die Konsullisten (fasti), von denen aber für die Zeit vor 300 v. Chr. abweichende Versionen existierten. Am längsten waren die Fasti Capitolini, die bis zum Jahre 509 v. Chr. zurückreichten, aber erst im späteren Verlauf der Republik für die Frühzeit rekonstruiert bzw. in augusteischer Zeit abgefasst wurden. 1Da die schriftliche Überlieferung prekär war, ist im Folgenden zunächst ein Blick auf die Entstehung der römischen Geschichtsschreibung und deren Grundlagen zu werfen.
Römische Geschichtsschreibung
Die römische Geschichtsschreibung begann erst am Ende des 3. Jhs. v. Chr. und ist deshalb für die Frühzeit unzuverlässig. Der erste Historiker war Fabius Pictor, der eine Geschichte Roms seit den Anfängen schrieb. 2Diese war auf Griechisch verfasst und somit für ein gebildetes Publikum gedacht, wobei die lateinische Prosa in dieser Zeit generell noch wenig entwickelt war. Fabius Pictor berichtete ausführlich über die Zeitgeschichte ab dem ersten Punischen Krieg (264 v. Chr.), wusste für die älteren Epochen aber nur zu erzählen, was die mündliche Überlieferung bewahrt hatte. Diese umfasste eine heroisch ausgeschmückte Gründungsphase und war für die Folgezeit dürftig bzw. im Sinne bedeutender Familien gefärbt, wobei sie Fabius Pictor auch mit seinen eigenen Vorstellungen ergänzte. Das Geschichtswerk selbst ist zudem gar nicht erhalten, sondern nur durch die spätere Verwertung bei Livius (59 v. Chr.–17 n. Chr.) und Dionysios von Halikarnassos (ca. 54 v. Chr.–8 n. Chr.) bekannt, die vom Standpunkt der augusteischen Zeit interpretierten. 3
Читать дальше