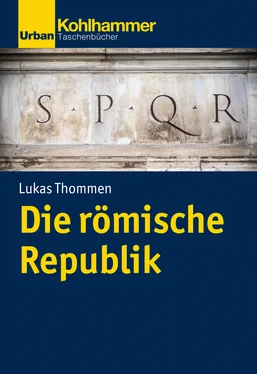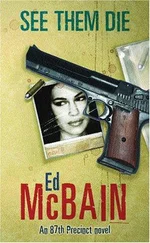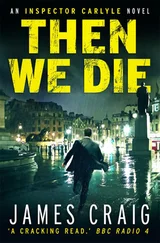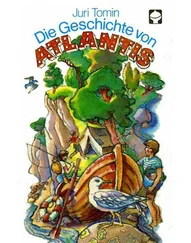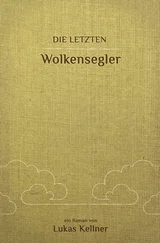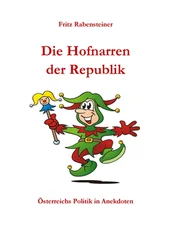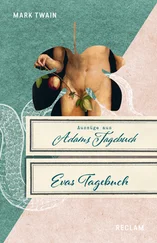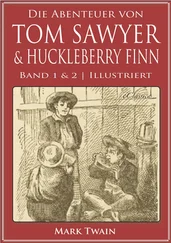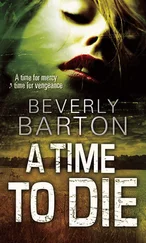Das Buch ist so angelegt, dass jedes Kapitel eine geschlossene Einheit bildet. In diesen werden Grundlagen vermittelt, die auch als Ausgangspunkt für eine weitergehende Beschäftigung mit den betreffenden Themen dienen können. Dazu sind die bedeutendsten Quellen in Klammern in den Text eingefügt und weiterführende Literaturangaben in den Endnoten angebracht. Wenn bestimmte Ereignisse oder Sachverhalte in einer ganzen Reihe von Quellen belegt sind, wird wiederholt auf die umfassenden Angaben in T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic (MRR), verwiesen, für die späte Republik auch auf die Quellensammlung von A. H. J. Greenidge, A. M. Clay und E. W. Gray, Sources for Roman History (GCG). Am Ende des Buches folgt eine thematisch gegliederte Bibliografie in der Reihenfolge der vorangegangenen Kapitel.
2 Die Anfänge Roms
Italische Grundlagen
Die Gebietsbezeichnung »Italien« geht vermutlich auf den altmediterranen Begriff für einen jungen Stier (vitelos/vitulus) zurück. Sie bezog sich anfänglich nur auf das Siedlungsgebiet der einheimischen Oinotrier im südlichen Kalabrien und wurde dann von den benachbarten Griechen und Samniten auf das ganze Territorium südlich von Poseidonia (Paestum) ausgedehnt. Die Auffassung von einer größeren geografischen Einheit entstand erst infolge der römischen Eroberung, die sich bis um 270 v. Chr. an die südliche Spitze der stiefelförmigen Halbinsel erstreckte und im Norden bis zur Linie von Pisa bis Ancona reichte. 1Noch nicht dazu gehörten die Po-Ebene und der ager Gallicus, der sich südlich des Flusses Rubicon entlang der Adriaküste zog. In diese Gebiete waren die Kelten um 400 v. Chr. eingewandert und hatten von dort aus Rom gebrandschatzt (Liv. 5,39–43). In der zweiten Hälfte des 3. Jhs. v. Chr. wurde schließlich auch dieses Gebiet von den Römern erobert, sodass sich daraus die Provinz Gallia Cisalpina entwickelte, die im Jahre 41 v. Chr. in das römische Kernland »Italia« integriert wurde.
Im frühen 1. Jt. v. Chr. gab es auf dem Gebiet des italischen Stiefels mehrere Kulturen und Sprachen. Um Bologna war die Villanova-Kultur angesiedelt, aus der sich die Etrusker entwickelten. Diese standen unter fremden Einflüssen, insbesondere der Griechen, waren aber nicht geschlossen von Lydien eingewandert, wie das Herodot (1,94) glauben machen will. Die Etrusker verwendeten eine nicht-indoeuropäische Sprache, die zwar entziffert, aber nicht immer verständlich ist. Im 8. Jh. v. Chr. ist die Ausbildung mehrerer Städte zu verzeichnen, aus denen sich später in der Toskana ein Zwölfstädtebund entwickelte (Strab. 5,2,2). Dieser erinnert an den Zwölfstädtebund in Ionien, umfasste aber wohl mehr als zwölf Städte und bildete eine »Amphiktyonie« (Bund) um das Heiligtum der Voltumna bei Volsinii (Orvieto?). 2Jährlich bestimmte der Bund einen Vorsteher (Praetor) mit zwölf Liktoren, wie sie dann auch bei den Römern festzustellen sind (Diod. 5,40,1; Dion. Hal. 3,61,2; Liv. 1,8,3). 3
Im 7. Jh. v. Chr. unternahmen die Etrusker einen Vorstoß nach Süden bis Kampanien, wo Capua das Zentrum bildete und gewannen daraufhin in Rom bestimmenden Einfluss. Um 540 v. Chr. erreichten die Etrusker einen territorialen und machtpolitischen Höhepunkt. Zusammen mit den Karthagern vertrieben sie bei Alalia (Korsika) die aus Phokaia eingetroffenen Griechen (Hdt. 1,166 f.), worauf die Karthager auch auf Sardinien siedelten und eine neue Konkurrenz bildeten. Einen entscheidenden Rückschlag erlitten die Etrusker im Jahre 474 v. Chr., als Hieron von Syrakus die etruskische Flotte bei Kyme besiegte (Pind. Pyth. 1,72–75; Diod. 11,51,1 f.). In dieser Zeit hatte die Etruskerherrschaft auch in Rom geendet, während sie sich in der Po-Ebene noch weiter ausbreitete.
Neben den Etruskern existierten mehrere italische Völker, die seit dem 12. Jh. v. Chr. zugewandert waren und eine indogermanische Sprache sprachen. Dazu gehörten die älteren Latino-Falisker, die in historischer Zeit Latium und Falerii am Tiber bewohnten, wobei sich die Latiner am Unterlauf des Flusses niedergelassen hatten. Daneben siedelten die Umbro-Sabeller, die nach sprachlichen Gesichtspunkten bzw. dem Oskischen auch Osko-Umbrer genannt werden und zahlenmäßig überlegen waren. 4Die meisten Stämme dieser Gruppe wohnten im Apennin, darunter die Umbrer, Sabiner, Marser, Volsker, Aequer, Samniten, Kampaner, Lukaner und Bruttier. 5
In Unteritalien und Sizilien machte sich seit dem späteren 8. Jh. v. Chr. die griechische Kolonisation bemerkbar. Von Chalkis auf Euböa aus wurde zuerst Pithekussai (Ischia) besiedelt, von wo aus Kyme (Cumae) als Nachfolgesiedlung auf dem Festland angelegt wurde (Strab. 5,4,7. 9). Ein Grund dafür war das Metall, da in Etrurien Eisen und Kupfer zu beziehen waren und auch Handel mit Zinn betrieben

Abb. 2: Die etruskischen Gebiete zur Zeit ihrer größten Ausdehnung mit den Städten des Zwölfstädtebundes.
wurde. Kyme vermittelte den Etruskern und Römern schließlich das chalkidische Alphabet, aber auch religiöse Einrichtungen, rechtliche Vorstellungen und griechische Stadtkonzeptionen. Unter den zahlreichen Orten, welche die Griechen in Unteritalien besiedelten, befanden

Abb. 3: Sprachen in Italien im 4. Jh. v. Chr.
sich Neapolis (Neapel), Poseidonia (Paestum), Taras (Tarent), Sybaris, Kroton (Crotone), Metapontion (Metapont), Lokroi Epizephyrioi (Locri) sowie Rhegion (Reggio Calabria) an der Meerenge zu Sizilien, an deren Gegenküste Zankle (Messina) lag. In Etrurien gab es griechische Viertel in den Hafenstädten von Caere (Cerveteri) und Tarquinii (Tarquinia). Zudem gelangte griechische Ware auch nach Rom, wie entsprechende Funde aus dem 8. Jh. v. Chr. auf dem Forum Boarium zeigen. 6
Für Rom existierten unterschiedliche Gründungsgeschichten, die einerseits auf den Trojaner Aeneas, andererseits auf Romulus zurückführten. Mit Aeneas wurde der Ursprung Roms an den griechischen Mythos angehängt und in den griechischen Kulturkreis eingebunden. Der Trojaner Aeneas soll nach der Zerstörung von Troja (um 1200 v. Chr.) durch die Griechen über Makedonien und Sizilien nach Latium gelangt sein (Liv. 1,1), wobei er beim augusteischen Dichter Vergil auch in Karthago, der künftigen Gegnerin Roms, Station gemacht hatte (Verg. Aen. 4,1–583). In Latium heiratete er Lavinia, die Tochter des Königs Latinus, und gründete Lavinium, das zu einem zentralen Heiligtum des latinischen Städtebundes wurde.
Aeneas soll auch den Ort Pallantium besucht haben (Verg. Aen. 8,126–369), der vom Arkader Euander auf dem Palatin gegründet worden war (Liv. 1,5; Dion. Hal. 1,31; 2,1,3), sodass von Rom der Eindruck einer griechischen Stadt entstand. Aeneas’ Sohn Ascanius legte dann Alba Longa an, welches den Hauptort des latinischen Stammes bildete und das Heiligtum des Iuppiter Latiaris als Gott des Latinerbundes beherbergte. Ein weiterer Hauptort des Latinerbundes war Aricia mit seinem Dianaheiligtum, das später nach Rom auf den Aventin als neues Zentrum verlegt wurde (Liv. 1,45).
Als zweite Gründungslegende kursierte das urtümliche Geschehen um Romulus, der einen eponymen Gründer verkörpert (Liv. 1,4,1–7). Dieser trägt keinen historischen Namen, sondern erklärt den Stadtnamen Roma, der sich vom etruskischen Namen »Rume/Rumele« ableitet. 7Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Remus soll Romulus als illegitimes Kind der Ilia (= Rhea Silvia), Königin von Alba Longa, die von Mars vergewaltigt worden war, in einem Nachfolgestreit ausgesetzt und am Ufer des Tibers von einer Wölfin gerettet worden sein. Als die Brüder später an dieser Stelle eine Stadt anlegen wollten, gerieten sie in einen Streit, bei dem Remus erschlagen wurde, sodass Romulus zum eigentlichen Gründer Roms wurde. Er befestigte den Palatin und baute die Stadt weiter aus (Liv. 1,7,3. 8,4).
Читать дальше