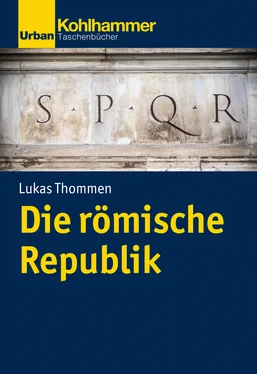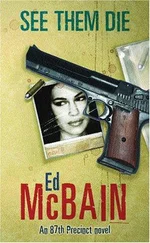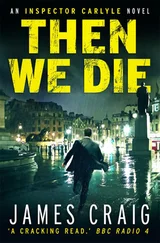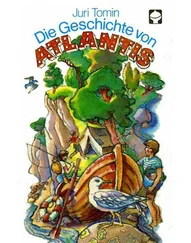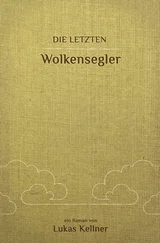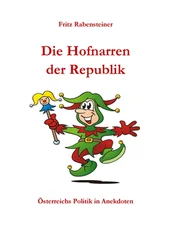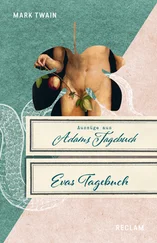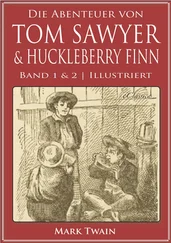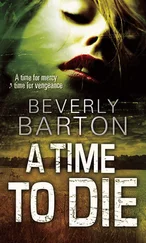Das Geschehen setzt in dieser Legende zwar deutlich später ein, wurde von griechischen Autoren aber direkt mit der Aeneasgeschichte verknüpft. Sie gestalteten Romulus als entfernten Nachkommen des Aeneas und schoben zwischen Aeneas und der römischen Republik das Königreich von Alba Longa ein. Als Datum für die Stadtgründung wurde von Varro im 1. Jh. v. Chr. schließlich jenes Jahr errechnet, das 753 v. Chr. entspricht, wobei daneben noch weitere Daten geltend gemacht wurden, nämlich 814/3 v. Chr. (Timaios) und 728 v. Chr. (Cincius Alimentus; Dion. Hal. 1,74,1).
Beim Gründungsdatum 753 v. Chr. handelt es sich um eine Konstruktion, die vom Jahre 509/8 v. Chr. als dem Ende der Königszeit und dem Anfang der Republik ausgeht. Die römische Frühzeit wurde mit sieben »Königen« zu durchschnittlich 35 Regierungsjahren ausgestaltet. Diese Herrschaftszeit ist mit 245 Jahren allerdings viel zu lang, sodass die Königszeit wohl mehr Namen umfasst oder erst später eingesetzt haben dürfte. Die Könige sollen alle wesentlichen Einrichtungen geschaffen und den Machtanspruch auf die Herrschaft über Latium erhoben haben. Alba Longa wurde vom dritten römischen König Tullus Hostilius (Mitte 7. Jh. v. Chr.) angeblich zerstört und die Einwohner nach Rom umgesiedelt (Liv. 1,29). 8Dabei ergab sich ein weiteres sagenhaftes Geschehen, nämlich der Kampf zwischen den Horatiern aus Rom und den Curatiern aus Alba Longa – zwei Drillingspaaren, die schworen, den Kampf unter sich auszutragen, um eine Schlacht zu vermeiden. Besonders dramatisch war, dass Horatius als Sieger seine Schwester umbrachte, da sie mit einem Curatier verlobt war und um diesen trauerte (Liv. 1,24).
Schwierig zu bestimmten ist das genaue Alter der zwei Gründungsgeschichten, die möglicherweise beide ins 5. Jh. v. Chr. zurückführen, wobei Remus als Konkurrent des Romulus aber erst in der zweiten Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. auftaucht, als sich in Rom eine doppelte Führung von zwei Konsuln etabliert hatte. 9Die Wölfin stellt einen unsicheren Anhaltspunkt dar, auch wenn sie als heiliges Tier des Mars, des Stammgottes der Römer, galt. Für die bekannte Bronzestatue der »Kapitolinischen Wölfin« mit vollen Zitzen wurde ein Datum aus dem frühen 5. Jh. v. Chr. vermutet, während eine Metallanalyse heute eine mittelalterliche Datierung nahelegt und die beiden Säuglinge erst in der Renaissance dazukamen. 10Zum ersten Mal dargestellt sind die Zwillinge auf römischen Münzen aus dem Jahre 269 v. Chr.

Abb. 4: Römische Wölfin, frühmittelalterliche Bronzefigur mit frühneuzeitlichen Zwillingen, Kapitolinische Museen Rom.
Die Königsreihe von Alba Longa ist erstmals im späten 3. Jh. v. Chr. bei Fabius Pictor zu fassen, der sich wohl auf den vorangegangenen griechischen Schriftsteller Diokles von Peparethos bezog (Plut. Rom. 3). 11Aeneas war zum ersten Mal im 5. Jh. v. Chr. bei Hellanikos von Lesbos und Damastes von Sigeion als Gründer von Rom erwähnt worden und hat sich dann bei Vergil (Aen. 1,278 f.) endgültig als Begründer der Weltherrschaft etabliert. Auf dem Palatin wurden schon in republikanischer Zeit die Hütte des Romulus und auf dem Forum dessen Grab verehrt, während mit dem Lupercal (Wolfshöhle) und dem Ficus Ruminalis (Feigenbaum) an den Ort der Ankunft und Aufzucht der Zwillinge erinnert wurde. 12
Königszeit und Etruskerherrschaft
Die Römer waren ursprünglich ein Teil der Latiner, gerieten aber im späteren 7. Jh. v. Chr. unter den Einfluss der Etrusker, deren Vertreter die politische Spitze bzw. Könige stellten: Tarquinius Priscus, sein Schwiegersohn Servius Tullius (aus dem Sabinerland) und Tarquinius Superbus. Die etruskischen Städte standen ebenfalls unter der Herrschaft von Königen, wobei das Königtum jedoch schon voretruskisch war und rex eine indogermanische Bezeichnung darstellt. Die römischen Könige wurden angeblich durch einen von den Patriziern gewählten Interrex (Zwischenkönig) bestimmt, dürften aber auch anhand von religiösen Vorzeichen eingesetzt worden sein (Inauguration). 13Sie folgten somit keinem Erbkönigtum und stammten ursprünglich alle von auswärts, wobei es sich um aristokratische Kriegsherren (»condottieri/warlords«) mit bewaffneter Gefolgschaft handelte. 14
Aufgrund der göttlichen Bestimmung hatten die Könige sakrale Rechte, sodass noch zur Zeit der Republik der rex sacrorum als Opferkönig fungierte. Der König war ursprünglich aber nicht nur oberster Priester, sondern auch oberster Feldherr und Richter. Ihm waren die sog. Zweimänner für Hochverrat (duumviri perduellionis) beigeordnet, die eine gewisse selbständige Tätigkeit ausübten und auch noch zur Zeit der Republik amtierten (Liv. 1,26,5–7). 15Neben ihm gab es einen königlichen Beirat bzw. Adelsrat, aus dem dann der Senat hervorging. Dieser bestand wohl vorwiegend aus den Häuptern der führenden (»patrizischen«) Familien (gentes), die aus verschiedenen Gegenden zugezogen waren. Dabei handelte es sich um einen Reiteradel (equites), welcher die berittene Gefolgschaft des Königs verkörperte.
Die frührömische Elite hatte verschiedene Standesabzeichen. Die führenden »Väter« (patres), die in der Republik den Stand der Patrizier bildeten, kennzeichneten sich durch einen Goldring (anulus aureus), einen Purpurstreifen (clavus) auf der Tunika, einen kurzen Reitermantel (trabea), Schuhwerk mit Riemen (calceus patricius) und Zierscheiben aus Edelmetall (phalerae). 16Die Insignien der etruskischen Könige wurden später von siegreichen Feldherren beim Triumphzug auf das Kapitol verwendet, nämlich die Purpurtunika, der Wagen, die Goldkrone und das (Elfenbein-)Szepter mit einem Adler. 17Auch die Amtsinsignien der römischen Magistrate sind etruskischen Ursprungs (Liv. 1,8,3). Der Amtssessel (sella curulis) leitet sich von dem königlichen Richtstuhl auf dem Wagen (currus) ab; der Purpurstreifen auf der Toga galt für »kurulische« Magistrate ab der kurulischen Aedilität – wobei letztere als Ordnungsamt allerdings erst im Jahre 367 v. Chr. eingeführt wurde (Liv. 6,42,14); die Rutenbündel (fasces) der Liktoren, welche die Obermagistrate begleiteten, verkörperten die Amtsgewalt, die mit dem Begriff imperium umrissen wurde.
Die Einteilung der römischen Bürgerschaft in drei Tribus basierte auf den etruskischen Namen Ramnes, Tities, Luceres. Der große Tempel auf dem Kapitol (Iuppitertempel), der nach dem Sturz des letzten Königs im Jahre 509 v. Chr. geweiht worden sein soll (Liv. 1,55 f.; 2,8,6–8), ist ein tuskanischer Dreizellentempel; in seiner monumentalen Form wurde er aber möglicherweise erst nach den Zerstörungen durch die Gallier (387 v. Chr.) errichtet. 18Rom stand zwar unter etruskischem Einfluss und wahrte eine kulturelle Kontinuität, war aber nie etruskisch geworden. Umgekehrt sind auch in etruskischen Städten latinische Einwirkungen festzustellen, sodass insgesamt ein reger Austausch herrschte. Aufgrund der Zuwanderung zeichnete sich in Rom jedoch eine neue Führungsschicht ab, die in der Republik bestimmendes Profil gewann.

Abb. 5: Fundamente des Iuppitertempels auf dem Kapitol.
Die Theorie der Stadtwerdung wendet sich gegen einen einheitlichen Gründungsakt, wie ihn Livius (1,6,3 f. 8,4) schildert. Gemäß diesem hätte Romulus auf dem Palatin den Bau einer Stadt vorgenommen, der entsprechenden Gründungsriten folgte und von einer sakralen Stadtgrenze begleitet wurde (1,44,4). Dabei handelte es sich um ein etruskisches Gründungsritual, bei dem eine Ackerfurche um die Stadt gezogen wurde, die in Rom die urbs von dem ager Romanus trennte (Plut. Rom. 11). Für die Stadt wurde die Trennung in den zivilen städtischen Bereich (domi) und den militärischen außerstädtischen Bereich (militiae) konstitutiv. Der Bereich des pomerium wurde schon in der Antike von post murum (»außerhalb der Mauer«) oder ponere murum (»Mauer bauen«) abgeleitet, war aber nicht mit dem Verlauf einer Stadtmauer identisch. 19Diese wurde in Rom erst dem König Servius Tullius (Mitte 6. Jh. v. Chr.) zugeschrieben (Liv. 1,44,3), der nach Romulus generell als eine Art zweite Gründerfigur fungierte.
Читать дальше