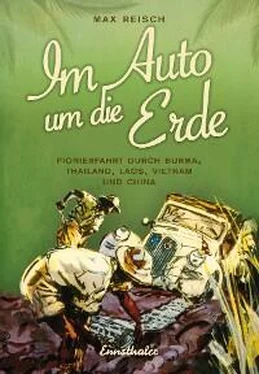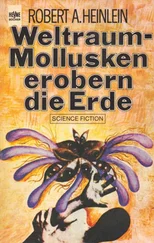Kandahar
»Was ist denn das?« Zweimal in kurzer Folge rief mir Helmuth diese Frage zu und jedes Mal hielt ich den Wagen an, damit wir uns genauer die noch nie gesehenen Merkwürdigkeiten afghanischer Arbeitsweise betrachten konnten. Das erste Mal waren es Bauern beim Getreideschnitt auf ihren dürftigen, steinigen Feldern. Sogar unverschleierte Frauen waren darunter, schöne, rassige Geschöpfe. Aber vorerst hatten wir gar keine Augen für sie, sondern nur für die Hände der Bauern. Über ihre Linke war nämlich eine Art Handschuh gezogen, dessen Daumen und Zeigefinger durch krumme Holzstäbe riesenhaft verlängert waren. Mit dieser Art Zange umfassten sie gleich ganze Garben und schnitten sie mit einer Sichel ab. Büschelweise fielen die Halme mit unglaublicher Schnelligkeit.
Helmuth lässt die Filmkamera anlaufen. Alle Arbeit stockt und – wie so oft schon – wilde, böse Worte werden uns und der Teufelsmaschine entgegengeschleudert.
Ruhiger hielten die Windmühlen, deren eigentümliche Anlage wir aus sicherer Entfernung von Mensch und Tier photographierten. Um eine vertikale Achse drehen sich aus Stroh geflochtene Windflügel, die aber den Wind nur von einer Seite auffangen sollen. Darum war um die andere eine ringförmige Lehmmauer in der Höhe eines zweistöckigen Hauses gebaut, die wie ein halber Turm aussah. Ein merkwürdiger Anblick! Und mindestens ebenso seltsam die Art, wie die Getreidesäcke auf kleinen Eselchen herangebracht wurden. Welche Lasten diesen Tieren zugemutet werden, hat uns immer wieder in Erstaunen versetzt. Man sieht kaum etwas anderes von ihnen als den Kopf und die zaundürren Beine. Aus einem Berg von Säcken scheinen sie herauszuragen und trippeln geschäftig dahin, wie von einem unermüdlichen Motor betrieben. Vorn auf dem Hals aber, vor den Lasten, sitzt stolz noch ein baumlanger Mann und lässt seine Füße tief herunterhängen. Wenn das Eselchen nicht mehr weiterwill oder im Sand zu versinken droht, streckt der Reiter seine Füße einfach etwas tiefer aus und marschiert kräftig mit. Urkomisch wirkt so ein sechsfüßiger Mensch-Esel.
Hinter einer hübschen kleinen Ortschaft mit blendend weißen, flachen Häusern bekommen wir aber doch noch menschliche Objekte vor die Kamera, die wohl oder übel stillhalten mussten. Wir durchfuhren auf schmaler Furt einen Fluss und fanden am jenseitigen Ufer rund um ein Lagerfeuer die übliche Gruppe wüst aussehender, schwer bewaffneter Afghanen. Hier aber verriet uns das afghanische Wappen auf ihrem Turban, dass wir es mit wohlbestallten Polizisten zu tun hatten, und als wir, trotz allem, etwas zögernd nähertraten, winkten sie uns schon zu, schwatzten, lachten und zeigten auf ein Kellergewölbe in einem verfallenen Haus. Neugierig sahen wir hinein und fuhren mit einem Aufschrei zurück. Den Polizisten war der Fang von einem halben Dutzend Räubern geglückt, die sie nun zur nächsten Polizeistation führen wollten. Mit schweren Ketten aneinandergefesselt, hockten sie da unten und stierten uns aus so fratzenhaften Teufelsgesichtern an, dass uns bei dem Gedanken angst und bange wurde, ihresgleichen in Freiheit anzutreffen. Auf unsere Bitte wurden einige der wilden Gesellen ins Licht gezerrt und wir konnten Räuberbilder machen, soviel wir wollten.
Verstohlen schauen wir uns aus den Augenwinkeln an. Beginnen wir etwa schon eine Ähnlichkeit mit ihnen aufzuweisen? Wir haben uns wegen eines Sonnenbrandes nicht rasieren können und schließlich beschlossen, die Bärte ruhig wachsen zu lassen, wie sie wollten. Immerhin, an den Seiten hatten wir sie uns gegenseitig zurechtgestutzt – unser Landsmann in Farrah würde nicht erschrecken, wenn wir so unvermutet vor ihm stünden. Das hatten wir nämlich zu unserem großen Erstaunen in Herat erfahren: In Farrah, dem meistgefürchteten und meistgehassten Ort Afghanistans, soll ein Österreicher leben! Infolge des entsetzlichen Klimas, tagsüber glühend heiß, nachts sehr kalt, gilt dieser Ort mit seiner Malaria und seinem Typhus so ziemlich als das Sibirien Afghanistans. Politische Sträflinge leben dort und dürfen sich zwar frei bewegen, nicht aber einen gewissen Umkreis rings um die Stadt überschreiten.
Einem der wenigen, die sich freiwillig hier aufhalten, gilt unsere Suche. Er soll beim Bau einer Brücke als Ingenieur beschäftigt sein. Auf der Straße kommt uns ein Trupp halb europäisch gekleideter Männer mit Lammfellmützen entgegen. Ein Polizist hat uns im Wagen begleitet und deutet jetzt hin. Ich muss gestehen, ich hätte den Mann nicht mehr als Europäer erkannt. Wir sprechen ihn deutsch an. Er ist so überrascht, dass er zunächst kaum ein paar Worte herausbringt. Dann aber überstürzen sie sich und gleich in drei Sprachen, Deutsch, Afghanisch und Ungarisch.
»Aus Budapest bin ich«, sagt er.
Aus Budapest! Und seine Freude, seit Jahren wieder einmal Deutsch zu sprechen, ist groß. Er kann sich kaum fassen und es dauert lange, bis er fähig ist, zusammenhängend von seinem Schicksal zu erzählen. Das ist abenteuerlich genug!
Im Ersten Weltkrieg versuchten zwei deutsche Expeditionen, Afghanistan als Verbündeten gegen England zu gewinnen. Eine stand unter der Führung Oberleutnant Niedermayers, des bekannten Gegenspielers von Oberst Lawrence. Unter größten Schwierigkeiten schlug er sich von Palästina über Persien bis Kabul durch. Unser Ungar gehörte mit sechs Österreichern dieser Partie an. Die Sache endete mit einem Misserfolg und die meisten Teilnehmer trachteten, über Turkestan und die Mongolei Ostasien zu erreichen, von wo sie schließlich im Jahre 1918 wieder nach Europa zurückkehrten. Der Ungar aber blieb in Afghanistan und verpflichtete sich, dort Straßen und Brücken zu bauen. Ja, er lebte sich so sehr ein, dass er zum Islam übertrat, Afghane wurde, eine Afghanin heiratete und wir ihn jetzt sogar als Beamten der afghanischen Regierung vor uns sahen. Er zeigte uns die Baustelle, die Brücke über den Farrah-Rud.
»Es wird eine schöne Brücke!«, sagen wir.
»Ja«, gibt er zu, »aber niemand weiß, wann sie fertig wird … Immer fehlt irgendetwas, das zum Bauen gerade dringend nötig wäre: Holz für die Verschalungen, Zement, Nägel, Klammern und vor allem gelernte Arbeitskräfte.«
Abends teilen wir mit dem Ingenieur sein bescheidenes Mahl, seit Jahren ein ewig gleichbleibendes Einerlei: Pilaw, den afghanischen Reis, Tee, Brot, Schaffleisch, Früchte. Dabei schildert er die ganze Trostlosigkeit seines einsamen Daseins fern von Europa und immer wieder übermannt ihn die Rührung. Zu plötzlich sind wir als lebendiger Gruß der fast vergessenen Heimat in sein Dasein eingebrochen, haben alte Wunden aufgerissen, sehnsüchtige Gedanken angeregt.
Budapest, die Donau, Wein, Csardas, ungarische Frauen – alles sieht er lebendig vor sich, die Tränen laufen ihm die Wangen herab, er beginnt zu jammern wie ein Kind: »Budapest, mein liebes Budapest!« Wir versuchen, ihn von seinen Erinnerungen abzubringen, aber es hilft nichts – er macht den Eindruck, unendlich traurig und zugleich selig zu sein, und erst lange nach Mitternacht gehen wir alle in seiner Baubaracke zur Ruhe.
Am nächsten Morgen hat Helmuth einen guten Gedanken: »Wir schenken ihm die Salami!« In unserem Vorrat tropensicher verpackter Fleischwaren, der immer nur in Zeiten der Not oder in festlicher Stimmung angegriffen wird, befindet sich noch eine schöne Stange Salami. Die packen wir jetzt aus und mit einer gewissen Feierlichkeit überreichen wir sie dem ungarischen Freund mit den Worten: »Ein Gruß aus der fernen Heimat!«
Große Aufregung bemächtigt sich seiner, mühsam kämpft er wieder mit Tränen, die Wurst aber ist immer noch in Helmuths Hand. Die Afghanen um uns schauen der Szene erwartungsvoll zu. Der Ungar nimmt die Salami nicht! Einigermaßen erstaunt sehen wir uns an. Da sagt er endlich mit erstickter Stimme:
»Um Gottes willen, nehmen Sie die Wurst wieder weg, ich darf sie nicht essen! Der Koran verbietet es, es könnte mich hier als Ingenieur mein ganzes Ansehen kosten!«
Читать дальше