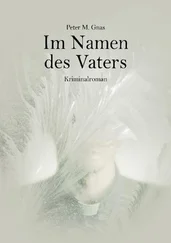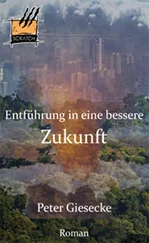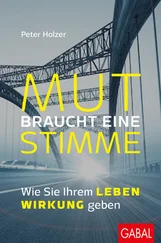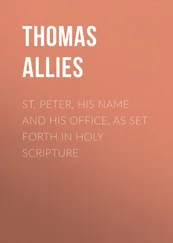Unser Gehirn ist evolutionsbedingt darauf ausgerichtet, uns vor Gefahren zu schützen. Das bedeutet, dass wir sehr achtsam für Negatives in unserem Leben sind und sehr schnell auf gefährliche Situationen reagieren. Das ist zunächst einmal nicht schlimm, sondern sichert unser Überleben.
Wenn Sie mit Ihrer Hand eine heiße Herdplatte berühren, ziehen Sie Ihre Hand automatisch zurück. Sinnes- und Nervenzellen nehmen den Schmerz wahr und leiten ihn weiter, wir empfinden Schmerz, und aus unserer Empfindung »heiß!« wird die Reaktion »Hand wegziehen!«. Synapsen – vom griechischen Wort synapsis (Verbindung) abgeleitet – sind die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, zwischen Nerven- und Sinneszellen oder zwischen Nervenzellen und Muskelfasern, und diese Verbindungen brauchen wir, damit solche wichtigen Informationen wie in obigem Fall schnellstmöglich übertragen werden und Informationen sowie Impulse weitergeleitet werden, um beispielsweise »heiß!« augenblicklich zu erkennen und die Hand mithilfe der Muskelfasern auf der Stelle wegziehen zu können.
Verhaltensmuster setzen sich durch ihre permanente Wiederholung fest und hinterlassen an diesen Stellen verdickte Synapsenstränge. Unter Druck oder in Stresssituationen reagieren diese Stellen durch ihre stärkere Ausformung schneller als die anderen, die weniger benutzten, und so wiederholen wir uns in diesem gelernten Verhalten – wir benutzen den bequemeren, bekannten, fein ausgetretenen Weg durch den Garten.
Unsere persönliche Wertewelt wird von tief in uns eingeprägten Parametern gesteuert: von unserem Umgang mit richtig oder falsch, von dem Stellenwert, dem wir positiv oder negativ beimessen und von unserer Gewichtung von »Grün« und »Rot«. Je nachdem, welchen Rang richtig und falsch in unserer Kindheit hatten und welche Reaktionen und Verhaltensweisen uns von unseren Bezugspersonen und unserem Umfeld von klein auf vorgelebt wurden – die Summe unserer Erfahrungen ist das Fundament für unsere eigene Priorisierung von gut oder schlecht, richtig oder falsch, »Grün« oder »Rot«.
DER SOZIALE VERGLEICH PRÄGT UNSERE VERHALTENSMUSTER
Viele unserer Verhaltensmuster sind durch Erwartungshaltungen geprägt. Wir verhalten uns schon von Kindheit an so, wie wir denken, es könnte den Bezugspersonen gefallen – sei es der Mutter, dem Vater, der Kindergärtnerin oder dem Handarbeitslehrer. Der soziale Vergleich spielt dabei eine immens große Rolle.
Bei der Erstkommunion sind viele Eltern darauf erpicht, dass ihr Kind das hübscheste ist – welches der Kinder sich bei der Erstkommunionvorbereitung am interessiertesten und präsentesten hervorgetan hat, ist den meisten Eltern weniger wichtig, es gibt so viele andere, nach außen gerichtete Dinge zu organisieren und vorzubereiten. Die Hochsteckfrisuren vieler Erstkommunionmädchen lassen manche erwachsene Braut erblassen – eine außergegenständliche Wertung dominiert das Geschehen, eine optische nämlich, und es geht maximal am Rande um ein gemeinsames Erleben dieser schönen und bedeutsamen Feier. Schon während Firmungen und Erstkommunionfeiern wird unter den Eltern hinter vorgehaltener Hand über jene gesprochen, die »ein ausgeborgtes Kleid« und »keine ordentliche Frisur« haben. Sei hübsch, sei perfekt, sei brav, bringe keine Flecken an das teure Outfit und mache keine Fehler beim Vorlesen in der Kirche – das ist es, was die meisten Kinder aus diesen Events mitnehmen (neben ein paar Geschenken und später hoffentlich dem angenehmen Gefühl, dass alles fehlerlos über die Bühne gegangen ist).
Der Sportlehrer sagt zum jüngeren Bruder: »Die Sportsachen zu Hause vergessen … das hätte es bei deinem älteren Bruder nicht gegeben!« Er sagt nicht: »Schön, dich in meiner Klasse zu haben – dieses Jahr haben wir endlich einen Fußballer in der Mannschaft, mit dem wir die Fußballmeisterschaft der Schule gewinnen können.« Er sagt auch nicht: » Dein Bruder konnte nicht Fußball spielen, schön dass wir jetzt dich in der Klasse haben – und bitte vergiss die Sportsachen nicht mehr, damit du immer mitmachen kannst!« Nein, er sagt: »Die Sportsachen zu Hause vergessen … das hätte es bei deinem älteren Bruder nicht gegeben!« – Anstatt auf Motivation setzt er auf eine herabwürdigende, fehleraufzeigende und damit sehr effiziente Methode, um den jüngeren Bruder dazu zu bringen, die Sportsachen nicht mehr zu vergessen. Mein älterer Bruder ist einfach so viel besser als ich, dem passieren solche Fehler nicht – das ist es, was der jüngere so von klein auf lernt.
Vielleicht findet sich auch der eine oder andere Leser in einem der beiden Beispiele wieder. In meinen Seminaren und Vorträgen erzählen die Teilnehmer regelmäßig von ähnlich gelagerten Erlebnissen. Woran erinnern Sie sich zuerst, wenn Sie an Ihre Tanzschulzeit, Ihre Hochzeit, den letzten Urlaub oder die letzte Firmen-Weihnachtsfeier denken? Zumeist sind es die Fehler, die Ausrutscher, die negativen Aspekte, die wir in Sekundenbruchteilen abrufen können, oder Situationen, in denen wir (oder andere) im sozialen Vergleich (vermeintlich) schlechter abgeschnitten haben.
Zum sozialen Vergleich gehört auch der Vergleich mit den Eltern: »Du bist wie dein Vater.« Was uns als kleine Kinder noch entzückt, kann später zur Beleidigung oder zur Bedrohung werden. Oder als Entschuldigung herhalten: »Stimmt. Ich trinke ab zu ein Glas Wein zu viel. Mein Vater hat das auch gemacht!«, »Stimmt. Mir rutscht hin und wieder die Hand aus. Ich bin selbst auch geschlagen worden!«, »Meine Mutter hatte einen Putzfimmel, den habe ich offensichtlich von ihr übernommen!« Solche Sätze hören wir regelmäßig, aber kaum jemand kommt auf die Idee, zu artikulieren, was er Gutes von seinen Eltern mitbekommen hat. Wie oft haben Sie schon jemanden sagen gehört: »Ich bin ein fleißiger Mensch, das habe ich von meinem Vater gelernt«, »Ich bin ein guter Sportler, denn meine Mutter war auch vielseitig sportlich begabt«, »Ich bin sehr ordnungsliebend, das habe ich von meiner Mutter übernommen« oder »Ich kann Rückschläge gut wegstecken, das haben mir meine Eltern beigebracht«.
 Schreiben Sie ganz spontan Eigenschaften auf, die Sie von Ihren Eltern vermeintlich geerbt haben – links die negativen, rechts die positiven. Darf ich raten, welche Spalte länger ist? Und darf ich fragen, bei wie vielen Begriffen in der Spalte mit den positiven Eigenschaften Sie in Gedanken ein »Eigentlich« oder »Durchaus« hinzugefügt haben, weil Sie sich zwar schon »durchaus mutig« oder »eigentlich ganz klug« finden, sich aber schwergetan haben, sich selbst das Attribut »mutig« oder »klug« zuzuordnen?
Schreiben Sie ganz spontan Eigenschaften auf, die Sie von Ihren Eltern vermeintlich geerbt haben – links die negativen, rechts die positiven. Darf ich raten, welche Spalte länger ist? Und darf ich fragen, bei wie vielen Begriffen in der Spalte mit den positiven Eigenschaften Sie in Gedanken ein »Eigentlich« oder »Durchaus« hinzugefügt haben, weil Sie sich zwar schon »durchaus mutig« oder »eigentlich ganz klug« finden, sich aber schwergetan haben, sich selbst das Attribut »mutig« oder »klug« zuzuordnen?
Für den sozialen Vergleich ziehen wir in der Regel die Kategorie »Negativ« heran. Wir blicken auf die Dinge, die vermeintlich nicht der allgemeinen Erwartungshaltung – und damit auch nicht der unseren – entsprechen. Wir haben es so gelernt und dieses Verhaltensmuster ist aufgrund der intensiven Prägung so stark in uns verankert, dass es sich nicht so ohne Weiteres ablegen lässt. Wir praktizieren diese Projektion auf das Falsche und das Negative so lange und so intensiv, dass wir als Erwachsene mit Lob und Anerkennung überhaupt nicht mehr umgehen können. In meinen Seminaren orte ich auf diese Aussage hin gelegentlich den einen oder anderen skeptischen Blick, denn wer steht schon gern dazu, zuerst auf das Negative zu blicken und auf das, was seiner Ansicht nach nicht der allgemeinen Erwartungshaltung entspricht? Ich trete dann mithilfe einer kleinen Übung den Beweis für meine These an:
EINE KURZE GEDANKLICHE ÜBUNG ZUM BEWEIS
Читать дальше
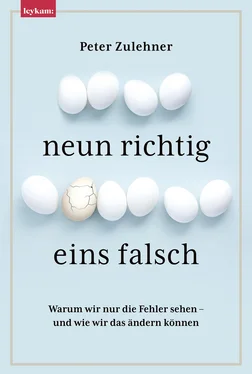
 Schreiben Sie ganz spontan Eigenschaften auf, die Sie von Ihren Eltern vermeintlich geerbt haben – links die negativen, rechts die positiven. Darf ich raten, welche Spalte länger ist? Und darf ich fragen, bei wie vielen Begriffen in der Spalte mit den positiven Eigenschaften Sie in Gedanken ein »Eigentlich« oder »Durchaus« hinzugefügt haben, weil Sie sich zwar schon »durchaus mutig« oder »eigentlich ganz klug« finden, sich aber schwergetan haben, sich selbst das Attribut »mutig« oder »klug« zuzuordnen?
Schreiben Sie ganz spontan Eigenschaften auf, die Sie von Ihren Eltern vermeintlich geerbt haben – links die negativen, rechts die positiven. Darf ich raten, welche Spalte länger ist? Und darf ich fragen, bei wie vielen Begriffen in der Spalte mit den positiven Eigenschaften Sie in Gedanken ein »Eigentlich« oder »Durchaus« hinzugefügt haben, weil Sie sich zwar schon »durchaus mutig« oder »eigentlich ganz klug« finden, sich aber schwergetan haben, sich selbst das Attribut »mutig« oder »klug« zuzuordnen?