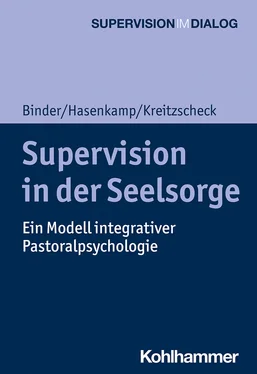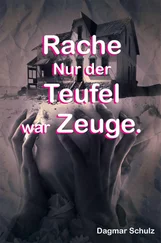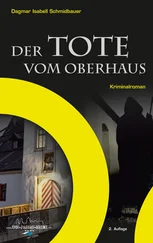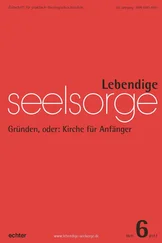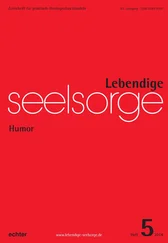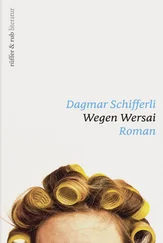Im katholischen Bereich spielt dann noch zusätzlich die besondere Hierarchie in dieses komplexe Feld mit hinein. So sind nicht-geweihte Pastoralreferent*innen oft in ähnlich totalen Rollen wie etwa die geweihten Priester und leiden wie diese unter Erschöpfungssymptomen. Im Unterschied zu den geweihten Amtsinhabern stehen erstere jedoch dienstlich und arbeitsrechtlich in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu letzteren und sie haben nicht die gleichen Privilegien.
Insgesamt hat die jüngere Generation in den Pfarrämtern inzwischen ein historisch neues Bestreben, Arbeit und private Existenz sorgfältiger zu unterscheiden. Es besteht »das Bedürfnis, das Familienleben abzuschirmen und die Freizeit zu schützen und gleichzeitig die besondere Qualität, die das gesamte Leben durch den Glauben erhält, in einer angemessenen Verbindlichkeit zu realisieren« (Lammer & Klessmann, 2007, S. 146).
Supervision im pastoralen Arbeitsfeld beschäftigt sich mit solchen Angemessenheits- und Realisationsfragen.
In beiden Kirchen gibt es derzeit auf allen Ebenen große strukturelle, demographisch bedingte Veränderungen. Beide Großkirchen stehen in einem lebendigen Prozess, um auf diese Veränderungen und die damit aufgeworfenen Fragen für ihre Beschäftigten zu antworten und zu reagieren. Die katholische Kirche macht sich dabei auf den sog. Synodalen Weg, (diskutiert den Zugang von Frauen zum Diakonat bis hin zur Abschaffung des Pflicht-Zölibats für Priester), die evangelische Kirche hat sog. Pfarrbild - bzw. Berufsbildprozesse ins Leben gerufen, um vor Ort in den Kirchenbezirken die Stimmen und Stimmungen ihrer haupt- und nebenamtlich Beschäftigten zu hören, zu sammeln, und gegebenenfalls ihre veralteten Dienstrechte der neuen Situation anzupassen.
Für die Arbeitswelt 4. 0 gilt: »Der virtuell zugängliche Raum ist grenzenlos. Jederzeit und überall können Nachrichten und Wissensbestände gesendet und empfangen, können Waren gehandelt werden. In der von globaler Konkurrenz beschleunigten Arbeitswelt wird just in time disponiert. Im individuellen Alltag legt das Smartphone nahe, zeitlich spontan zu handeln anstatt vorab zu planen. Zukunftsperspektiven schrumpfen. Die wachsende Menge fragmentierter Optionen zu gewichten, auszuwählen und entsprechend zu disponieren, erfordert schnellen Einsatz – also eine neuartige gegenwartsbezogene Rationalität« (Zeiher, 2018, S. 1). Der*die Pfarrer*in bzw. Diakon*in der Zukunft wird nicht nur technisch vernetzter und mobiler sein als alle seine*ihre Vorgänger*innen, sondern auch sozial kooperativer und kollegialer sein (müssen). Der Konzentrationsprozess macht auch vor der Kirche nicht halt. Landauf und landab werden Gemeinden zu Kooperationen zusammengelegt und bilden sich sog. Dienstgruppen. Hier kommt jetzt auch die Berufsgruppe der Gemeindediakon* innen noch einmal speziell ins Spiel, die in diesen Prozessen ebenfalls vermehrt der supervisorischen Begleitung bedarf, was auch so im Gemeindediakoninnen- und -diakonengesetz fest verankert wurde.
Dass hierbei in den Supervisionssitzungen mit diesen beiden Berufsgruppen dann auch – mehr oder weniger intensiv – generelle Lebensführungsfragen tangiert und angesprochen werden, versteht sich von selbst. Denn: Supervision im Raum der Kirche und wo immer sie sonst geschieht, vollzieht sich in einem Beziehungsdreieck von Person – Amt – Beruf und im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. Dabei sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einem steten Wandel unterworfen. Hatte die Kirche als Institution und auch als Arbeitgeberin früher noch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz, so ist heute von einem Autoritäts- und Bedeutungsverlust zu sprechen. Die Sonderstellung der Kirchen als Tendenzbetrieb im Arbeitsrecht, ebenso wie die Steuerbegünstigung als gemeinnützige Körperschaft öffentlichen Rechts wird gesellschaftlich und damit auch politisch mehr und mehr in Frage gestellt. Kirche wird damit zu einem Verein wie jeder andere. Und das bekommen v. a. die in der Kirche hauptamtlich Arbeitenden zu spüren:
Im sogenannten klassischen Pfarrer*innen-Beruf trug das Amt noch die Person, war der*die Pfarrer*in noch die Amtsperson, das konnte als Entlastung empfunden werden. Der Dienst des Pfarrers oder der Pfarrerin war also stark berufsförmig. Im modernen Pfarrer*innen-Beruf dagegen hat es eine Verschiebung vom Amt hin zur Person gegeben. D. h., weniger die Amtsautorität, die jemand hat, zählt als vielmehr die persönliche Authentizität. Das wird dann von den Amtsinhaber*innen als neu gewonnene Freiheit empfunden. Zugleich aber wächst mit dieser Freiheit ein enormer Druck, als Pfarrer*in ein*e gute*r Performer*in zu sein. Denn jetzt muss die Persönlichkeit mehr und mehr das Amt tragen. Aus pastoral-soziologischer Perspektive verlagert sich die Berufsförmigkeit des klassischen Dienstes hin zur Lebensförmigkeit des modernen Dienstes (Stichworte: Individualisierung, Subjektivierung, Selbstorganisation, unternehmerisches Selbst, Flexibilisierung, entgrenzte Arbeit, prekäre Freiheit, work-life-balance.) Damit bildet Kirche auch den gesamtgesellschaftlichen Kontext der Arbeitswelt ab. Und ähnlich wie in der Arbeitsgesellschaft sprechen die rasant gestiegenen Zahlen von Burnout-Erkrankungen unter der Berufsgruppe der Pfarrer*innen eine deutliche Sprache. Nach der jüngsten Studie zur Pfarrgesundheit »Stadt, Land, Frust?« ist in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) jede*r achte Pfarrer*in (13 %) von Burnout betroffen, 33 % gehören zur Risikogruppe (Stahl, Hanser & Herbst, 2020). Pfarrer*innen, das zeigen die gegenwärtigen Pfarrbildprozesse, wünschen sich wieder eine stärkere Berufsförmigkeit ihres Dienstes, in Form von abgegrenzten Tätigkeitsfeldern, klaren Arbeitszeiten, klaren Zuordnungen, ohne aber in den alten paternalistischen Schoß von »Mutter Amtskirche« wieder zurück zu wollen. Nach J. Koll spricht viel dafür, »dass mit dieser neuen Pfarrgeneration der Übergang von der Lebens- zur Berufsförmigkeit des Pfarrberufs vollständig vollzogen wird« (Deutsches Pfarrerblatt 2/2018, S. 64). Man darf also gespannt sein, wohin dieser Weg der sog. Y- Generation noch führt, wenn J. Böhm für die Zukunft prognostiziert: »Die Generation Y wird uns mehr verändern als wir sie verändern werden« (Böhm, 2015, S. 91–94). Supervisorisch gilt es jedenfalls, bei allen kirchlichen Mitarbeiter*innen (unabhängig davon, ob Y-, 68er-, Babyboomer- oder X-Generation) in diesem Beziehungsdreieck von Person – Amt – Beruf, den Fokus immer wieder auf die pastorale Berufsrolle zurück zu lenken und gleichzeitig zu markieren, dass diese nur einen Teil der Person ausmacht und keinesfalls mit dieser identisch ist. Und es ist weiter klar herauszuarbeiten, dass die Rolle, die der*die Pfarrer*in bzw. Gemeindediakon*in ausübt, nur eine von vielen in der Amtskirche darstellt, also eine kleine Schnittmenge zwischen Person und Institution darstellt, auch wenn bei Pfarrer*innen und Gemeindediakon*innen v. a. der 68er- und Babyboomer-Generation die eigene Biographie oft mit der Organisations-/Institutionsbiographie eng verbunden ist und darum Kürzungen von Stellen, Fusionen oder gar Kirchenschließungen nicht selten als persönliche Kränkungen empfunden werden. Umso mehr muss darum auch die Institution Kirche – die Kirche als Arbeitgeberin – immer wieder kritisch angeschaut werden, und zwar in arbeitsrechtlicher wie in theologischer Hinsicht.
In einem Impulspapier der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde als Wesen der Kirche die »Freiheit« herausgestellt. (»Kirche der Freiheit«, so der Titel des Impulspapiers von 2007). Dieses Wesen muss sich Kirche auch im 21. Jahrhundert bewahren: Kirche der Freiheit, Kirche der Spielräume, Kirche als zugleich geistlicher Ruhepol und Sand im Getriebe, nicht bloßes Spiegelbild einer Beschleunigungs-, Optimierungs- und Leistungsgesellschaft.
Конец ознакомительного фрагмента.
Читать дальше