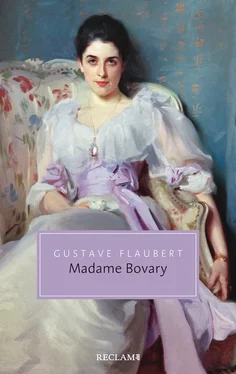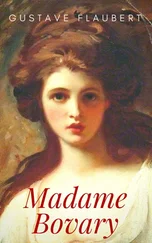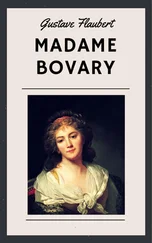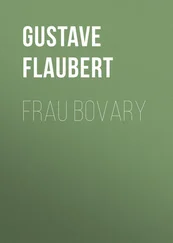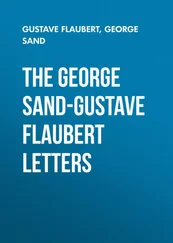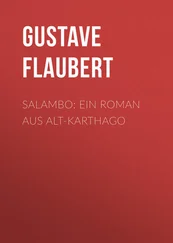Weil sie beständig über Tostes jammerte, bildete Charles sich ein, ihr Leiden habe sicherlich seine Ursache in einem örtlich bedingten Einfluss, und da er es bei diesem Einfall beließ, erwog er ernstlich, sich anderswo niederzulassen.
Fortan trank sie Essig, um magerer zu werden, legte sich einen kleinen, trockenen Husten zu und verlor jegliche Esslust.
Es fiel Charles schwer, von Tostes in dem Augenblick wegzugehen, da er nach vierjähriger Tätigkeit begann, »ein gemachter Mann zu werden«. Aber wenn es denn sein musste! Er brachte sie nach Rouen und suchte seinen alten Lehrer auf. Es sei eine nervöse Erkrankung: Luftveränderung sei vonnöten.
Nachdem Charles hier und dort Erkundigungen eingezogen hatte, erfuhr er, dass im Arrondissement Neufchâtel ein größerer Marktflecken namens Yonville-l’Abbaye liege, dessen Arzt, ein polnischer Flüchtling, in der vergangenen Woche das Weite gesucht habe. Also schrieb er an den dortigen Apotheker und erkundigte sich nach der Einwohnerzahl des Ortes, wie weit entfernt der nächste Kollege wohne, wie hoch das Jahreseinkommen seines Vorgängers gewesen sei usw., und da die Antworten zu seiner Zufriedenheit ausfielen, entschloss er sich, zu Frühlingsbeginn umzuziehen, sofern Emmas Gesundheitszustand sich bis dahin nicht gebessert habe.
Eines Tages, als Emma bei den Vorbereitungen des Umzugs in einem Schubfach kramte, stach sie sich mit irgend etwas in die Finger. Es war ein Eisendraht ihres Hochzeitsstraußes. Die Orangenknospen waren gelb vor Staub, und die Atlasbänder mit den silbernen Fransen waren an den Enden zerschlissen. Sie warf ihn ins Feuer. Er loderte schneller auf als trockenes Stroh. Dann gloste er wie ein feuriger Busch über der Asche, der sich langsam verzehrte. Sie sah ihn verglühen. Die kleinen Pappbeeren platzten, die Messingdrähte krümmten sich, die Silberfransen schmolzen, und die zusammengeschrumpften Papierblüten schwebten lange über der Platte wie schwarze Falter und flogen schließlich durch den Rauchfang davon.
Bei der Abreise von Tostes im März war Madame Bovary guter Hoffnung.
Yonville-l’Abbaye (so genannt nach einer ehemaligen Kapuzinerabtei, von der nicht einmal mehr die Ruinen vorhanden sind) ist ein Marktflecken, der etwa acht Meilen von Rouen entfernt liegt zwischen der Landstraße nach Abbeville und der nach Beauvais im Tal der Rieule, eines Flüsschens, das in die Andelle fließt, nachdem es kurz vor seiner Mündung drei Mühlen getrieben hat; es sind ein paar Forellen darin, die die Dorfbuben sonntags angeln.
Man verlässt die große Landstraße bei La Boissière und geht auf flachem Gelände weiter bis zur Anhöhe von Les Leux, von wo aus man das Tal überblicken kann. Der Fluss, der es durchquert, macht daraus etwas wie zwei Regionen von unterschiedlichem Aussehen: alles, was links liegt, ist Weideland; alles, was rechts liegt, wird beackert. Das Wiesengebiet zieht sich unterhalb eines Wulstes niedriger Hügel hin und nähert sich von hinten den großen Weidewiesen der Landschaft Bray, während nach Osten hin die Ebene sanft ansteigt, immer breiter wird und bis ins Unendliche ihre blonden Kornfelder ausbreitet. Das am Saum der Grasflächen hinfließende Wasser trennt mit einem weißen Streifen die Farbe der Wiesen und die der Ackerfurchen, und so ähnelt das Land einem großen, ausgebreiteten Mantel mit grünem, silberbebortetem Samtkragen.
Am Horizont hat man bei der Ankunft den Eichenwald von Argueil vor sich sowie die steilen Hänge von Saint-Jean, die von oben bis unten mit ungleichmäßigen roten Strichen gestreift sind; das sind die Spuren des Regenwassers, und jene ziegelsteinfarbenen Tönungen, die die graue Farbe des Berges in ein dünnes Netzwerk zerteilen, rühren von den vielen eisenhaltigen Quellen her, die von dort aus rundum ins Land hinabrinnen.
Man befindet sich hier auf der Grenzscheide der Normandie, der Picardie und der Ile-de-France, einer Bastardregion, wo die Mundart ohne Besonderheit ist und die Landschaft ohne Charakter. Dort werden die schlechtesten Neufchâteler Käse des ganzen Arrondissements hergestellt, und andererseits ist die Bewirtschaftung kostspielig, weil viel Mist verwendet werden muss, um den lockeren, mit Sand und Steinen durchsetzten Boden zu düngen.
Bis zum Jahre 1835 führte keine brauchbare Landstraße nach Yonville; zu jener Zeit jedoch ist ein Haupt-Gemeindeweg angelegt worden, der die Landstraße nach Abbeville mit der nach Amiens verbindet und gelegentlich von den Fuhrleuten benutzt wird, die von Rouen nach Flandern fahren. Gleichwohl ist Yonville trotz dieser »neuen Absatzwege« nicht vorwärtsgekommen. Anstatt den Ackerboden zu verbessern, verbleibt man hartnäckig bei der Weidewirtschaft, so wenig sie auch abwerfen mag, und die träge Gemeinde hat sich von der Ebene abgekehrt und selbstverständlich weiter nach der Wasserseite zu vergrößert. So sieht man schon von weitem den Flecken am Ufer entlang hingestreckt liegen wie einen Kuhhirten, der am Bach seine Mittagsruhe hält.
Am Fuß der Höhen hinter der Brücke beginnt eine mit jungen Pappeln gesäumte Chaussee, die geradewegs zu den ersten Häusern des Orts führt. Sie sind von Hecken umschlossen; inmitten der Gehege liegen zahlreiche, regellos verstreute Nebenbauten, Apfelpressen, Wagenschuppen und Brennereien zwischen buschigen Bäumen, in deren Gezweig Leitern, Stangen oder Sensen hängen. Die Strohdächer sehen aus wie bis an die Augen gestülpte Pelzmützen; sie verdecken fast ein Drittel der niedrigen Fenster, deren dicke, gewölbte Scheiben in der Mitte mit einem Knoten geziert sind, in der Art von Flaschenböden. An die weißen, von schwarzem Gebälk durchzogenen Kalkwände klammern sich hier und dort magere Birnbäume an, und die Türen der Erdgeschosse haben kleine, drehbare Klappen, damit die Küken, die auf den Schwellen in Zider getauchte Brotkrumen picken, nicht ins Haus laufen. Allmählich werden die Gehege enger, die Wohnstätten rücken dichter aneinander, die Hecken verschwinden; ein Bündel Farnkraut baumelt an einem Besenstiel unter einem Fenster; dort ist eine Hufschmiede, und dann kommt ein Stellmacher mit zwei oder drei neuen, zweirädrigen Karrenwagen, die auf die Landstraße hinausragen. Schließlich erscheint, zwischen Gitterstäben sichtbar, ein weißes Haus hinter einem Rasenrund, das ein Amor mit auf den Mund gelegtem Finger schmückt; zwei gusseiserne Vasen stehen an den beiden Enden der Freitreppe; an der Tür glänzen amtliche Schilder; es ist das Haus des Notars und das schönste des Dorfs.
Die Kirche liegt an der andern Seite der Straße zwanzig Schritte weiter, dort, wo es auf den Marktplatz geht. Der kleine Friedhof, der sie umgibt, umschlossen von einer brusthohen Mauer, ist so voller Gräber, dass die alten, in gleicher Höhe mit dem Boden liegenden Steinplatten ein ununterbrochenes Quaderpflaster bilden, darein das Gras ganz von sich aus regelmäßige, grüne Rechtecke gezeichnet hat. Die Kirche ist während der letzten Regierungsjahre Karls X. renoviert worden. Doch das Holzgewölbe beginnt oben ein bisschen morsch zu werden und zeigt an manchen Stellen in seinem blauen Anstrich schwarze Rillen. Über der Haupttür, dort, wo eigentlich die Orgel sein müsste, befindet sich eine Empore für die Männer; es führt eine Wendeltreppe hinauf, die unter den Holzschuhen hallt.
Das Tageslicht fällt in schrägen Strahlen durch die farblosen Fenster auf die Bänke, die quer zur Wand stehen; auf einigen ist eine kleine Strohmatte festgenagelt, und darunter steht in großen Buchstaben zu lesen: »Bank von Monsieur Soundso.« Weiter hinten, wo das Schiff sich verengt, steht dem Beichtstuhl gegenüber eine Statuette der Madonna; sie trägt ein Atlasgewand und einen mit silbernen Sternen besäten Tüllschleier; ihre Wangen sind genauso knallrot angemalt wie die eines Götzenbilds auf den Sandwich-Inseln; und schließlich beherrscht eine Kopie der »Heiligen Familie, Stiftung des Ministers des Innern«, zwischen vier Leuchtern den Hauptaltar und schließt das Blickfeld ab. Die Chorstühle aus Fichtenholz sind ohne Anstrich geblieben.
Читать дальше