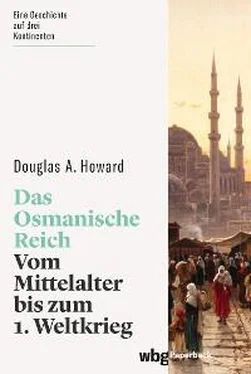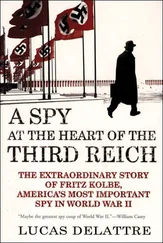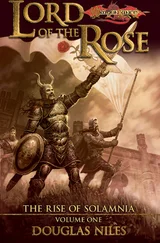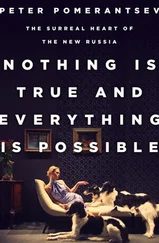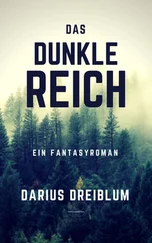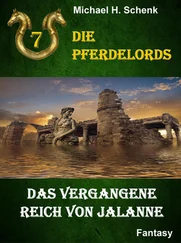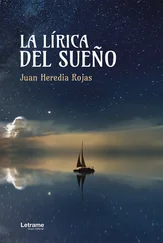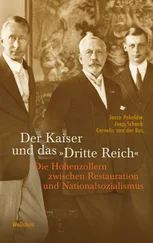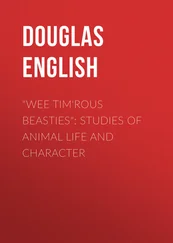Institutionell waren die Medresen eng verknüpft mit der Autorität und dem Reichtum der Erobererdynastie und mit dem Vakıf, jenem leistungsfähigen Finanzinstrument, das ursprünglich entstanden war, um die Medrese auszustatten und zu finanzieren. Der standardisierte Lehrplan der Medrese bestand aus der Lektüre und dem Verständnis klassischer Texte unter strenger Aufsicht des Lehrpersonals. Er umfasste Koranexegese (tafsir), Rechtskunde (fıkıh), Hadithstudien, philosophische Theologie (kalam) und arabische Grammatik, aber auch Medizin, Mathematik, Astronomie und Mystik (tasavvuf). Die Absolventen der Medresen besetzten die Ämter und Gerichtshöfe der Sultane. Die Scharia – also die Zusammenfassung des Korans und der gelebten Praxis des Propheten Mohammed (der Sunna), ausgelegt im Rahmen einer der vier anerkannten Schulen des islamischen Rechtsdenkens – bildete die Grundlage der islamischen Gesellschaft. Wie türkische Herrscher überall in der afroeurasischen Welt forderten die osmanischen Sultane die hanafitische Rechtsauslegung, welche gewöhnlich die Ernennung weltlicher Herrscher qua göttlicher Vorsehung guthieß. Doch die Scharia allein hat damals wie heute nie genügt, um eine islamische Gesellschaft zu regieren. Stets stand sie neben dem dynastischen Recht, den weltlichen Dekreten der Sultane.
Die Medrese war in den Ländern der Osmanen nicht das einzige Institut für höhere Bildung. Auch die führenden Sufi-„Ordenshäuser“, die Tekken, dienten als Akademien zur Ausbildung in Künsten und Wissenschaften. Das Studium der Schöpfung und des Korans wurde hier durch Quellen und Methoden vertieft, welche die Verbindungen zwischen beiden offenlegen sollten, einschließlich der esoterischen Wissenschaften. Die hierarchische Struktur und das Meister-Schüler-Verhältnis in der Tekke gaben der dortigen Bildung einen anderen Anstrich als jener in der Medrese. In der Tekke bedeutete höhere Bildung nicht bloß Wissensvertiefung, sondern auch geistige Reifung mittels einer zielgerichten betreuten Ausbildung in den geistigen Disziplinen und eines Studiums der Grundlagentexte.
Die Moschee richtete die Gläubigen auf die Erfüllung der Ziele des Lebens aus, und zwar durch die Zugehörigkeit zur Bundesgemeinschaft des Gottesvolkes. Der Gottesdienst in der Moschee war die organisierte Antwort des Menschen auf Gott. Er gipfelte in jenem liturgischen Augenblick beim Freitagsgebet, wenn der Imam auf die Kanzel stieg, um die Ansprache (hutbe) zu halten, und die Versammelten die Antwort des Menschen auf Gott in der rituellen secd, der Niederwerfung, der Überantwortung an die Einzigkeit Gottes, verwirklichten. Dem gingen Ermahnungen und Erläuterungen der heiligen Schriften voraus. Als abschließende Verkündigung erkannte die Hutbe auch den Monarchen an, dessen irdischer Schutz, legitimiert durch den Kalifen, diese Versammlung ermöglichte. Mit den täglichen Gebeten wurde den Muslimen eingeschärft, stets rechtzeitig auf Gott zu antworten; die wöchentlichen Predigten sorgten im Verein mit regelmäßigen Rezitationen aus dem heiligen Buch für eine straffe Disziplin in der Gemeinde; und der Jahreszyklus aus Fasten und Feiern, Pilgerfahrt und Rückkehr war die gelebte menschliche Hidschra; der Koran drückt es folgendermaßen aus (2,156): „Wenn ein Unglück sie trifft“, dann ist unser einziger Trost im Leben und im Tod: „Wir gehören Gott, und wir kehren zu Ihm zurück.“ 37
Für Aşıkpaşazade und die Mystiker jedoch erfolgte die Gottesverehrung nicht nur in der Moschee, sondern auch in der Gesellschaft von Scheichs und Derwischen in der Tekke. Es gab verschiedene Arten von Tekken, darunter einige, die mit ihren ortsansässigen Derwischen an Klöster erinnerten. Alle verfügten über einen Betsaal. In den Versammlungen hörten die Gläubigen zunächst dem Scheich zu, der über einen spirituellen Stammbaum vom Gründer und dessen designierten Stellvertretern abstammte; Höhepunkt war der als zikr (Erinnerung) bezeichnete rituelle Sprechgesang, mit dem der Name Gottes angerufen wurde. So wie der Sprechgesang einen Menschen dazu anhielt, den Namen auf den Benannten zurückzuführen, bedeutete die Liturgie des Ordenshauses (sema) eine Annäherung an die echte Begegnung mit Gott, eine Begegnung, die sich vielleicht nur einmal im Leben ereignete. In einem sozialen Umfeld, in dem diese Begegnung geachtet wurde, konnte die Tekke zu jenem Ort werden, wo man sie erwartete, suchte und möglicherweise in jeder weltlichen Begegnung erhoffte. Für die Sufis waren nicht nur die Koranverse Zeichen (ayet) Gottes, vielmehr offenbarten sich Gottes Eigenschaften in jedem Teil der Schöpfung. Der Scheich unterwies seine Schüler in der Auflösung des Ich, dem Tod des Selbst, der jede echte Gotteserfahrung begleitete und an ihrem Ende stand.
War die secd in der Moschee die fußfällige Reaktion der Geschöpfe auf den Ganz-Anderen, so war die sema in der Tekke die Umarmung der Liebenden. Musik und Tanz prägten die Gottesverehrung in der Tekke, und das Tor zu ihrer geistigen Tradition war die Lyrik. Sammlungen klassischer Dichtung (Divane) wurden zu einer Theologie mit anderen Mitteln, und Literaturgeschichte fungierte zugleich als Glaubensgeschichte.
Die Landschaft aus Meistern und Sekten war vielfältig, die Kanäle, über die sie sich gegenseitig beeinflussten, waren vielschichtig und veränderlich. 38Manche Gemäßigte, darunter Rumi und Hacı Bektaş, hatten Wurzeln in Chorasan und im zentralen Eurasien, aber die Herkunft zählte weniger als der emotionale Kontext des türkischen Lebens. In diesem Sinne waren die osmanischen Muslime die eigentlichen Erben von Ibn Arabi. Dieser andalusische Meister hatte nach seiner Pilgerfahrt nach Mekka 1203 zwei Jahrzehnte in den Seldschukenländern verbracht. Sadrettin Konavi, dessen Tekke in Konya ein führendes geistiges Zentrum bildete, waren Ibn Arabis adoptierter Stiefsohn und sein einflussreichster Ausleger. 39Neben dem Koran und den Hadithen waren Ibn Arabis Fusûs al-Hikam („Einfassungen der Weisheit“), 40die üblicherweise mit Hilfe von Konavis Kommentar studiert wurden, einer der beiden weiteren maßgeblichen Texte des osmanischen Islam. Der andere war Rumis Mesnevi, ein spiritueller Klassiker und eine in Verse gefasste schier unbeschreibliche Fundgrube kultureller Verweise. Das menschliche Verlangen nach Transzendenz, das in Ibn Arabis begrifflichem Wortschatz und in Rumis Poesie Ausdruck fand, verband alle osmanischen Sufis. Jedes Mitglied einer Tekke kannte und studierte diese Texte, kopierte und übersetzte sie. Ihr Einfluss durchzog das gesamte kulturelle Leben der Osmanen.
Die Klage der Rohrflöte
Die einleitenden 18 Doppelverse von Rumis Mesnevi, der Klage der Schilfrohrflöte über ihre Trennung vom Schilfbeet, aus dem sie fortgerissen wurde, waren Zeilen, die alle Osmanen sofort wiedererkannten:
Hör’ auf der Flöte Rohr, was es verkündet,
Hör’, wie es klagt, von Sehnsuchtsschmerz entzündet,
„Als man mich abschnitt am beschilften See,
Da weinte alle Welt bei meinem Weh.
Ich such’ ein sehnend Herz, in dessen Wunde
Ich gieße meines Trennungsleides Kunde:
Sehnt doch nach des Zusammenweilens Glück
Der Heimatferne allzeit sich zurück.
Klagend durchzog ich drum die weite Welt,
Und Schlechten bald, bald Guten beigesellt,
Galt jedem ich als Freund und als Gefährte,
– Und keiner fragte, was mein Herz beschwerte.
Und doch – so fern ist’s meiner Klage nicht,
Den Sinnen nur fehlt der Erkenntnis Licht.
So sind auch Seel’ und Leib einander klar,
Doch welchem Aug’ stellt je ein Geist sich dar?“
Kein Hauch, nein, Feuer sich dem Rohr entwindet.
Verderben dem, den diese Glut nicht zündet!
Der Liebe Glut ist’s, die im Rohre saust,
Der Liebe Seufzen, das im Wein aufbraust.
Getrennter Liebenden Gefährtin sie,
Zerreißt das Innerste die Melodie.
Читать дальше