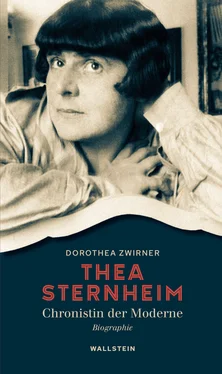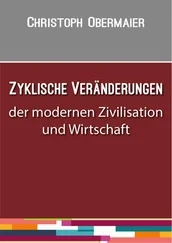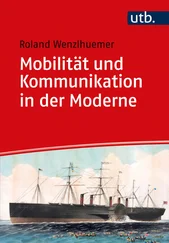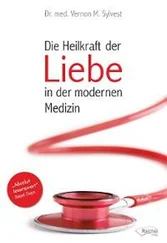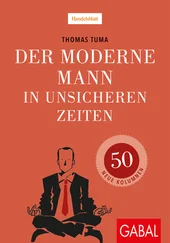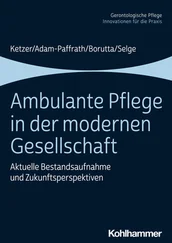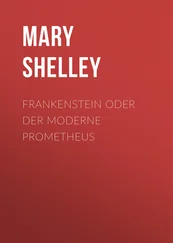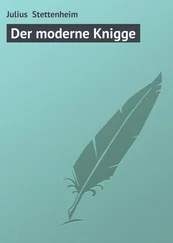Auf der Suche nach ihrem weiblichen Selbstverständnis hat Thea sich kaum aus der Bevormundung des Elternhauses befreit, als sie sich schon in einer neuen Abhängigkeit sieht. Die Notwendigkeit zur Anpassung und der Wunsch nach Selbstbestimmung stellen für die junge Ehefrau eine ebenso komplizierte Gradwanderung dar wie gerade noch für die heranwachsende Tochter. Im Zweifel über den grundsätzlichen oder individuellen Charakter dieses Zweispalts beginnt Thea den radikalen Bruch mit ihren Eltern zu bereuen und schreibt am 26. Februar 1902 einen versöhnlichen Brief an den Vater. Die Antwort erfolgt prompt und fällt ebenso liebevoll wie prinzipiell aus. Georg Bauer findet deutliche Worte, wie sehr er das eigenmächtige Handeln seiner Tochter für einen fatalen Fehler hält und wie sehr er sie dennoch liebt. Thea ist hin- und hergerissen zwischen dem eigenen Zweifel an ihrer Entscheidung und trotzigem Stolz, dafür geradezustehen. Um keinen Preis würde sie ihren Eltern eine Fehlentscheidung eingestehen, findet jedoch mit zwei weiteren Briefen an Vater und Mutter im März den richtigen Ton, um eine Versöhnung anzubahnen.
Nachdem die Anstellungsverhandlungen in Frankfurt gescheitert sind, lassen sich Thea und Arthur Löwenstein im April in Düsseldorf nieder, wo sie in Oberkassel eine Fünfzimmerwohnung beziehen. Erst jetzt kann das eigentliche Eheleben beginnen, das für Thea zum ersten Mal in ihrem Leben mit sämtlichen Haushaltspflichten verbunden ist. Drei Öfen müssen in dem zugigen Neubau ständig geheizt werden, und selbst die einfachsten Grundlagen des Kochens bedürfen der Übung. Zwar steht ihr eine Hilfe für die Wäsche und Putzarbeit zur Seite, aber praktisch wie wirtschaftlich muss sie sich in völlig neuen Lebensverhältnissen zurechtfinden. Das vergleichsweise bescheidene, aber dennoch nicht unbeträchtliche Vermögen von Arthur Löwenstein beträgt 140.000 Mark, wovon 10.000 Mark für die Einrichtung des Hausstandes inklusive eines Ibach-Flügels verwendet werden. Bis auf den eigenen Schreibtisch enthält sich Thea persönlicher Wünsche, so dass die Möblierung nach den Maßstäben der Jahrhundertwende relativ spärlich aussieht. Vom Schreibtisch aus bietet der Blick auf den Rhein die weite Aussicht, die Thea an Arthurs Seite zunehmend vermisst.
Ihr Mann verlässt morgens um 9 Uhr das Haus, kommt zum Mittagessen um 13 Uhr nach Hause und geht dann wieder in die Kanzlei, aus der er erst abends gegen 20 Uhr zurückkehrt. In der Zwischenzeit hat Thea den Haushalt zu versehen, nutzt aber jede freie Minute zum Lesen der durch Tolstoi entdeckten russischen Literatur. Statt sich darüber auszutauschen, darf Thea nach dem Abendessen ihrem Mann beim Geigenspiel zuhören. Bei allem Elan, Stolz und Trotz, mit dem sie ihre Entscheidung verteidigt und sich in ihrem Eheleben einrichtet, kann sie sich nicht über den Mangel an gemeinsamen Interessen hinwegtäuschen. Umso mehr freut sich Thea über den ersten Besuch ihrer Mutter, die ihre Tochter ohne Umschweife nach der kirchlichen Trauung fragt. Da sich Thea und Arthur dem väterlichen Wunsch nach einer katholischen Trauung problemlos fügen, steht einer Aussöhnung nichts mehr im Weg. Erleichtert über dieses Zugeständnis lässt Theas Mutter gleich eine ganze Reihe neuer Möbel und Perserteppiche von Köln nach Düsseldorf liefern, die für mehr Wohnlichkeit und Komfort sorgen sollen.
Auch wenn in großen Teilen des Rheinlandes und speziell in Köln relativ gute katholisch-jüdische Beziehungen herrschen, so richten sich die Vorbehalte von Theas Eltern vermutlich genauso gegen eine interreligiöse wie gegen eine interkonfessionelle Ehe. Ein protestantischer Schwiegersohn wäre wohl nicht viel willkommener gewesen als ein jüdischer, zumal es aus Elternsicht im Zweifelsfall beide gleichermaßen auf die Mitgift ihrer Tochter abgesehen haben. Um 1900 ist das Thema der katholisch-protestantischen Mischehe noch keineswegs erledigt.[46] Zwar hat deren Zahl im Zuge der Urbanisierung des 19. Jahrhunderts beständig zugenommen, jedoch beläuft sich der Anteil in Preußen um 1900 immer noch erst auf 8,5 %.[47] Im Dauerkonflikt zwischen protestantischem Preußen und katholischem Rheinland spielt das Problem der Mischehe eine Schlüsselrolle, die vom sogenannten Mischehen-Streit der 1830er Jahre über den Kulturkampf der 1870er Jahre bis weit ins 20. Jahrhundert reicht. Die Frage der religiösen Kindererziehung bildet den Kern dieses Konflikts, auch für den fortschrittlichen Unternehmer Georg Bauer. Mit der Zustimmung der Brautleute, die gemeinsamen Kinder katholisch zu erziehen, ist das größte Hindernis für eine Aussöhnung beseitigt. So wird am 3. Mai 1902 die kirchliche Trauung in Deutz im Beisein von Theas Mutter, Tante Linchen und Kusine Olga vollzogen. Theas Vater kann sich noch nicht dazu durchringen, an der Hochzeit seiner einzigen Tochter teilzunehmen, doch schon wenig später folgt das rührende Wiedersehen im Elternhaus. Nach der tränenreichen Umarmung des Vaters wird die heimgekehrte Tochter des Hauses vom versammelten Personal in der Küche empfangen. Nun muss das Fräulein Thea von seiner abenteuerlichen Flucht berichten, hat doch ihr Aufbegehren gegen den Haushaltsvorstand ein ungläubiges Staunen verursacht. Noch größer ist allerdings das neugierige Staunen über den eigenen Hausstand, den die Frau Doktor dem Vernehmen nach eingerichtet hat und nun selbstständig führt. Es ist eine filmreife Küchenszene, die Thea Sternheim in ihren Erinnerungen schildert.
Die Versöhnung mit den Eltern zieht nicht nur deren erneute finanzielle Unterstützung nach sich, sondern gibt Thea auch neue Hoffnung für ihre Ehe. Wenn die Differenzen mit den Eltern zu überwinden waren, so sind es auch die atmosphärischen Störungen zwischen Arthur und ihr. Voll neuer Hoffnungen ist Thea bald schwanger. Doch weder die wirtschaftliche Freizügigkeit noch die Schwangerschaft können die Entfremdung zwischen den Eheleuten aufhalten, so dass sich Thea zunehmend in sich zurückzieht. Der besorgte Ehemann reagiert darauf mit dem Geschenk eines Foxterriers, dem Thea vielleicht als Kompensation für ihr eigenes Abhängigkeitsgefühl den Namen »Frei« gibt. In dieser Situation ist Thea nicht unglücklich, dass Arthur im Sommer als Reserveleutnant zu einem Manöver nach Würzburg reisen muss. Während seiner Abwesenheit zieht sie zu ihren Eltern nach Köln, wo sich Tochter und Mutter angesichts der Schwangerschaft einander weiter annähern.
Am 3. Dezember 1902 bringt Thea ihr erstes Kind durch eine schwere Zangengeburt zur Welt, das nach seiner Großmutter Agnes benannt, doch bald schon Nucki gerufen wird. Durch diese einschneidende Erfahrung wächst die Verbundenheit zwischen Thea und ihrer Mutter, die nun täglich zu Besuch kommt und ganz vernarrt in das nach ihr benannte erste Enkelkind ist. Doch zwischen den Eltern vermag selbst das gemeinsame Kind keine Nähe mehr herzustellen. Trotz aller Fürsorge und Freundschaft vermisst Thea in Arthur den Gesprächspartner. Sosehr sie tagsüber in ihrer neuen Mutterrolle aufgeht, so sehr beginnt sie sich abends in seiner Gegenwart zu langweilen. Umso mehr freut sie sich auf den angekündigten Besuch ihrer Bonner Internatsfreundin Eugenie, aber auch auf deren Ehemann, den Schriftsteller Carl Sternheim.
Es ist Frühjahr 1903, als die neunzehnjährige Thea ihre alte Schulfreundin erwartet. Vielleicht sitzt sie wie so oft an ihrem Schreibtisch und lässt den Blick erwartungsvoll über die Uferpromenade oberhalb der Rheinwiesen wandern. Von ihrem Lieblingsplatz am Erkerfenster kann das Auge dem breiten Flusslauf ein gutes Stück weit folgen. Jede freie Minute verbringt sie hier, sobald sich ihr Mann in seine Anwaltskanzlei begeben hat, die Haushaltspflichten erledigt oder delegiert sind und ihre kleine Tochter Agnes im Kinderzimmer nebenan von der Amme gestillt in der Wiege schläft. Ständig sind Briefe zu schreiben an die Eltern in Köln, die Internatsfreundinnen aus Bonn und Brüssel und den wachsenden Bekannten- und Freundeskreis in Düsseldorf. Täglich kommen und gehen die Briefe, deren Besorgung für sie mehr als nur selbstverständliche Pflicht ist. Neben der Korrespondenz versucht sich Thea auch an eigenen Gedichten, die sie in der Schublade ihres verschließbaren Rollladen-Schreibtisches verwahrt. Es ist das einzige Möbelstück, das sie sich für ihren neuen Hausstand ausgesucht hat, kein zierliches Damenmöbel, sondern ein massiver Eichenholzsekretär der Firma Soennecken, mit dem sie ihren Anspruch auf einen eigenen Schreibplatz und privaten Rückzugsort in den Erker des Musikzimmers gestellt hat, das von Arthurs Ibach-Flügel dominiert wird.
Читать дальше