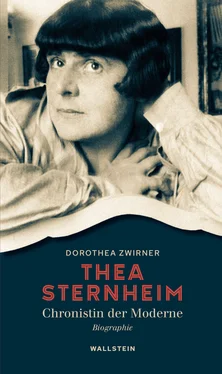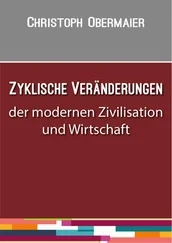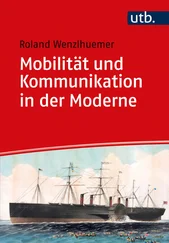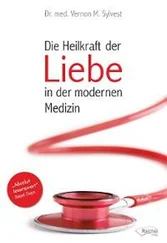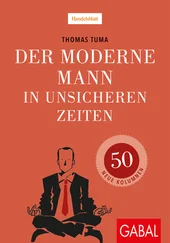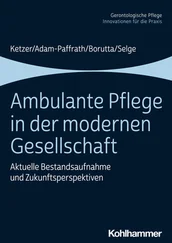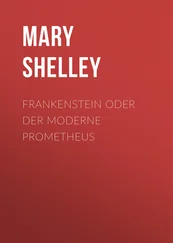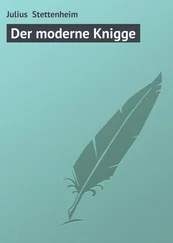Das soll sich bald ändern, als Thea in den Sommerferien 1899 in Köln Arthur Löwenstein kennenlernt. Bei einer Kutschfahrt im Phaeton mit ihrem Bruder Richard begegnet sie ihm das erste Mal, als er gerade aus dem Reitstall kommt. Der angehende Rechtsanwalt verfügt im Unterschied zu ihren bodenständigen und amusischen Brüdern über genau das, was ein feinsinniges Mädchen wie Thea Bauer faszinieren muss: Er sieht gut aus, spielt leidenschaftlich Geige, interessiert sich für Musik und Philosophie und ist galant. Mit dem ersten Kuss ist für Thea jedoch weniger der sinnliche Reiz als der des Verbotenen geweckt. Noch bevor die Sommerferien zu Ende gehen, ist die Fünfzehnjährige mit dem zehn Jahre älteren Löwenstein heimlich verlobt.
Damit bekommt ihre Schreiblust bei der Rückkehr ins Internat eine ganz neue Richtung. Löwenstein ist der willkommene Adressat für einen heimlichen Briefwechsel, der von Theas Vater entdeckt, verboten und von den Verlobten heimlich fortgesetzt wird. Aus dem verbotenen Spiel wird plötzlich Ernst, als Löwenstein beim Weihnachtsbesuch um Theas Hand anhält. Vom Vater schroff zurückgewiesen, muss sich Thea schweren Herzens fügen, mag dabei aber auch eine gewisse Erleichterung empfunden haben. Jedenfalls stürzt sie sich noch einmal in das anregende Internatsleben mit den gleichaltrigen Mitschülerinnen. Neben ihrer literarischen Neigung entdeckt Thea bei den Malern der flämischen Schule ihre Begeisterung für die bildende Kunst. In der Verbindung zwischen individuellem Gefühlsausdruck, religiöser Inbrunst und verborgenem Symbolismus findet sie bei den frühen Niederländern genau die Mischung aus Gefühl, Geist und Intellekt, die sie ein Leben lang begeistern wird.
Theas Bildungshunger verdrängt ihren Liebeskummer und führt zu dem Wunsch, das Abitur machen zu dürfen. Da die Allgemeine Hochschulreife für deutsche Mädchen um 1900 nach wie vor die Ausnahme bildet, lehnt Georg Bauer das Ansinnen seiner Tochter ab. Noch immer steht Preußen Gymnasien für Mädchen ablehnend gegenüber, unterstützt aber ab 1893 die Errichtung aufbauender Oberlehrerinnen- oder Gymnasialkurse.[33] In der zunehmenden Diskussion um die Gleichberechtigung und Verbesserung der Bildungschancen für Mädchen und Frauen hat die bürgerliche Frauenbewegung mit ihren schnell wachsenden Frauenvereinen einen bedeutenden Anteil.[34] Im Jahr 1899, als Thea ihren Abiturwunsch äußert, wird in Köln gerade auf Initiative von Mathilde von Mevissen der »Verein Mädchengymnasium Köln« gegründet.[35] Die 1848 geborene Mathilde von Mevissen stammt wie Thea aus dem industriellen Großbürgertum Kölns und hat bis ins Erwachsenenalter unter ihrer mangelnden Bildung gelitten. Aus diesem Defizit heraus hat sie 1890 die Frauenbewegung für sich entdeckt und die Förderung der Mädchen- und Frauenbildung zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Zwar gehört es in Köln schon bald »zum guten Ton, Mitglied des Vereins Mädchengymnasium zu sein«, jedoch zieht sich das Genehmigungsverfahren so lange hin, dass erst 1903 das erste humanistische Mädchengymnasium in Deutschland, zunächst auf Probe, gegründet wird.[36] Auch wenn diese Gründung für Theas Abiturwunsch zu spät kommt, hätte eine wohlhabende Bürgerstochter wie sie ohne Weiteres einen gymnasialen Aufbaukurs machen oder ihr Abitur auch im benachbarten Belgien, in Frankreich oder der Schweiz machen können, wo den Mädchen bereits seit den 1870er und 1880er Jahren die Allgemeine Hochschulreife und der Zugang zu den Universitäten offenstand.[37]
Für Theas Vater liegt diese Möglichkeit offenbar noch weitgehend außerhalb seines wie des allgemeinen Vorstellungshorizontes. Oder will er seine Tochter, wie diese mutmaßt, bewusst in Abhängigkeit halten? Vermutlich hätte er gut daran getan, Theas offenkundiger Begabung und Wissbegierde Ziel und Richtung zu geben. Stattdessen schürt seine rechthaberische Mitteilung, dass Löwenstein bereits um die Hand einer anderen jungen Dame angehalten habe und ebenfalls abgewiesen worden sei, Theas Widerspruchsgeist. Sie nimmt den heimlichen Briefwechsel mit ihrem Verlobten wieder auf, schwört ihm ewige Treue und wird abermals entdeckt. Diesmal fällt das väterliche Verbot ungleich deutlicher aus. In einem emotionalen Brief zeigt sich der Vater enttäuscht über den Vertrauensbruch und unterstellt dem Heiratskandidaten vor allem pekuniäre Motive, die seine unerfahrene Tochter noch nicht durchschauen könne. Diese Unterstellung trifft Thea an ihrer empfindlichsten Stelle, so dass sie darüber sogar die gleichzeitig eintreffende Nachricht vom Tod ihrer geliebten Großmutter Schwaben kaum zur Kenntnis nimmt. Ausgerechnet in diesem Moment geht für Thea nach knapp drei Jahren im Winter 1900 die Brüsseler Pensionatszeit zu Ende, so dass sie voll inneren Aufruhrs mit gerade siebzehn ins Elternhaus zurückkehren muss. Entsprechend aufgeladen muss man sich wohl die häusliche Stimmung vorstellen, die sich am Dreikönigstag 1901 in einer dramatischen Szene entlädt. Thea hat die sie zum Kirchgang begleitende Jungfer zu einem heimlichen Treffen mit Arthur Löwenstein überredet. Bei ihrer Rückkehr konfrontiert die Mutter sie mit einer Lutherbibel, die sie in Theas Zimmer gefunden hat und für ein Geschenk Löwensteins hält. Der heftige Wortwechsel gipfelt in der ersten Ohrfeige, die Thea je bekommen hat. Außer sich vor Wut stürzt sie sich auf die Mutter und erhält vom herbeieilenden Vater die nächste Ohrfeige. In ihrer Verzweiflung versucht Thea aus dem Fenster zu springen und verfällt, als man sie daran hindert, in einen Weinkrampf.
So marginal der Anlass des Streites gewesen ist, so nachhaltig erschüttert er Theas ohnehin getrübtes Verhältnis zu ihren Eltern. Von nun an herrscht eisiges Schweigen bei Tisch, den Thea gleich nach den Mahlzeiten verlässt, um sich in ihr Zimmer zurückzuziehen.
In dieser prekären Lage ist wieder einmal Hedwig Schaurtes Einladung, mit ihr und ihren vier Kindern die Sommerferien in Holland zu verbringen, die willkommene Rettung. Außer Ablenkung und Zerstreuung hat Thea nun die Mutterfreuden ihrer vergötterten Freundin täglich vor Augen, die ihr als verlockende Zukunftsvision erscheinen. Fern vom Elternhaus lassen sich weitere Briefwechsel und Treffen mit Löwenstein arrangieren, bei denen der Plan zu einer heimlichen Flucht und Heirat heranreift. Die letzten Zweifel hilft Hedwig Schaurte zu überwinden, die sich beim geschickt eingefädelten Kennenlernen von dem heimlichen Verlobten und den romantischen Fluchtplänen begeistern lässt. Kabale und Liebe übernehmen die Regie.
Wie alle großen Lebensentscheidungen ist auch diese für Thea mit einem literarischen Schlüsselerlebnis verbunden. Tolstois gerade in deutscher Übersetzung erschienener letzter Roman, Auferstehung, ist das erste Werk des russischen Dichters, das ihr zufällig in die Hände fällt und den Beginn einer lebenslangen Verehrung markiert.[38] Bei nachmittäglichen Ausflügen in die botanische Gartenanlage »Flora« liest sie ihrer Kusine Olga die Läuterungsgeschichte des adligen Gutsbesitzers Nechljudow vor, der als Geschworener vor Gericht über eine Prostituierte urteilen soll. Als dieser in der Angeklagten die von ihm in jungen Jahren verführte Katjuschka erkennt, fühlt er sich schuldig am Schicksal der zu Unrecht Verurteilten und folgt ihr in die Verbannung nach Sibirien. Das Motiv der selbstlosen Liebe als Wiedergutmachung und Pflicht berührt Thea zutiefst, da es ihr wie eine Bestätigung für ihren Entschluss gegen die väterliche Zurückweisung von Löwenstein als jüdischem Mitgiftjäger erscheint. Ist es nicht ihre heilige Pflicht, den Verlobten gegen die antisemitischen Vorwürfe ihres Vaters bedingungslos zu verteidigen? In diesem Tenor verfasst Thea, unterstützt von Hedwig Schaurte, einen ebenso radikalen wie pathetischen Abschiedsbrief an ihre Eltern:
»Ich bitte Euch um Verzeihung, weil ich Euch Kummer bereiten muß, nicht darum, weil ich fortgehe, denn das ist mein Muß und mein Wille. Ich habe mich nicht überreden lassen. Ich bin aus freien Stücken und mit meiner Liebe gegangen. Es ist gut, daß ich gegangen bin. Das war kein Leben mehr zu Haus, nicht für Euch und nicht für mich. Ich wußte mich jeder Freiheit beraubt, an allen Ecken und Enden beobachtet; das aber sind Dinge die sich nicht ertragen lassen. Auch hätte ich nicht länger unter Menschen leben können, die mir mein Liebstes und Bestes wegnehmen. Und das ist Euer Wille gewesen. Ihr sagtet, daß ihr mein Glück wolltet; mag sein; aber das Glück ist verschieden. […]
Читать дальше